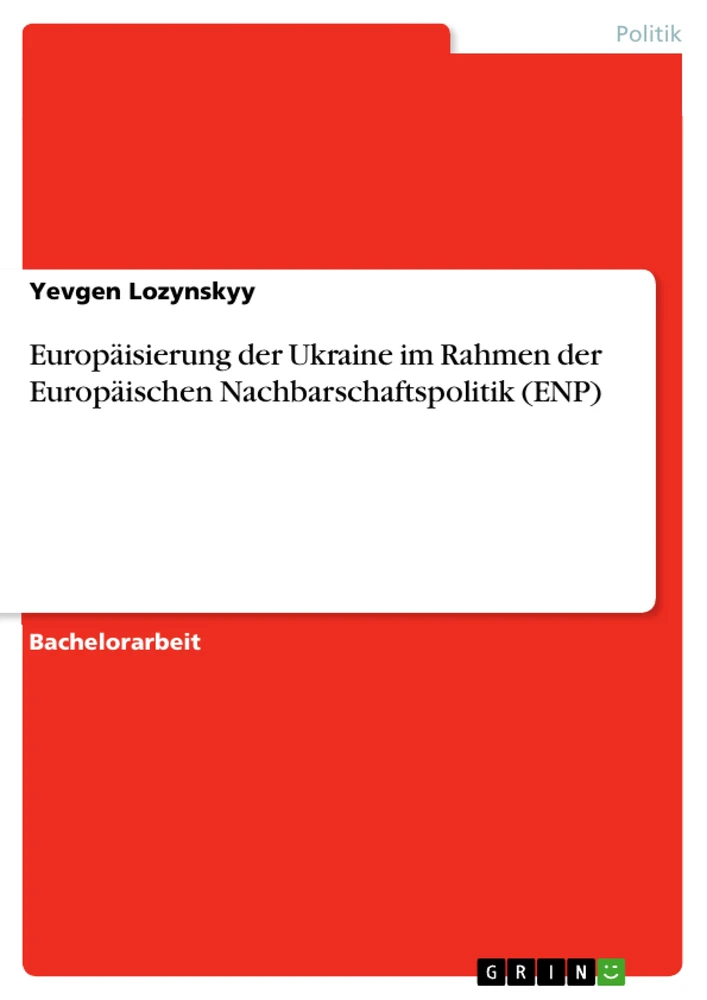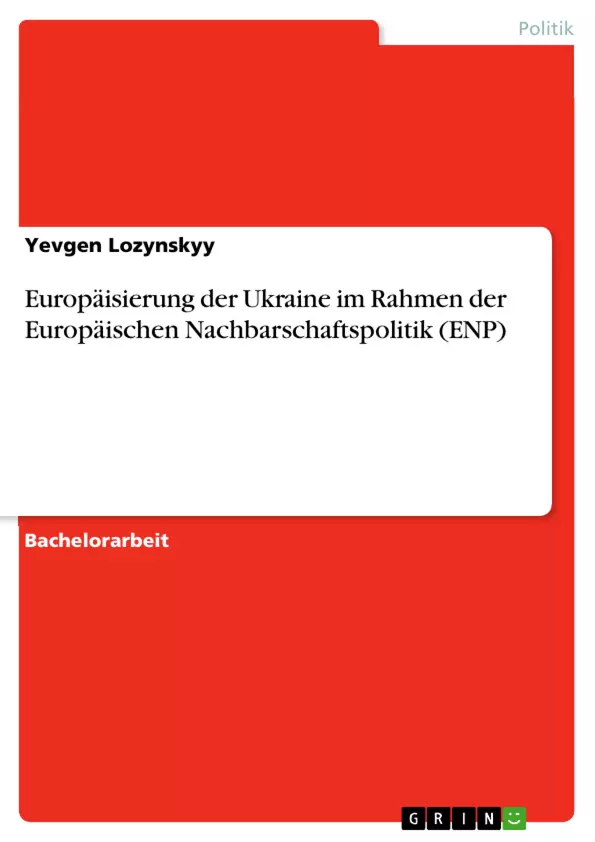Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der EU auf den Reformprozess in der Ukraine. Dabei fokussiert sich die empirische Analyse im Rahmen dieser Arbeit zum einen auf den Bereich der Korruptionsbekämpfung und zum anderen auf den Zeitraum nach der Euromaidan-Revolution. Die Forschungsfrage, die in diesem Kontext beantwortet werden soll, lautet: Inwieweit konnte die Europäische Union im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine seit der Euromaidan-Revolution 2013/2014 beitragen?
Die Struktur der Arbeit unterteilt sich in die Abschnitte Theorie, Methodik, Analyse, Auswertung, Zusammenfassung und Ausblick. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist es zunächst erforderlich den theoretischen Bezugsrahmen zu erläutern. Ein kurzer Überblick des bisherigen Forschungsstandes zur Europäischen Nachbarschaftspolitik sowie zur Euromaidan-Revolution und der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine leitet den theoretischen Teil dieser Arbeit ein. Anschließend werden die grundlegenden Entwicklungslinien, Ziele und Instrumente der ENP und der Östlichen Partnerschaft (ÖP) thematisiert. Der Schwerpunkt im theoretischen Teil liegt allerdings auf den von Frank Schimmelfennig erforschten Mechanismen zur Europäisierung von Drittstaaten. Dabei werden die beiden konkurrierenden Modelle Externalisierung und Sozialisierung vorgestellt. Sie umfassen verschiedene Akteurslogiken, Dynamiken und Faktoren und liefern somit unterschiedliche Erklärungsansätze für den Europäisierungsprozess von ENP-Adressaten. Die Mechanismen verdeutlichen wie und in welcher Form die EU zur Europäisierung von Drittstaaten beitragen kann und sind somit zentral für die Beantwortung der gestellten Forschungsfrage. Im Anschluss an den theoretischen Rahmen folgt ein Überblick zur verwendeten Methodik. Hierbei wird im Wesentlichen auf die Fallauswahl, die empirische Prozessanalyse, die darauffolgende Auswertung sowie den Zeitrahmen, indem sich diese Arbeit bewegt, eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zielsetzung und Themenschwerpunkte
- Forschungsansatz und Methodik
- Kapitel 1: Theoretische Grundlagen
- Das Konzept der Inklusion
- Inklusion in der Bildung
- Kapitel 2: Empirische Befunde
- Die BiLieF-Studie
- Inklusive und exklusive Schulformen
- Kapitel 3: Herausforderungen und Chancen der Inklusion
- Pädagogische Herausforderungen
- Soziale und gesellschaftliche Herausforderungen
- Kapitel 4: Perspektiven für die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Inklusion in der Bildung und untersucht empirisch die Auswirkungen unterschiedlicher Schulformen auf die Lernentwicklung und das soziale Miteinander von Schülerinnen und Schülern. Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Inklusion beleuchtet und die Ergebnisse der BiLieF-Studie vorgestellt. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen der Inklusion und erörtert Perspektiven für die Zukunft der Bildungsgestaltung.
- Konzept der Inklusion in der Bildung
- Empirische Befunde der BiLieF-Studie
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion
- Pädagogische und gesellschaftliche Implikationen der Inklusion
- Perspektiven für die Zukunft der Bildungsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 legt die theoretischen Grundlagen der Inklusion dar und beleuchtet das Konzept der Inklusion in der Bildung. Es werden die verschiedenen Dimensionen der Inklusion erörtert und die Bedeutung von Teilhabe und Selbstbestimmung für alle Schülerinnen und Schüler hervorgehoben. Kapitel 2 präsentiert empirische Befunde aus der BiLieF-Studie, die den Einfluss unterschiedlicher Schulformen auf die Lernentwicklung und das soziale Miteinander von Schülerinnen und Schülern untersucht. Die Studie beleuchtet die Unterschiede zwischen inklusiven und exklusiven Schulformen und analysiert die Auswirkungen auf die schulische Leistung, die soziale Integration und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. Kapitel 3 geht auf die Herausforderungen und Chancen der Inklusion ein. Es werden sowohl pädagogische Herausforderungen wie die Gestaltung inklusiver Lernumgebungen und die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler, als auch soziale und gesellschaftliche Herausforderungen wie die Überwindung von Vorurteilen und Diskriminierung thematisiert. Kapitel 4 blickt auf die Zukunft der Inklusion und erörtert Perspektiven für die weitere Entwicklung der Bildungsgestaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Inklusion in der Bildung, der BiLieF-Studie, der empirischen Forschung, der Inklusion und Exklusion in der Bildung, den Herausforderungen und Chancen der Inklusion und den Perspektiven für die Zukunft der Bildungsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernziel von Inklusion in der Bildung?
Inklusion zielt darauf ab, allen Schülern – unabhängig von Beeinträchtigungen – die volle Teilhabe an gemeinsamer Bildung und Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Was untersucht die BiLieF-Studie?
Die Studie untersucht die Auswirkungen inklusiver versus exklusiver Schulformen auf die Lernentwicklung, die soziale Integration und das Wohlbefinden von Schülern.
Welche pädagogischen Herausforderungen bringt Inklusion mit sich?
Dazu gehören die Gestaltung differenzierter Lernumgebungen, die individuelle Förderung jedes Kindes und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams.
Gibt es Unterschiede im sozialen Miteinander bei verschiedenen Schulformen?
Empirische Befunde zeigen, dass inklusive Settings Vorurteile abbauen können, aber auch spezifische soziale Dynamiken und Unterstützungsbedarfe erfordern.
Wie sieht die Zukunft der Bildungsgestaltung im Bereich Inklusion aus?
Die Arbeit diskutiert Perspektiven zur Überwindung von Diskriminierung und die notwendige Weiterentwicklung von Bildungsstandards für eine inklusive Gesellschaft.
- Citation du texte
- Yevgen Lozynskyy (Auteur), 2018, Europäisierung der Ukraine im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988511