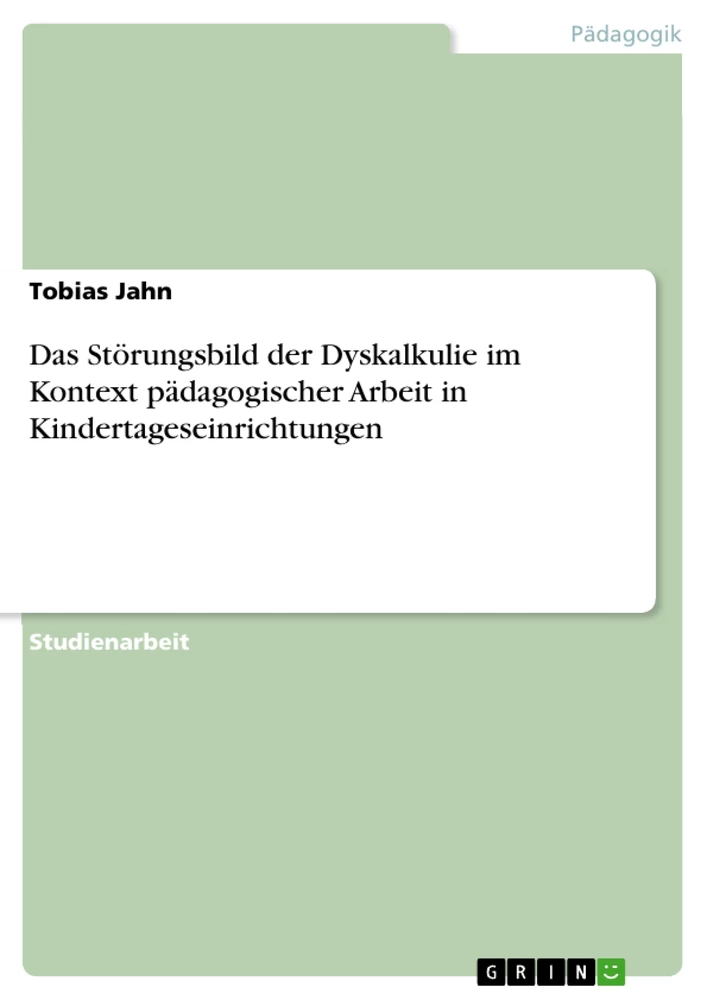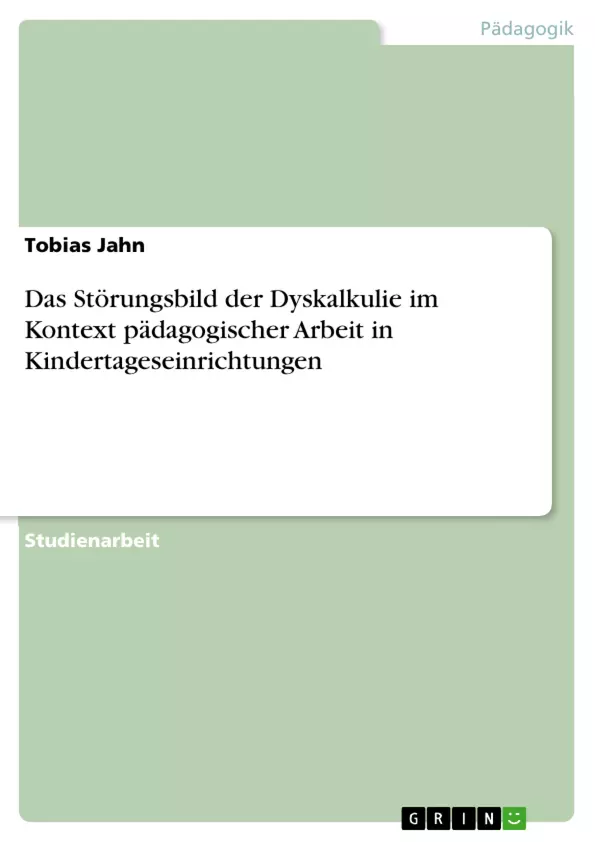Diese Arbeit wird von der Frage geleitet, wie sich das Störungsbild der RS charakterisieren lässt, wie dieses im pädagogischen Kontext frühzeitig erkannt und darauf angemessen reagiert werden kann, um negative Auswirkungen auf Betroffene zu minimieren. Nach einer Begriffsbestimmung soll zunächst das Störungsbild und dessen Ätiologie beschrieben werden. Darauf folgen Ausführungen zur therapeutischen Diagnostik und zu Interventionen. Im nächsten Schritt sollen diese Erkenntnisse dann in die pädagogische Praxis transferiert werden. Am Ende steht eine kurze Zusammenfassung, die einen Überblick zu den wichtigsten Erkenntnissen dieser Arbeit geben soll. Inhaltliche Eingrenzungen sind an den entsprechenden Stellen in den einzelnen Kapiteln der Arbeit kenntlich gemacht. Eine tiefere Auseinandersetzung scheint somit nicht nur interessant, sondern mit Blick auf die pädagogische Praxis in Kindertageseinrichtungen sehr sinnvoll.
Weltweit bekannte Persönlichkeiten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Napoleon Bonaparte und Leonardo da Vinci sollen zu ihren Lebzeiten davon genauso betroffen gewesen sein wie zahlreiche Kinder, die heute aufwachsen. Die Rede ist von der Lese- und Rechtschreibstörung (LRS), die sich zu Zeiten der Grundschule besonders im Unterrichtsfach Deutsch manifestiert. Im Mathematikunterricht kann sich eine ähnliche Störung bemerkbar machen, die im Gegensatz zur LRS spürbar seltener thematisiert wird und zu der keine Listen betroffener Persönlichkeiten im Internet zu finden sind: die Rechenstörung (RS). Während sich die Forschung schon lange Zeit intensiv mit der LRS in Kontexten der frühkindlichen Bildung auseinandergesetzt hat, wird die auch als Dyskalkulie bekannte RS zwar ähnlich häufig diagnostiziert. Sie ist aber deutlich unbekannter, weniger gut erforscht und daher noch heute von vielen Unklarheiten bestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmung und ICD-10 Klassifikation
- 3 Darstellung der Störung
- 4 Ätiologie
- 5 Diagnostik und Therapie
- 6 Pädagogische Interventionen
- 6.1 Früherkennung im Kindergarten
- 6.2 Das Förderprogramm „Spielend Mathe“
- 6.3 Prävention im pädagogischen Alltag in Kindergarten und Hort
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit dem Störungsbild der Dyskalkulie, auch bekannt als Rechenstörung (RS), im Kontext der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen auseinander. Ziel ist es, das Störungsbild zu charakterisieren, Möglichkeiten zur Früherkennung und entsprechenden pädagogischen Interventionen aufzuzeigen, um negative Auswirkungen auf betroffene Kinder zu minimieren.
- Begriffsbestimmung und ICD-10 Klassifikation der RS
- Darstellung der Störung: Symptome, Prävalenz und Begleiterscheinungen
- Ätiologie: Multifaktorielle Ursachen der RS, inklusive genetischer, neurophysiologischer und sozial-emotionaler Faktoren
- Pädagogische Interventionen: Früherkennung im Kindergarten, Förderprogramme und Präventionsmaßnahmen im pädagogischen Alltag
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Charakterisierung der RS, ihrer Früherkennung und geeigneten Interventionen in der pädagogischen Praxis. Kapitel 2 erläutert die Begriffsbestimmung der RS und ihre Klassifikation im ICD-10. Kapitel 3 beschreibt die Störung mit ihren typischen Merkmalen, der Prävalenz und möglichen Begleiterscheinungen. Kapitel 4 beleuchtet die multifaktoriellen Ursachen der RS, die genetische Disposition, neurophysiologische Faktoren und psychosoziale Einflüsse beinhalten.
Schlüsselwörter
Rechenstörung, Dyskalkulie, Früherkennung, pädagogische Intervention, Kindergarten, Förderprogramm, Prävention, ICD-10, Ätiologie, neurophysiologische Faktoren, psychosoziale Einflüsse, Komorbidität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen LRS und RS?
Während LRS (Lese-Rechtschreibstörung) das Lesen und Schreiben betrifft, bezeichnet RS (Rechenstörung oder Dyskalkulie) gravierende Schwierigkeiten im Umgang mit Zahlen und Grundrechenarten.
Wie erkennt man Dyskalkulie im Kindergarten?
Anzeichen sind Schwierigkeiten beim Zählen, beim Erkennen von Mengen oder beim Zuordnen von Zahlen zu Objekten im spielerischen Kontext.
Welche Ursachen hat eine Rechenstörung?
Die Ursachen sind multifaktoriell und umfassen genetische Dispositionen, neurophysiologische Faktoren sowie psychosoziale Einflüsse.
Was ist das Förderprogramm „Spielend Mathe“?
Es ist ein pädagogisches Konzept zur spielerischen Förderung mathematischer Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten- und Hortalltag.
Warum ist Früherkennung bei Dyskalkulie so wichtig?
Frühzeitige Interventionen können negative Auswirkungen auf die Schullaufbahn und das Selbstwertgefühl der betroffenen Kinder minimieren.
- Citation du texte
- Tobias Jahn (Auteur), 2020, Das Störungsbild der Dyskalkulie im Kontext pädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988110