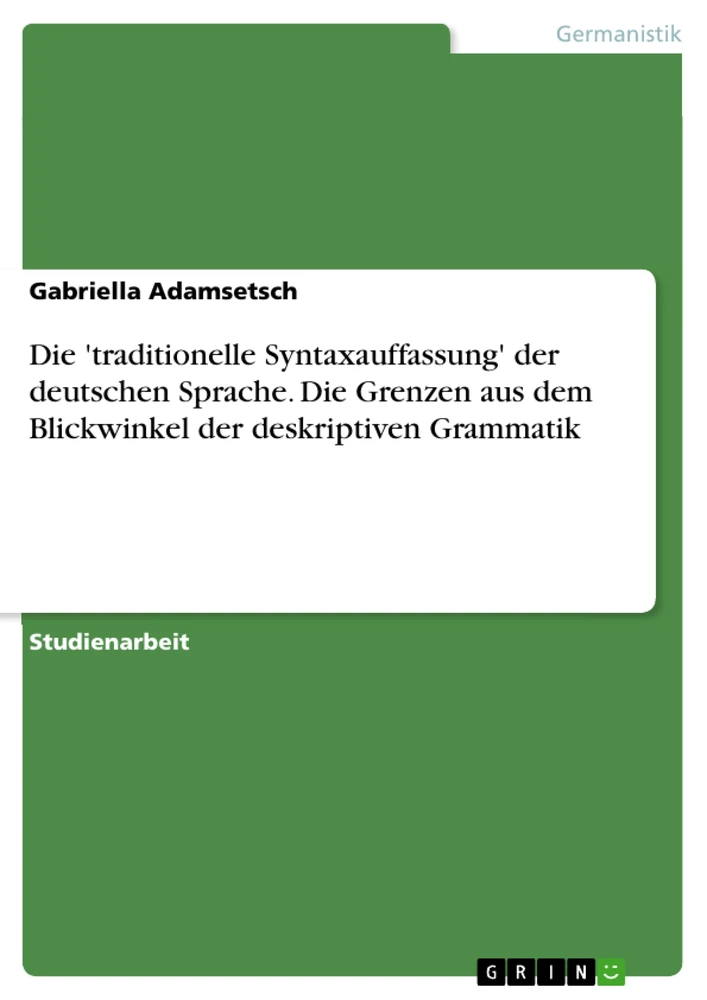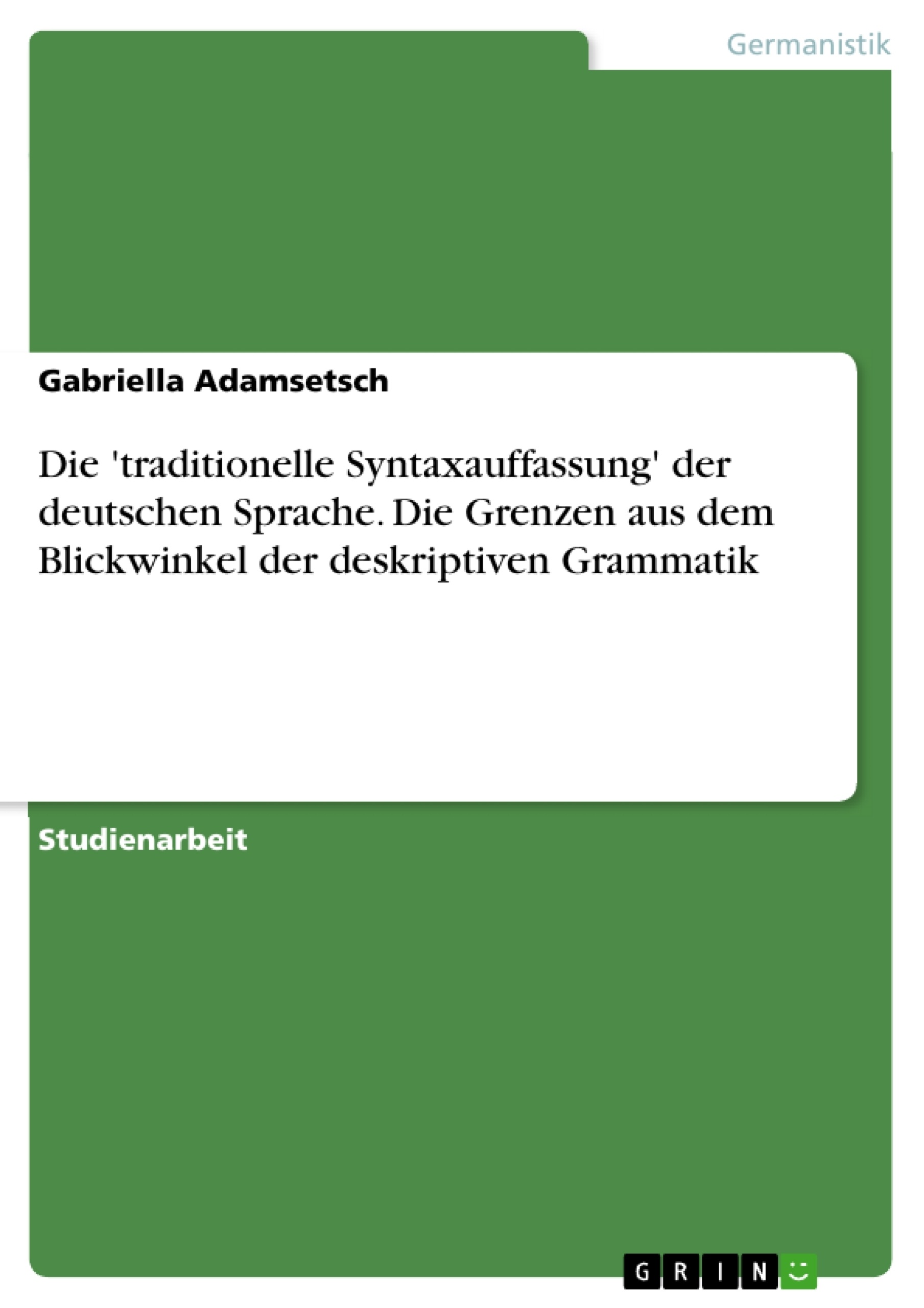Das Ziel der Arbeit ist es, konkrete Probleme und Limits der präskriptiven Satzglied- und Wortartentheorie zu benennen und sie durch das ‚Instrumentarium‘ und die Logik der deskriptiven Syntax zu klären. Während das erste Kapitel die exemplifizierten Problemfälle der traditionellen Sicht auf Wortarten und Satzgliedfunktionen benennt, betrachtet das zweite Kapitel die Grenzen der präskriptiven Sicht auf die Satzstruktur im Kontext der Linearität der syntaktischen Relationen, der begrifflichen ‚Starrheit‘ und der methodologischen ‚sprachpraxisfernen‘ Schlichtheit. Das dritte Kapitel veranschaulicht die strukturmäßige sowie empirische Herangehensweise an die Probleme der Wortart- und Satzgliedfunktionstheorien durch Konstituentenkategorien, -relationen und Phrasenstrukturgrammatik. Das gleiche Kapitel befasst sich mit dem qualitativ neuen begrifflichen ‚Inventar‘, dem deskriptiv-generativen methodologischen ‚Instrumentarium‘ der K-Syntax (X-bar Theorie, Strukturbaum oder a-Bewegung) und mit der Mehrdimensionalität der syntaktischen Relationen. Das dritte Kapitel diskutiert die syntaktischen Relationen und Konstituenten des Deutschen in einer generativen Logik, bringt die methodologischen Vorteile der deskriptiven Herangehensweise an syntaktische Kategorien zum Vorschein und veranschaulicht somit noch einmal die Limits der traditionellen Sicht auf die Syntax der deutschen Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: DIE LÜCKEN IN DER TRADITIONELLEN AUFFASSUNG DER WORTARTEN UND SATZGLIEDFUNKTIONEN VOR DEM HINTERGRUND DER DESKRIPTIVEN HERANGEHENSWEISE AN DIE SYNTAX
- KAPITEL 1: DIE BESTIMMUNG DER PROBLEME DER NORMATIVEN SICHT AUF DIE DEUTSCHE SYNTAX
- 1.1. Die Wortartentheorie aus dem Blickwinkel der präskriptiven Grammatik
- 1.2. Die Problemfälle der traditionellen Grammatik in Hinsicht auf die Theorie der Satzgliedfunktionen
- KAPITEL 2: DIE GRENZEN DER LINEAREN SICHT AUF DIE WORTARTENTHEORIE UND DIE THEORIE DER SATZGLIEDFUNKTIONEN
- 2.1. Die Einschränkungen der Linearität der traditionellen Syntax bezüglich der Wortartentheorie
- 2.2. Die Limits der linearen Herangehensweise an die Theorie der Satzgliedfunktionen
- KAPITEL 3: DIE ‚K-SYNTAX‘ UND IHR ‚INSTRUMENTARIUM‘ ALS EINE GENERATIV-DESKRIPTIVE LÖSUNG DER PROBLEME DER TRADITIONELLEN SICHT AUF DIE SATZGLIEDFUNKTIONEN UND WORTARTEN
- 3.1. Die ‚Werkzeuge‘ des deskriptiven Models – Konstituententests, Konstituentenstruktur und Konstituenzrelationen – weiten die Grenzen des traditionellen Verstehens der Wörter aus
- 3.2. Die Phrasenstrukturgrammatik, neue Begrifflichkeit und das generativ-deskriptive ‚Inventar‘ der K-Syntax bezüglich der Theorie der Satzgliedfunktionen
- ZUSAMMENFASSUNG: DAS DESKRIPTIV-GENERATIVE MODEL ALS ‚SPIEGEL‘ DER LIMITS UND DISKREPANZEN DER NORMATIVEN SYNTAXAUFFASUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Grenzen der ‚traditionellen Syntaxauffassung‘ der deutschen Sprache aus dem Blickwinkel der deskriptiven Grammatik. Sie analysiert die Problemfälle und Lücken der normativen Grammatik im Bereich der Wortartentheorie und der Satzgliedfunktionen. Ziel ist es, die Stärken des deskriptiv-generativen Modells aufzuzeigen, das eine mehrdimensionale und strukturbasierte Sicht auf die Syntax ermöglicht und so die Grenzen der traditionellen linearen Herangehensweise überwindet.
- Untersuchung der Schwächen der normativen Grammatik im Bereich der Wortartentheorie
- Analyse der Unzulänglichkeiten der traditionellen Sicht auf Satzgliedfunktionen
- Vorstellung des deskriptiv-generativen Modells und seiner ‚Werkzeuge‘
- Demonstration der Stärken der K-Syntax und ihrer generativ-empirischen Methoden
- Veranschaulichung der hierarchischen Struktur der syntaktischen Relationen in der Phrasenstrukturgrammatik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Schwierigkeiten der präskriptiven Grammatik bei der Definition von Wortarten und Satzgliedfunktionen. Es werden konkrete Problemfälle vorgestellt, die die Unzulänglichkeiten der traditionellen Sicht auf die deutsche Syntax verdeutlichen.
Kapitel 2 analysiert die Grenzen der linearen Herangehensweise der normativen Grammatik im Kontext der Wortartentheorie und der Satzgliedfunktionen. Es wird argumentiert, dass die eindimensionale Betrachtung der syntaktischen Relationen die Komplexität des Sprachgebrauchs nicht adäquat widerspiegelt.
Kapitel 3 stellt die ‚K-Syntax‘ und ihr ‚Instrumentarium‘ vor. Es werden die empirischen Methoden der deskriptiven Grammatik erläutert, die eine präzisere und umfassendere Beschreibung der deutschen Syntax ermöglichen. Das Kapitel diskutiert die Konstituentenkategorien, die Phrasenstrukturgrammatik und die Bedeutung der hierarchischen Struktur in der Satzanalyse. Es wird auch auf die neuen Begrifflichkeiten wie ‚X-bar-Theorie‘, Theta-Theorie und Į-Bewegung eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Wortartentheorie, Satzgliedfunktionen, präskriptive Grammatik, deskriptive Grammatik, K-Syntax, Konstituenten, Konstituentenstruktur, Phrasenstrukturgrammatik, hierarchische Struktur, X-bar-Theorie, Theta-Theorie, Į-Bewegung, Universalität der Syntax.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Grenzen der traditionellen Syntaxauffassung?
Die traditionelle Sicht ist oft zu starr und linear, was komplexe syntaktische Relationen und die Mehrdimensionalität der Sprache vernachlässigt.
Was unterscheidet die präskriptive von der deskriptiven Grammatik?
Präskriptive Grammatik gibt Regeln vor (normativ), während deskriptive Grammatik den tatsächlichen Sprachgebrauch und seine Strukturen analysiert.
Was ist die K-Syntax?
Die Konstituenten-Syntax nutzt Instrumente wie die X-Bar-Theorie und Strukturbäume, um die hierarchische Struktur von Sätzen präzise darzustellen.
Was ist die X-Bar-Theorie?
Ein Modell der generativen Grammatik, das davon ausgeht, dass alle Phrasen (nominal, verbal etc.) denselben strukturellen Aufbau besitzen.
Welchen Vorteil bietet die Phrasenstrukturgrammatik?
Sie ermöglicht es, die logischen Verknüpfungen innerhalb eines Satzes jenseits der reinen Wortabfolge (Linearität) zu erklären.
- Citation du texte
- Gabriella Adamsetsch (Auteur), 2017, Die 'traditionelle Syntaxauffassung' der deutschen Sprache. Die Grenzen aus dem Blickwinkel der deskriptiven Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987701