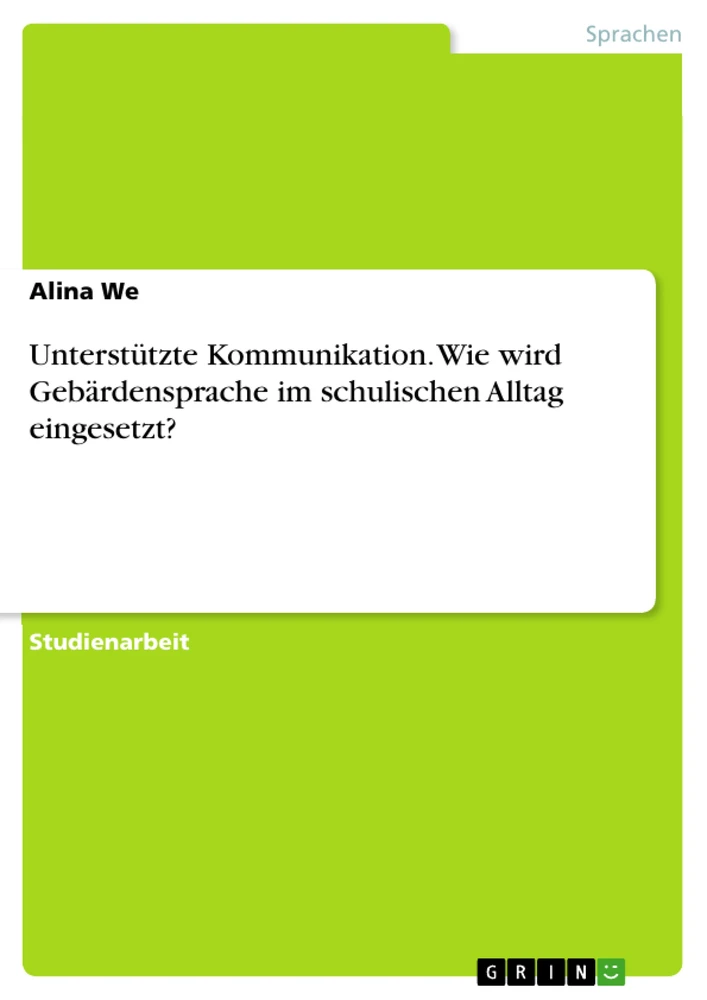Die folgende Fragestellung ist für den Aufbau der Arbeit handlungsleitend: Wie wird Gebärdensprache in den schulischen Alltag mit eingebunden? Es wird ein Überblick über verschiedene Kommunikationshilfsmittel gegeben. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt jedoch auf dem Kommunikationshilfsmittel der Gebärden. Unterstützte Kommunikation ist für Menschen, die nicht sprechen können, das wichtigste Verständigungsmittel. Jedoch sind viele nicht betroffene Menschen über die Unterstützte Kommunikation nicht ausreichend informiert. Dieser Text beleuchtet die Unterstützte Kommunikation von allen Seiten. Die Unterstütze Kommunikation kann den Alltag betroffener Personen und der Menschen in ihrem Umfeld erleichtern. Betroffene Menschen sind nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern oft auch alte Menschen, Flüchtlinge oder Personen, die aus anderen Gründen übergangsweise oder dauerhaft nicht sprechen können oder wollen.
Gebärden sind ein sehr wichtiges Kommunikationshilfsmittel, da diese Sprache fast alle Menschen der Welt lernen können. Außerdem kann Gebärdensprache immer und jederzeit angewendet werden und es sind keine weiteren Hilfsmittel, wie beispielsweise elektronische Geräte nötig, um zu kommunizieren. Allgemein ist zum Verständnis zu sagen, dass Kommunikation in diesem Text auf verbale und nonverbale Interaktion zwischen Menschen zu beziehen ist. Außerdem ist zu sagen, dass sich ausschließlich auf die Entwicklung in Deutschland bezogen wird, da sonst der Umfang dieser Arbeit zu groß wird. Zudem behandelt die vorliegende Arbeit bei der Gebärdensprache und deren Nutzung nur Kindern mit einer geistigen Behinderung im schulischen Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Unterstützte Kommunikation
- 2.1 Entwicklung Unterstützter Kommunikation in Deutschland
- 2.2 Zielgruppe der Unterstützten Kommunikation
- 2.3 Elektronische Kommunikationshilfen
- 2.4 Nicht-elektronische Kommunikationshilfen
- 2.5 Körpereigene Kommunikationsformen
- 2.6 Praktische Anwendung der Unterstützten Kommunikation
- 3. Gebärden
- 3.1 Geschichte der Gebärden
- 4. Unterstützte Kommunikation an integrativen Schulen
- 4.1 Gebärden an einer Schule für geistig Behinderte
- 4.2 Studienergebnisse zum Partizipationserleben hörgeschädigter Kinder an der allgemeinen Schule
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einbindung von Gebärdensprache in den schulischen Alltag. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über Unterstützte Kommunikation (UK) zu geben, mit besonderem Fokus auf Gebärden als Kommunikationsmittel für Kinder mit geistiger Behinderung in Deutschland.
- Unterstützte Kommunikation und ihre verschiedenen Methoden
- Entwicklung und Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation in Deutschland
- Gebärdensprache als Kommunikationsmittel
- Praktische Anwendung von Gebärdensprache in integrativen und Schulen für geistig Behinderte
- Partizipation hörgeschädigter Kinder im schulischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Unterstützte Kommunikation (UK) ein und erläutert die Bedeutung von UK für Menschen ohne oder mit eingeschränkter Lautsprache. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf Gebärdensprache im schulischen Kontext für Kinder mit geistiger Behinderung in Deutschland und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Wie wird Gebärdensprache in den schulischen Alltag mit eingebunden? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die behandelten Themenbereiche.
2. Unterstützte Kommunikation: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Unterstützte Kommunikation. Es definiert den Begriff, beschreibt verschiedene UK-Methoden (elektronische und nicht-elektronische Hilfsmittel, körpereigene Kommunikationsformen) und betont die Bedeutung individueller Anpassung an die Bedürfnisse der betroffenen Person. Die Heterogenität der Zielgruppe wird hervorgehoben, ebenso wie die Wichtigkeit von aktiven Kommunikationserfahrungen für die kindliche Entwicklung. Das Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen alternativer und augmentativer Kommunikation und betont die Rolle der Ich-Form in der UK sowie die Notwendigkeit von Geduld und Achtsamkeit der Kommunikationspartner. Es endet mit der Erwähnung der Grenzen von UK und der Beratungsangebote.
3. Gebärden: Dieses Kapitel widmet sich der Gebärdensprache als spezifische Form der Unterstützten Kommunikation. Es liefert allgemeine Informationen über Gebärden und deren geschichtliche Entwicklung. Obwohl der genaue Inhalt nicht detailliert im Ausgangstext aufgeführt ist, ist zu vermuten, dass dieser Abschnitt den Stellenwert von Gebärdensprache im Kontext der UK vertieft und möglicherweise auf verschiedene Gebärdensprachen und deren Strukturen eingeht. Der Kontext legt nahe, dass der Abschnitt die Grundlage für die Anwendung von Gebärden in der schulischen Praxis bildet.
4. Unterstützte Kommunikation an integrativen Schulen: Das Kapitel beschreibt die praktische Anwendung von Gebärdensprache in schulischen Settings. Es vergleicht die Anwendung an inklusiven Schulen und Schulen für geistig behinderte Kinder. Ein wichtiger Bestandteil ist die Analyse der Studie von Hintermair & Lepold (2010) zum Partizipationserleben hörgeschädigter Kinder in der allgemeinen Schule, die einen Theorie-Praxis-Transfer ermöglicht. Dieses Kapitel verbindet die theoretischen Grundlagen der vorherigen Kapitel mit konkreten Beispielen aus der Praxis und zeigt die Herausforderungen und Chancen der Gebärdensprache im Unterricht.
Schlüsselwörter
Unterstützte Kommunikation, Gebärdensprache, inklusive Bildung, Schule für geistig Behinderte, Kommunikationshilfen, Partizipation, inklusive Pädagogik, Kindliche Entwicklung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Unterstützte Kommunikation und Gebärdensprache in der Schule
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Einbindung von Gebärdensprache in den schulischen Alltag, insbesondere für Kinder mit geistiger Behinderung in Deutschland. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Unterstützte Kommunikation (UK) und konzentriert sich auf Gebärden als Kommunikationsmittel.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Unterstützten Kommunikation, darunter verschiedene Methoden (elektronische und nicht-elektronische Hilfsmittel, körpereigene Kommunikationsformen), die Entwicklung und Zielgruppen von UK in Deutschland, Gebärdensprache als Kommunikationsmittel, die praktische Anwendung von Gebärdensprache in integrativen und Schulen für geistig Behinderte und die Partizipation hörgeschädigter Kinder im schulischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Unterstützte Kommunikation, Gebärden, Unterstützte Kommunikation an integrativen Schulen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Unterstützten Kommunikation und der Gebärdensprache im schulischen Kontext.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über Unterstützte Kommunikation (UK) zu geben, mit besonderem Fokus auf Gebärden als Kommunikationsmittel für Kinder mit geistiger Behinderung in Deutschland. Die Arbeit untersucht, wie Gebärdensprache in den schulischen Alltag eingebunden wird.
Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Unterstützten Kommunikation, darunter elektronische und nicht-elektronische Kommunikationshilfen sowie körpereigene Kommunikationsformen. Die Bedeutung der individuellen Anpassung an die Bedürfnisse der betroffenen Person wird hervorgehoben.
Wie wird die Gebärdensprache in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit widmet sich der Gebärdensprache als spezifische Form der Unterstützten Kommunikation. Sie liefert allgemeine Informationen über Gebärden und deren geschichtliche Entwicklung und untersucht deren Anwendung in integrativen Schulen und Schulen für geistig Behinderte.
Welche Rolle spielt die Studie von Hintermair & Lepold (2010)?
Die Studie von Hintermair & Lepold (2010) zum Partizipationserleben hörgeschädigter Kinder in der allgemeinen Schule wird analysiert, um einen Theorie-Praxis-Transfer zu ermöglichen und die Herausforderungen und Chancen der Gebärdensprache im Unterricht aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Unterstützte Kommunikation, Gebärdensprache, inklusive Bildung, Schule für geistig Behinderte, Kommunikationshilfen, Partizipation, inklusive Pädagogik, kindliche Entwicklung, Deutschland.
Welche zentrale Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wird Gebärdensprache in den schulischen Alltag mit eingebunden?
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Therapeuten, Studenten der Sonderpädagogik und alle, die sich mit Unterstützter Kommunikation und inklusiver Bildung auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Alina We (Autor), 2019, Unterstützte Kommunikation. Wie wird Gebärdensprache im schulischen Alltag eingesetzt?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/986837