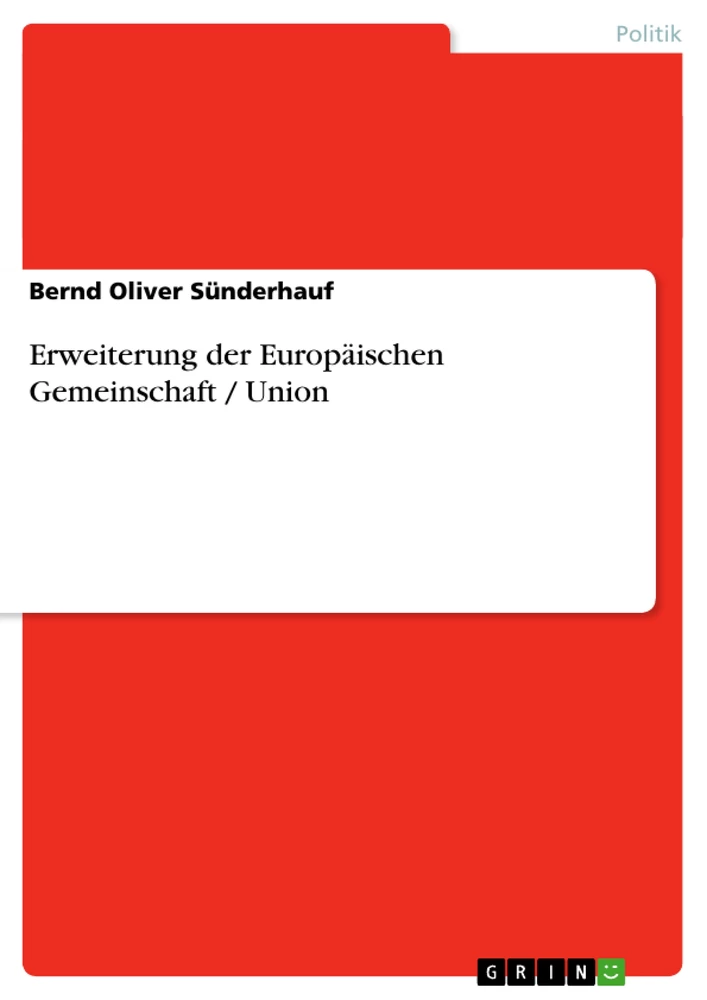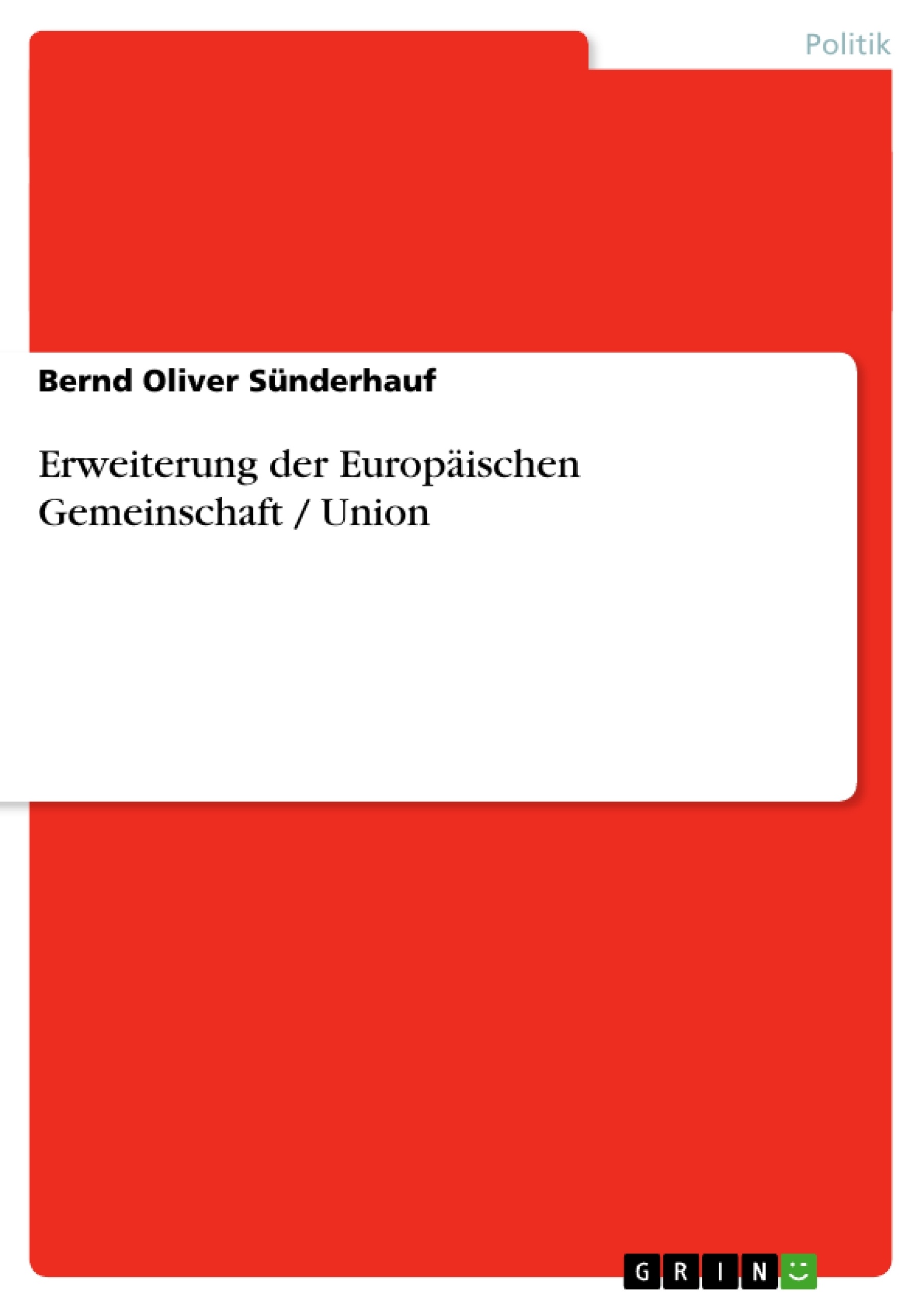1. Allgemeines und Vorgeschichte
1.1. Das wachsende Europa
1.1.1. Beitrittsrunden bis 1995
- 1. Beitrittswelle 1973: Irland, Großbritannien, Dänemark
- 2. Beitrittswelle 1981: Griechenland
- 3. Beitrittswelle 1986: Portugal, Spanien
- 4. Beitrittswelle 1995: Österreich, Schweden, Finnland
1.1.2. Offene Beitrittsanträge
- Türkei (1987): im November 1999 in erweiterten Bewerberkreis aufgenommen, Verhandlungsbeginn offen.
- Malta (1990): Beitrittsverhandlungen 2000 aufgenommen
- Zypern (1990): Beitrittsverhandlungen 2000 aufgenommen
1.2. Europa nach dem Ende des Kalten Kriegs: Die Mittel- und Osteuropäischen Staaten (MOES)
- Öffnung der ehemalig kommunistischen Länder Mittel- und Osteuropas → Rückorientierung nach Europa
- Breite Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten zu den Entwicklungen → Bündelung der Zusammenarbeit bei der Europäischen Kommission, Mandat für weitreichende vis-à-vis-Verhandlungen
1.2.1. Erste Abkommen: die TCAs (,Trade and Cooperation Agreement’)
- Erste Schritte zum Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen zu Staaten des Warschauer Paktes.
- Erstes TCA bereits 1988 mit Ungarn.
1.2.2. Phare-Programm (.Pologne-Hongrie Assistance à la Restructuration des Économies’)
- Umfassendes Konsultationsprogramm der Kommission, zunächst insbes. für wirtschaftliche T ransformation.
- Ab 1992 auf Druck des EP auch für demokratische Entwicklung.
- Asymmetrische Zusammenarbeit zunehmend ineffizient.
1.2.3. Europa-Abkommen
- Im Wesentlichen schrittweise Schaffung einer Freihandelszone zwischen EU und MOES.
- Asymmetrische Beseitigung der Handelshemmnisse: zunächst für Exporte in EU, später für Importe aus EU.
- Abgestufte Übergangszeiträume: von Estland (Freihandel in Kraft seit 1995) bis hin zu 10 Jahren.
- Sonderregelungen für sensible Bereiche wie Landwirtschaft, Kohle und Stahl → Großteil der Exporte beschränkt
- Verpflichtung zu politischem Dialog und demokratischer Entwicklung
- Nicht verbunden mit einer Aussicht auf EU-Mitgliedschaft → Schwere Enttäuschung der MOES.
1.2.4. Kopenhagener Kurswechsel
Definition der Kopenhagener Kriterien für Beitrittsländer als Einladung an MOES zum EU-Beitritt → Beitrittsanträge der MOES:
- Ungarn, Polen, Rumänien (1994)
- Slowakische Republik, Lettland, Estland, Litauen, Bulgarien (1995)
- Tschechische Republik, Slowenien (1996)
2. EU-Osterweiterung aus der Sicht der Beitrittskandidaten
2.1. Aufnahmeverfahren
2.1.1. Kopenhagener Kriterien
- Stabilität der Demokratie und ihrer Institutionen
- Eine funktionierende Marktwirtschaft, die dem Wettbewerbsdruck standhält
- Übernahme der europäischen Gesetzgebung
- Einverständnis mit den Zielen der Politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
- Fähigkeit der EU zur Aufnahme neuer Mitglieder, ohne an Integrationsdynamik zu verlieren
2.1.2. Weitere Pflichtkriterien
- Übernahme der EU-Verträge
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
- Unabhängigkeit der Zentralbank
- Aufbau neuer administrativer Strukturen für die Umsetzung der EU-Gesetzgebung
2.1.3. Unterstützung von Seiten der EU und Kontrollmechanismen
- Die Heranführungsstrategie
- Das Prüfungsverfahren - regelmäßige Berichte
- Das Screening des Aquis Communautaire
- Beitrittspartnerschaften
- Vorbeitrittshilfe
2.1.4. Aktueller Stand der Verhandlungen und Erfüllung der Kriterien
- Verhandlungen in zwei Beitrittswellen begonnen, inzwischen gilt Prinzip des individuellen Fortschritts
- Schrittweise Eröffnung von 31 Verhandlungskapiteln, zum Teil bereits abgeschlossen
- Aufnahme der ersten Vorreiter zwischen 2003 (Planung EU) und 2005 (Erwartungen der Kandidaten)
2.1.5. Risiken des EU-Beitritts für Kandidaten
- Industrielle Wettbewerbsfähigkeit der MOE-Staaten gering - große Investitionen der EU in den Modernisierungsprozess notwendig
- Überschwemmung der MOE-Staaten mit den Gütern aus der restlichen EU (durch Subventionen günstigere Preise) - eigene Produkte finden keinen Absatzmarkt mehr (z. B. landwirtschaftliche Erzeugnisse)
2.2. Case Study: Estland
3. EU-Osterweiterung aus der Sicht der EU-Mitgliedsländer
3.1. Chancen und Risiken der Erweiterung für Deutschland und die EU
3.1.1. Stärkung des Wirtschaftsraumes gegenüber anderen Regionen der Welt
- In vielen Regionen der Welt entstehen Wirtschaftsräume: NAFTA, Mercosur, ASEAN-AFTA, Comesa (s Abb. 1)
- Erweiterung erhöht wirtschaftliches Volumen des Gemeinsamen Marktes und schafft neue Märkte mit Nachholbedarf.
- Einbindung von Niedriglohnländern „vor der Haustür“ stärkt langfristig Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie durch Spezialisierung und Ausgliederung (vgl. Mexiko in der NAFTA)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Wirtschaftsräume im Entstehen
3.1.2. Verschiebung des Schwerpunkts gen Osten
- Einbeziehung „natürlicher“ Handelspartner Deutschlands in den gemeinsamen Markt
- Zu erwartende gegenseitige Interessenpartnerschaft der MOES und Deutschlands
- Sprachrohr- und Koordinationsfunktion Deutschlands → Machtzuwachs
3.1.3. Stabilisierung Mittel- und Osteuropas
- Überwindung der ehemaligen Blockgrenze
- Risiko der Abschottung der MOES und aufkeimenden Nationalismus
3.1.4. Heterogenisierung der EU
- Beitritt wirtschaftlich und in politischer Kultur rückständiger und instabiler Staaten
- Gefährdung der langjährigen Kooperation und Kohäsion
- Ohne Flexibilisierungskonzepte weitere Integrationsschritte in absehbarer Zeit nicht zu erwarten
3.1.5. Institutionelle Handlungsunfähigkeit
- Einstimmigkeitsentscheidungen in intergouvernementalen Bereichen → Interessenblockaden
- Massive Vergrößerung aller Institutionen
- Über 20 Amtssprachen (statt heute 11) → Aufblähung des Dolmetscher- und Übersetzerapparates
3.1.6. Zuwanderung aus den neuen Mitgliedsländern
- Unionsbürgerschaft → Freizügigkeit in Bezug auf Wohnsitz und Arbeitsplatz
- Mögliche Massenauswanderung von Arbeitskräften in den Westen
3.2. Erweiterung oder Vertiefung?
3.2.1. Erweiterung und Vertiefung?
- Doppelbelastung und schwieriger Abstimmungsprozess aufgrund gegenseitiger Beeinflussung.
- Setzt Flexibilisierung der Abstimmungsverfahren voraus.
3.2.1. Kern-Europa als Avantgarde?
Vieldiskutierter Vorschlag der abgestuften Integration. Beispielszenario (siehe Abb. 2):
- Deutschland, Frankreich und Benelux bilden gemeinsamen föderalen Staat („Vereinigte Staaten von Europa“)
- 11 Staaten bilden die „Eurozone“.
- EU-15 (status quo) intensiviert ihre gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik („GASP plus“)
- EU-30 verbleibt beim heutigen Integrationsstand („EU“)
Probleme der abgestuften Integration:
- Mit zunehmender Differenzierung wächst rechtliche und institutionelle Heterogenität
- Institutionen wie EP oder Europäische Kommission müssten bei Einbeziehung in supranationalen Bereich gedoppelt oder ebenfalls abgestuft werden
- Nehmen an weiteren Integrationsschritten unterschiedliche Konfigurationen von Mitgliedsländern teil („Europa à la carte“), so zerfällt das Gesamtgebilde EU in zahlreiche multilaterale Teilabkommen (siehe Abb. 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Europa des institutionellen Chaos
3.3. Bis wohin reicht Europa?
3.3.1. Nordafrikanische Mittelmeeranrainer
- Mittelmeer traditionell Bindeglied, nicht Grenze zwischen Europa und Afrika.
- Besondere Beziehungen Frankreichs mit dem Maghreb, Italiens und Maltas mit Libyen.
- Intensive Handelsbeziehungen aller Mittelmeerstaaten der EU mit Nordafrika.
- Interesse an EU-Mitgliedschaft nach Annäherung an Türkei neu erwacht (Bsp. Ägypten).
3.3.2. Nachbarstaaten der künftigen Mitgliedsländer
- Russland, Weißrussland, Ukraine, Georgien
- Uralgrenze Europas untauglich für politische Selbstdefinition Europas
3.3.3. Sonder- und Problemfall Türkei
- Beitrittsgesuch bereits 1987, jedoch erst 1999 nach langen (wenngleich ergebnislosen) Diskussionen als potentieller Beitrittskandidat anerkannt.
- Distanz aufgrund der Menschenrechte, kultureller Unterschiede oder geostrategischer Erwägungen?
- Brücke - oder offene Flanke - zu Arabischer Welt, Iran, Kaukasus, Turkvölker am Kaspischen Meer
- Bevölkerungsreicher Staat mit knapp 60 Mill. Einwohnern und hohem Bevölkerungswachstum
- Langjähriges NATO-Mitglied und strategischer „Außenposten“ der USA
4. Fazit
Die EU-Osterweiterung ist notwendig und unumkehrbar.
- Wesentlich für Stabilität Osteuropas
- Orientierung, Ziel und Definierung für MOES
- Europa wächst an der Herausforderung
- Europa hat die Chance, eine selbstbewusstere, eigenständigere Rolle in der Welt zu spielen.
5. Kontroverse Thesen zur Diskussion
5.1. Europa muss sich selbst definieren.
- Europa muss wissen, was Europa ausmacht und von anderen Regionen unterscheidet.
- Die EU muss die Kontrolle über ihre Erweiterung übernehmen und nur „erwünschte“ Länder „einladen“.
- Europa muss auf der Basis strategischer Interessen seine Außengrenzen festlegen.
5.2. Das Fernziel ist die Gründung eines europäischen Bundesstaates.
- Solange kein Endpunkt gesetzt ist, wird die Integration immer weitergehen.
- Ein Europa der Regionen kann den Nationalstaat als identitätsstiftendes Moment ablösen.
- Früher oder später wird es ein Europa erster und zweiter Klasse geben.
5.3. Europa muss sich als weltpolitische Großmacht etablieren.
- Die Weltordnung benötigt neben der einzig verbliebenen Weltmacht USA einen ebenbürtigen Gegenpart.
- Europa kann auf lange Sicht eine friedenschaffende, verbindende und wertstiftende Rolle in der Welt spielen.
- Schon heute könnte die EU selbstbewusstere außenpolitische Akzente setzen.
6. Literatur
- Amato, Giuliano und Judy Batt, 1999: „The Long-Term Implications of EU Enlargement: The Nature of The New Border. Final Report of the Reflection Group”, Internet: [http://www.iue.it/RSC7pdf/FinalReport.pdf], Stand: 05.11.2000.
- Deutscher Industrie- und Handelstag, (Hrsg.), 2000: „Europa 2000 plus. DIHT-Positionspapier zur Regierungskonferenz 2000 und zur Erweiterung der Europäischen Union“, Internet: [http://www.diht.de/inhalt/themen/international/epolitik/downloads/europa2000.doc], Stand: 03.11.2000.
- Bertrand, Gilles, Anna Michalskí und Lucio R. Pench (Hrsg.), 1999: „Szenarien Europa 2010. Fünf Bilder von der Zukunft Europas“, Arbeitspapier, Internet: [http://europa.eu.int/comm/cdp/scenario/scenarios_de.pdf], Stand: 01.11.2000.
- Europäische Kommission (Hrsg.) 2000: „Die EU-Erweiterung. Eine historische Gelegenheit“, Internet: [http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/publications/corpus_de.pdf], Stand: 05.11.2000.
- Europäische Kommission (Hrsg.), 2000a: „Beitrittspartnerschaft Estland: Jahresbericht 1999“, 2000. Internet: [http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/index.htm], Stand: 03.11.2000.
- Europäischer Rat (Hrsg.), 2000: „Schlussfolgerungen des Vorsitzes - Europäischer Rat (Santa Maria da Feira) - 19. und 20. Juni 2000“, Internet: [http://europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/june2000_de.pdf], Stand: 05.11.2000.
- Europäisches Parlament (Hrsg.), 2000: „Task Force Enlargement, Statistical Annex“, 9. aktualisierte Version (Oktober 2000), Internet: [http://www.europarl.eu.int/enlargement/briefings/pdf/22a1_en.pdf], Stand: 05.11.2000.
- Iwanow, Igor S., 2000: “Neue Prioritäten russischer Außenpolitik“ in Internationale Politik, 8/2000, 65-70.
- Jansen, Thomas, 1999: „Die Erweiterung der Europäischen Union, die Reform der Institutionen und die Verfassungsfrage“ in Peter Wittschorek, Hrsg.:„Agenda 2000: Herausforderungen an die Europäische Union und an Deutschland“, Baden-Baden: Nomos, 1999.
- Jansen, Thomas (Hrsg.), 1999: “Reflections on European Identity”, Arbeitspapier der Gruppe für Prospektive Analysen der Europäischen Kommission, Internet: [http://europa.eu.int/comm/cdp/working-paper/european_identity_en.pdf], Stand: 05.11.2000.
- Mintchev, Emil, 2000: “Europa und die Probleme des Balkans. Ein Jahr Stabilitätspakt für Südosteuropa“ in Internationale Politik, 8/2000, 53-58.
- Pernice, Ingolf, 2000: “Die Notwendigkeit institutioneller Reformen. Aussichten für die Regierungskonferenz“ in Internationale Politik, 8/2000, 11-20.
- Pflüger, Friedbert, 2000: “Visionen genügen nicht. Eine Antwort auf Joschka Fischer“ in Internationale Politik, 8/2000, 21-22.
- Sedelmeier, Ulrich und Helen Wallace: „Eastern Enlargement. Strategy or Second Thoughts?“ in Helen Wallace und William Wallace (Hrsg.), 2000: “Policy making in the European Union”, 4. Auflage, Oxford, 427-460.
- Weidenfeld, Werner, 2000: „Erweiterung ohne Ende? Europa als Stabilitätsraum strukturieren“ in Internationale Politik, 8/2000, 1-10.
- Weidenfeld, Werner und Wolfgang Wessels (Hrsg.), 1997: „Europa von A - Z. Taschenbuch der europäischen Integration”, 6. Aufl., Bonn: Europa Union Verlag, 1997.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Beitrittswellen der EU bis 1995?
Die Beitrittswellen waren: 1973 (Irland, Großbritannien, Dänemark), 1981 (Griechenland), 1986 (Portugal, Spanien) und 1995 (Österreich, Schweden, Finnland).
Welche Länder hatten offene Beitrittsanträge?
Die Türkei (Antrag 1987), Malta (Antrag 1990) und Zypern (Antrag 1990).
Was geschah nach dem Ende des Kalten Krieges mit den mittel- und osteuropäischen Staaten (MOES)?
Es erfolgte eine Rückorientierung nach Europa, was zu einer breiten Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten und einer Bündelung der Zusammenarbeit bei der Europäischen Kommission führte.
Was waren die TCAs (,Trade and Cooperation Agreement’)?
Die TCAs waren erste Abkommen zum Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen zu Staaten des Warschauer Paktes, beginnend mit Ungarn im Jahr 1988.
Was war das Phare-Programm (.Pologne-Hongrie Assistance à la Restructuration des Économies’)?
Ein umfassendes Konsultationsprogramm der Kommission, ursprünglich für wirtschaftliche Transformation, später auch für demokratische Entwicklung. Es erwies sich als zunehmend ineffizient.
Was beinhalteten die Europa-Abkommen?
Im Wesentlichen die schrittweise Schaffung einer Freihandelszone zwischen der EU und den MOES, mit asymmetrischer Beseitigung der Handelshemmnisse und abgestuften Übergangszeiträumen. Sie waren jedoch nicht mit einer Aussicht auf EU-Mitgliedschaft verbunden.
Was war der Kopenhagener Kurswechsel?
Die Definition der Kopenhagener Kriterien für Beitrittsländer als Einladung an MOES zum EU-Beitritt, was zu Beitrittsanträgen verschiedener MOES führte.
Welche Kriterien wurden in den Kopenhagener Kriterien festgelegt?
Stabilität der Demokratie und ihrer Institutionen, eine funktionierende Marktwirtschaft, Übernahme der europäischen Gesetzgebung, Einverständnis mit den Zielen der Politischen Union und der WWU, sowie die Fähigkeit der EU zur Aufnahme neuer Mitglieder.
Welche weiteren Pflichtkriterien gab es für Beitrittskandidaten?
Übernahme der EU-Verträge, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Unabhängigkeit der Zentralbank und Aufbau neuer administrativer Strukturen für die Umsetzung der EU-Gesetzgebung.
Welche Unterstützung erhielten die Kandidaten von Seiten der EU und welche Kontrollmechanismen gab es?
Die Heranführungsstrategie, das Prüfungsverfahren (regelmäßige Berichte), das Screening des Aquis Communautaire, Beitrittspartnerschaften und Vorbeitrittshilfe.
Wie war der aktuelle Stand der Verhandlungen und die Erfüllung der Kriterien?
Verhandlungen in zwei Beitrittswellen, Prinzip des individuellen Fortschritts, schrittweise Eröffnung von 31 Verhandlungskapiteln, und die Erwartung der Aufnahme der ersten Vorreiter zwischen 2003 und 2005.
Welche Risiken barg der EU-Beitritt für Kandidaten?
Geringe industrielle Wettbewerbsfähigkeit, große Investitionen der EU in den Modernisierungsprozess erforderlich, Überschwemmung der MOE-Staaten mit Gütern aus der restlichen EU.
Welche Chancen und Risiken der Erweiterung für Deutschland und die EU gab es?
Stärkung des Wirtschaftsraumes, Verschiebung des Schwerpunkts gen Osten, Stabilisierung Mittel- und Osteuropas, Heterogenisierung der EU, institutionelle Handlungsunfähigkeit und Zuwanderung aus den neuen Mitgliedsländern.
Was ist der Unterschied zwischen Erweiterung und Vertiefung?
Erweiterung bezeichnet die Aufnahme neuer Mitglieder, Vertiefung die Intensivierung der Integration. Beide beeinflussen sich gegenseitig und erfordern Flexibilisierung der Abstimmungsverfahren.
Was versteht man unter einem Kern-Europa als Avantgarde?
Ein Vorschlag der abgestuften Integration, bei dem z.B. Deutschland, Frankreich und Benelux einen föderalen Staat bilden und andere Gruppierungen unterschiedliche Integrationsgrade aufweisen. Dies birgt jedoch Probleme der rechtlichen und institutionellen Heterogenität.
Bis wohin reicht Europa?
Die Frage der geografischen Grenzen Europas ist komplex, insbesondere in Bezug auf Nordafrikanische Mittelmeeranrainer, Nachbarstaaten der künftigen Mitgliedsländer und den Sonderfall Türkei.
Was sind die kontroversen Thesen zur Diskussion bezüglich der EU?
Europa muss sich selbst definieren, das Fernziel ist die Gründung eines europäischen Bundesstaates und Europa muss sich als weltpolitische Großmacht etablieren.
- Quote paper
- Bernd Oliver Sünderhauf (Author), 2000, Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft / Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98607