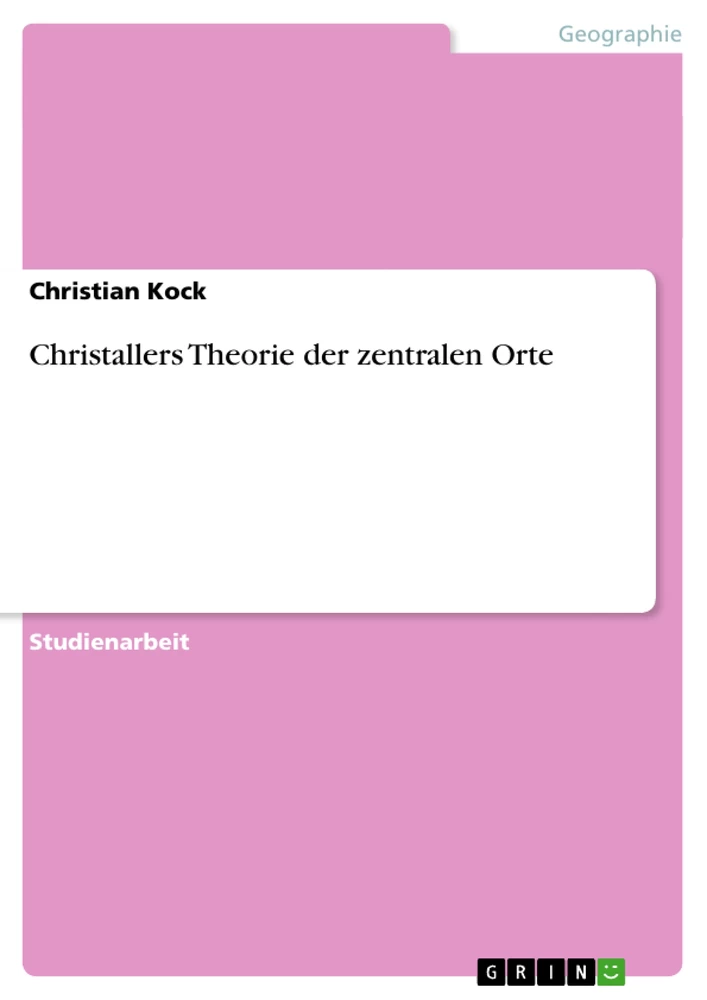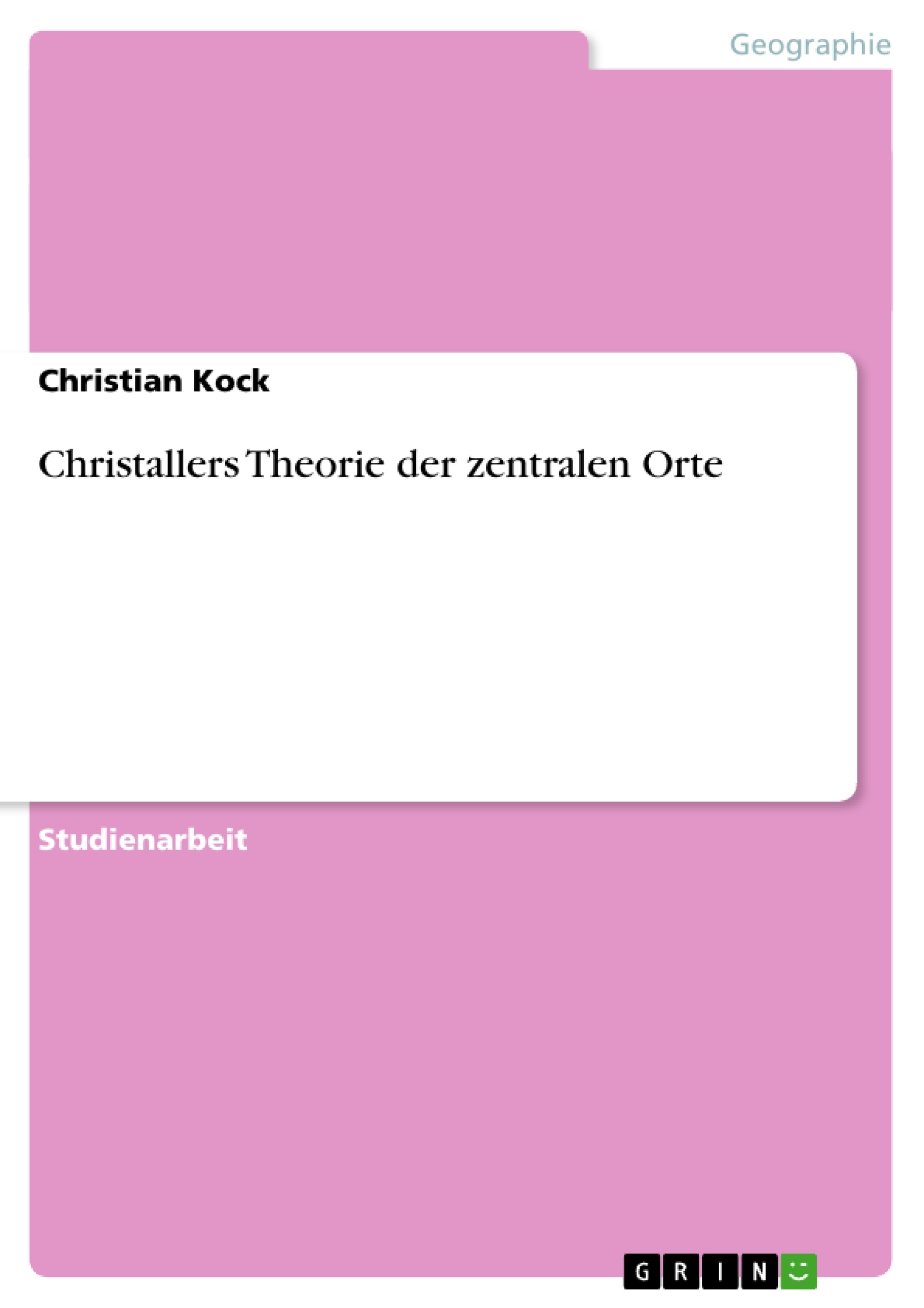1. Aufgaben
Als Christaller 1933 seine klassische Theorie der zentralen Orte entwickelte, wurde erstmals ein hierarchisches Organisationsmodell bei der Erforschung städtischer Systeme angewandt. Hierbei wird der Raum auf Gesetzmäßigkeiten für die Verteilung und Lage der Städte, sowie der funktionalen Beziehungen zwischen Stadt und Umland hin untersucht. Die Theorie basiert auf der Überlegung, daß Güter und Dienste nicht in gleicher Weise und Häufigkeit von den Bewohnern eines Raumes in Anspruch genommnen werden. Dieses wird auch als ,,konsumorientierte Standorttheorie des 3. Sektors" bezeichnet.
2. Voraussetzungen
Damit dieses Modell funktioniert, man also Regelhaftigkeiten erfassen und erklären kann, setzt man eine unbegrenzte, homogene Fläche mit gleichmäßiger Bevölkerungsdichte, sowie gleichmäßiger Verteilung der Kaufkraft voraus. Die Betriebe erwirtschaften keine überproportionalen Gewinne (externe Ersparnisse oder excess profit) und höherrangige Orte stellen alle Güter und Dienstleistungen den niederrangigen bereit, so daß ein größerer Ort nicht von einem kleineren bedient wird. Desweiteren werden nur ubiquitäre (d.h. überall vorkommende) Rohstoffe zur Produktion verwand und Zwischenprodukte werden gänzlich vernachlässigt. Das Transportsystem ist im ganzen Raum ausgebreitet und die Transportkosten sind die einzige Variable. Zu so einem idealisierten Raum gehört natürlich auch ein idealisierter Mensch, der sog. ,,homo oeconomicus", der wirtschaftlich völlig rational handelt und mit vollkommener Konkurrenz und Information lebt. Der als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, die optimale Gewinnmaximierung und als Konsument, die optimale Minimierung der Ausgaben erreicht. In dem Raum bleibt kein Gebietsteil unterversorgt, weil eine minimale Anzahl zentraler Orte optimal veteilt ist. Ebenso ist immer eine Mindestanzahl an Kunden gegeben, um die wirtschaftliche Sicherung der zentralen Einrichtungen zu gewährleisten.
3. Ergebnisse und Thesen
Es kam zu einer Unterscheidung nach Gütern und Dienstleistungen des
- täglichen (kurzfristigen) Bedarfs, z.B. Lebensmittel,
- periodischen (mittelfristigen) Bedarfs, z.B. Kleidung, und des
- episodischen (langfristigen) Bedarfs, z.B. Möbel.
Der Bedeutungsüberschuß einer Siedlung ist hier das Zentralitätsmerkmal, wobei es auch zu einer Hierarchisierung der zentralen Orte kommt, einer Abstufung der Funktionen der Städte, je nach Größe der Ergänzungsgebiete.
Je seltener ein Gut oder eine Dienstleistung benötigt wird, desto größer muß das Absatzgebiet, die untere Reichweite, sein, damit es sich wirtschaftlich rentiert. Je größer die untere Reichweite und je größer die Zahl der angebotenen Güter, desto größer ist die Zentralität des Ortes.
4. Hexagonalmodell
Quelle: Schätzl, Ludwig: Wirtschaftsgeographie. 1. Teil: Theorie. Paderborn. 1988
Die Sechseckgestalt des Modells der zentralen Orte ergibt sich aus der Verteilung der Städte und ihrer Lage zueinander auf allen Stufen der Hierarchie. Durch die Annahme der regelmäßigen Anordnung der zentralen Orte, also gleiche Abstände zu den Nachbarorten, ergeben sich Kreise als theoretisch günstigste Form, mit den zentralen Orten als Mittelpunkt. Dadurch sind unversorgte Gebiete oder Überschneidungen aber zwangsläufig, weswegen die regelmäßigen Sechsecke zur Begrenzung der Reichweite genommen wurden.
5. Kritik
Man muß natürlich sehen, daß Christallers Vorstellungen vom Raum und seinen Bedingungen viel zu eingeschränkt und realitätsfremd sind. Ebenso ist die Verteilung der zentralen Orte in Deutschland eher durch Zufall als durch Planung entstanden, so konnten sich z.B. Orte an einer günstigen geographischen Lage günstiger entwickeln als andere Orte an weniger günstigen Lagen, was auch in keiner Weise Christallers Modell entspricht. Die Entfernungen müssen wegen der Verfügbarkeit von PKW neu bewertet werden, dadurch auch die Fahrtkosten bezogen auf ein zentrales Gut, die nun nicht mehr bestimmend sind. Niederrangigen zentralen Orten wird Kaufkraft zugunsten höherrangiger entzogen. Ebenso richten sich die Konsumenten auf mehrere Zentren, bzw. zentrale Orte unterschiedlicher Rangstufe aus, was auch ,,Variabilität der Zentrenbezogenheit" genannt wird. Desweiteren wird das Image eines Zentrums bei Christaller nicht berücksichtigt.
Quellenverzeichnis:
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Christallers Theorie der zentralen Orte?
Christallers Theorie, entwickelt 1933, ist ein hierarchisches Organisationsmodell zur Erforschung städtischer Systeme. Es untersucht Gesetzmäßigkeiten in der Verteilung und Lage von Städten sowie die funktionalen Beziehungen zwischen Stadt und Umland. Die Theorie basiert auf der Annahme, dass Güter und Dienstleistungen unterschiedlich häufig von den Bewohnern eines Raumes beansprucht werden.
Welche Voraussetzungen müssen für Christallers Modell erfüllt sein?
Das Modell setzt eine unbegrenzte, homogene Fläche mit gleichmäßiger Bevölkerungsdichte und Kaufkraftverteilung voraus. Betriebe dürfen keine überproportionalen Gewinne erzielen, und höherrangige Orte müssen alle Güter und Dienstleistungen für niederrangige Orte bereitstellen. Zudem werden nur ubiquitäre Rohstoffe verwendet, Zwischenprodukte vernachlässigt, und die Transportkosten sind die einzige Variable im gesamten Raum. Der "homo oeconomicus" handelt rational und lebt mit vollkommener Konkurrenz und Information.
Welche Arten von Gütern und Dienstleistungen werden unterschieden?
Es wird unterschieden nach Gütern und Dienstleistungen des täglichen (kurzfristigen) Bedarfs (z.B. Lebensmittel), des periodischen (mittelfristigen) Bedarfs (z.B. Kleidung) und des episodischen (langfristigen) Bedarfs (z.B. Möbel).
Was ist das Zentralitätsmerkmal einer Siedlung laut Christaller?
Der Bedeutungsüberschuss einer Siedlung ist das Zentralitätsmerkmal. Es kommt zu einer Hierarchisierung der zentralen Orte, einer Abstufung der Funktionen der Städte, je nach Größe der Ergänzungsgebiete.
Wie ist die Beziehung zwischen der Häufigkeit der Nachfrage nach einem Gut und der Größe des Absatzgebiets?
Je seltener ein Gut oder eine Dienstleistung benötigt wird, desto größer muss das Absatzgebiet sein (die untere Reichweite), damit es sich wirtschaftlich rentiert. Je größer die untere Reichweite und die Zahl der angebotenen Güter, desto größer ist die Zentralität des Ortes.
Warum ist das Modell der zentralen Orte sechseckig?
Die Sechseckgestalt ergibt sich aus der Verteilung der Städte und ihrer Lage zueinander auf allen Stufen der Hierarchie. Die Annahme regelmäßiger Anordnung der Orte führt theoretisch zu Kreisen als günstigster Form, aber um unversorgte Gebiete oder Überschneidungen zu vermeiden, werden stattdessen Sechsecke zur Begrenzung der Reichweite verwendet.
Welche Kritik wird an Christallers Theorie geübt?
Christallers Vorstellungen sind zu eingeschränkt und realitätsfremd. Die Verteilung der zentralen Orte in Deutschland ist eher zufällig als geplant. Günstige geographische Lagen begünstigen die Entwicklung mancher Orte stärker als andere. Die Verfügbarkeit von PKW hat die Bedeutung der Entfernungen und Fahrtkosten verändert. Niederrangigen Orten wird Kaufkraft zugunsten höherrangiger entzogen, und Konsumenten orientieren sich an mehreren Zentren unterschiedlicher Rangstufe. Das Image eines Zentrums wird nicht berücksichtigt.
Welche Quellen werden im Text genannt?
Die genannten Quellen sind:
- Hofmeister, Burkhard: Stadtgeographie. Braunschweig 1980 = Das Geographische Seminar
- Schätzl, Ludwig: Wirtschaftsgeographie. 1.Teil: Theorie. Paderborn 1988
- Quote paper
- Christian Kock (Author), 1997, Christallers Theorie der zentralen Orte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98602