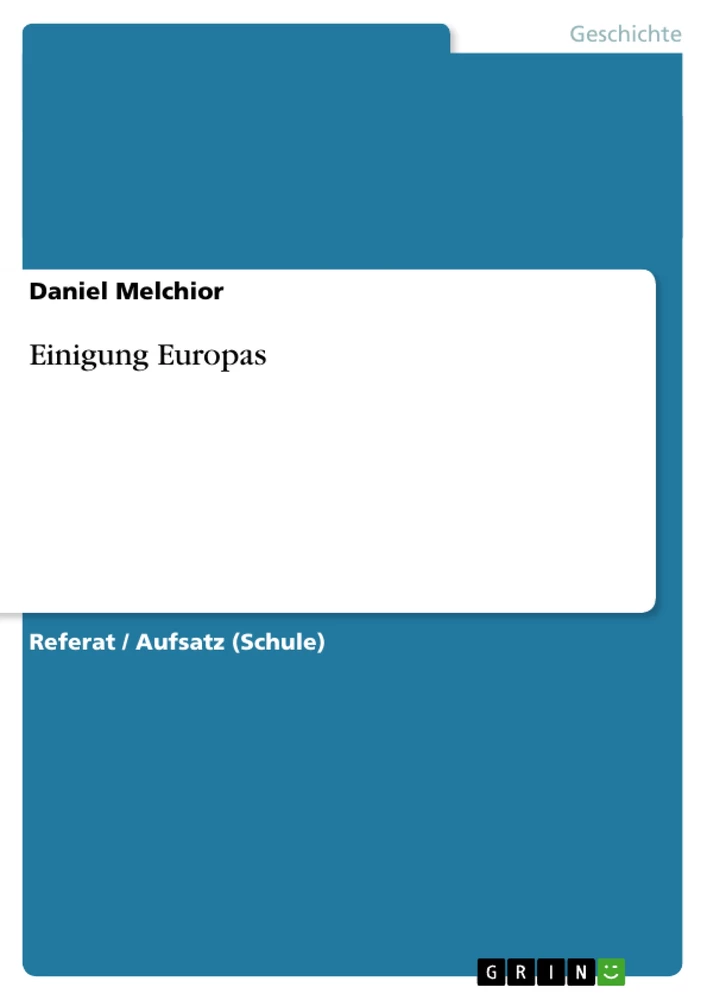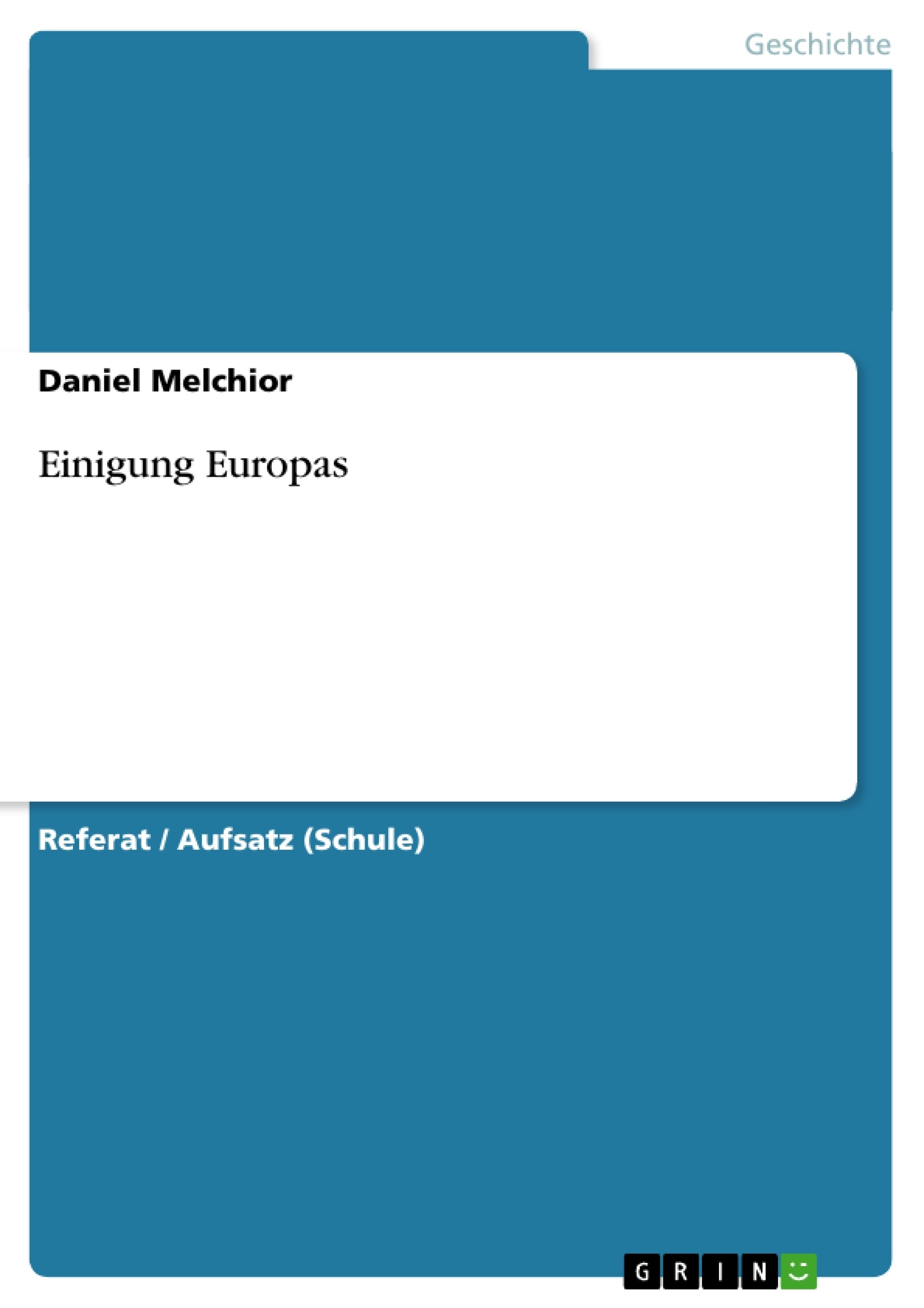Referat in Geschichte über die Einigung Europas
Ausgearbeitet von Daniel Melchior
Die Idee eines übergreifenden, in wirtschaftlich und politischem Sinne, Europas, hatten schon frühere Staatsmänner (z.B. Aristide Briand). Doch diese Überlegungen wurden nicht ausgearbeitet, sondern aufgrund der Rivalitäten der einzelnen Staaten und der Angst vor Souveränitätsverlust wieder beigelegt. Aber wenn die europäische Bevölkerung eine bessere Zukunft erleben wollte, mussten die Länder zusammenarbeiten um einen politischen wie wirtschaftlichen Aufschwung erleben zu können.
Nach dem 2. Weltkrieg nahmen die Bedenken der westeuropäischen Staaten ab, da man mit den USA einen gemeinsamen Kontrahenten hatte, die Sowjetunion. Schließlich schlossen sich 1948 die Benelux-Staaten, Frankreich und GB im Brüsseler Vertrag zu einem militärischen Beistandspakt zusammen, was später die ,,Westeuropäische Union" darstellte, als Schutz vor der wiederaufstrebenden deutschen Kraft. Doch die nationalsozialistische Vergangenheit Deutschlands trat schnell in den Hintergrund, da die westlichen Staaten alle ein gemeinsames Ziel hatten. Die USA unterstützte beispielsweise alle Länder, die eine liberale Wirtschaftspolitik ausübten und ihre Handelsschranken abbauten (sog. Marshallplan). Stalin, der nach seiner sozialistischen Einstellung nach, dem Marshallplan widersagte, verbot allen Staaten unter derzeitigem sowjetischem Einfluss die Teilnahme an einem solchen Plan.
Am 18. April 1951 wurde dann aus der Initiative der Franzosen und Deutschen heraus die Gründung der EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) beschlossen. Auch andere Länder (Benelux-Staaten, Niederlande, Italien) wurden zum Beitritt animiert. Der Vertrag trat dann am 23. Juli 1952 in Kraft. Diese 6 Staaten stellten auch die Gründerstaaten der ersten vertraglich gesicherten europäischen Zusammenarbeit dar. Damit war der erste Schritt getan und ein gemeinsamer Markt geschaffen. So wurde eine Kommission und eine Aufsichtsbehörde geschaffen, die weitreichende Kompetenzen besaß. Diese Unternehmungen beruhten natürlich auf Souveränitätsverlust der einzelnen Staaten.
Nach den ersten Erfolgen mit dem ersten Bündnis wurde auch über eine andere und weitreichendere Zusammenarbeit nachgedacht. Das grösste Interesse der einzelnen Staaten war es, gegenüber den USA konkurrenzfähig zu bleiben. Da aber kein Staat alleine diese Herausforderung hätte annehmen können, wurde 1957 in Rom die EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) gegründet. Als sofortige Reaktion auf die Gründung der EWG, gründeten GB, Irland, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz die EFTA (Europäische Freihandelszone).
Die Gründerstaaten der EWG waren die Benelux-Staaten, Frankreich, Italien und die Bundesrepublik Deutschland. Die sog. ,,Römischen Verträge" beinhalteten u.a. auch die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM). Allgemein und auf lange Sicht gesehen wurden folgende Ziele angestrebt:
- Bis 1968 Beseitigung der Zollschranken und Schaffung eines einheitlichen Aussenzolls (für Nichtmitglieder allg. Zollunion)
- Schaffung eines freien Wirtschaftsmarktes
- Schaffung und Ausübung eines gemeinsamen Agrarmarktes bzw. einer länderübergreifenden Agrarpolitik
- Schaffung von eigenen Verwaltungsorganen (Vorbild: die Montanunion=EGKS) mit Kommissionen, Aufsichtsbehörden und Räten
Nun hatten alle Staaten ein gemeinsames Ziel, wofür sie auch z.T. auf ihre Souveränität verzichteten. Ein wirtschaftlicher Zusammenschluss war jetzt vollzogen, aber wie stand es mit der Politik??
Zunächst einmal wurde die Wirtschaftseinheit weiter vorangebracht und ausgebaut. Als gutes Beispiel und sehr vorteilhaft erwies sich der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag von 1963.
Am 1. Juli 1967 wurde dann aus EWG, EURATOM, und EGKS die Europäische
Gemeinschaft, die EG gegründet. Die langfristigen Ziele waren:
- ein gemeinsamer Binnenmarkt
- Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion
- Bildung einer politischen Union
So wurde in Brüssel die ,,Europäische Kommission" als überstaatliches Organ gegründet. Diese Kommission beinhaltet den Ministerrat bzw. den Europäischen Rat, in dem alle Regierungschefs der Mitglieder der EG vertreten sind. Als dann 1964 das Mehrheitswahlprinzip im Ministerrat eingeführt werden sollte, widersetzte sich der französische Staatspräsident Charles de Gaulle diesem. Er verlangte, dass jeder Staat seine eigene Souveränität behält und somit wurde im ,,Luxemburger Kompromiss" von 1965 beschlossen, dass jedes Land ein Vetorecht besitzt. De Gaulle war auch derjenige, der während seiner Regierungszeit verhinderte, dass Großbritannien mit in die EG eingegliedert wurde. Erst als de Gaulle 1969 zurücktrat konnten weitere Verhandlungen mit GB aufgenommen werden und 1973 wurden dann GB, Dänemark (EFTA-Staaten) und Irland unter dem Stichwort ,,Norderweiterung" aufgenommen. In den wirtschaftlichen Krisenzeiten der 70er und 80er Jahren, neigten viele Mitglieder dazu auf die allgemein europäische Zusammenarbeit zu verzichten um ihre eigenen Wege zu gehen. Dadurch kam der Integrationsprozess in dieser Zeit kaum voran. Vorerst bestand ein Europa der Neun Staaten (ursprünglich 6), welche dann unter dem Stichwort ,,Süderweiterung" mit den Beitrittsländern Griechenland (1981), Spanien und Portugal (1986) erweitert wurde. Nach der Wende im Osten von 1990 (Wiedervereinigung Deutschlands und Umsturz der Sowjetunion) stellten die EFTA-Staaten Anträge auf Eingliederung in die EG. Den Ostblockstaaten Polen, Tschechoslowakei und Ungarn wurde eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit und ein Beitritt in die EG in Aussicht gestellt.
1993 wurden wieder Versuche unternommen um die reformbedürftige EG wieder zu ,,modernisieren". So wurden einige wesentliche Veränderungen vorgenommen, wie Abbau der Schranken im Personen-, Kapital-, Güter-, und Dienstleistungsverkehr. Diese Veränderungen wurden am 7. Februar 1992 im Maastrichter Vertrag vorgenommen, mit dem Ziel künftig auch in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Industrie Entwicklungshilfe, Aussen- und Sicherheitspolitik sowie Justiz und Inneres zusammenarbeiten.
Ein weiterer Schritt wurde vom Bündnis der EG-Staaten und EFTA-Staaten zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) getan. Der wirtschaftliche und konjunkturelle Bereich boomt, der politische Teil jedoch blieb auf der Strecke.
Am 1. November 1993 tritt der Vertrag über die Europäische Union in Kraft, die EG heißt jetzt EU.
Am 1. März 1995 wurden die Grenzkontrollen im Rahmen des Schengener Abkommens aufgehoben.
Am 1. Januar 1999 fand der Start der Währungsunion mit zunächst 11 Teilnehmern statt
(Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Irland, Finnland und Italien)
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über die Einigung Europas?
Dieser Text, verfasst von Daniel Melchior, bietet einen Überblick über die Geschichte der europäischen Einigung, von den ersten Ideen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gründung der Europäischen Union (EU).
Welche frühen Ideen und Herausforderungen gab es bei der europäischen Einigung?
Frühe Ideen zur europäischen Einigung scheiterten an Rivalitäten und der Angst vor Souveränitätsverlust. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs jedoch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, insbesondere angesichts des gemeinsamen Gegners Sowjetunion und des wirtschaftlichen Aufschwungs durch den Marshallplan.
Was war die EGKS und welche Bedeutung hatte sie?
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), gegründet 1951, war der erste Schritt zu einer vertraglich gesicherten europäischen Zusammenarbeit. Sie schuf einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl und übertrug Kompetenzen an eine Kommission und eine Aufsichtsbehörde, was mit Souveränitätsverlust verbunden war.
Was war die EWG und welche Ziele wurden mit ihrer Gründung verfolgt?
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), gegründet 1957, hatte das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA zu stärken. Zu den Zielen gehörten der Abbau von Zollschranken, die Schaffung eines freien Wirtschaftsmarktes, die Einführung einer gemeinsamen Agrarpolitik und die Einrichtung eigener Verwaltungsorgane.
Was war der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag von 1963?
Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag von 1963 war ein gutes Beispiel für die erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit und erwies sich als sehr vorteilhaft für die Integration Europas.
Wie entstand die EG und welche langfristigen Ziele hatte sie?
1967 wurde aus EWG, EURATOM und EGKS die Europäische Gemeinschaft (EG). Langfristige Ziele waren ein gemeinsamer Binnenmarkt, die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie die Bildung einer politischen Union.
Welche Rolle spielte Charles de Gaulle bei der Erweiterung der EG?
Der französische Staatspräsident Charles de Gaulle widersetzte sich dem Mehrheitswahlprinzip im Ministerrat und verhinderte zeitweise den Beitritt Großbritanniens zur EG.
Wie kam es zur Norderweiterung und Süderweiterung der EG?
Nach de Gaulles Rücktritt konnten Verhandlungen mit Großbritannien aufgenommen werden, und 1973 erfolgte die Norderweiterung mit Großbritannien, Dänemark und Irland. Die Süderweiterung umfasste Griechenland (1981), Spanien und Portugal (1986).
Was waren die wesentlichen Veränderungen durch den Maastrichter Vertrag?
Der Maastrichter Vertrag von 1992 brachte wesentliche Veränderungen wie den Abbau von Schranken im Personen-, Kapital-, Güter- und Dienstleistungsverkehr. Zudem wurde die Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Kultur, Gesundheitswesen und Aussen- und Sicherheitspolitik angestrebt.
Wann wurde die EG zur EU und welche weiteren Schritte wurden unternommen?
Am 1. November 1993 trat der Vertrag über die Europäische Union in Kraft, und die EG wurde zur EU. Weitere Schritte waren die Aufhebung der Grenzkontrollen im Rahmen des Schengener Abkommens (1995) und der Start der Währungsunion (1999).
Was symbolisiert die Flagge der Europäischen Union?
Die Flagge der Europäischen Union enthält 12 Sterne auf blauem Grund. Die Zahl 12 steht für Vollkommenheit und der Kreis soll Zusammengehörigkeit demonstrieren.
- Arbeit zitieren
- Daniel Melchior (Autor:in), 1999, Einigung Europas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98422