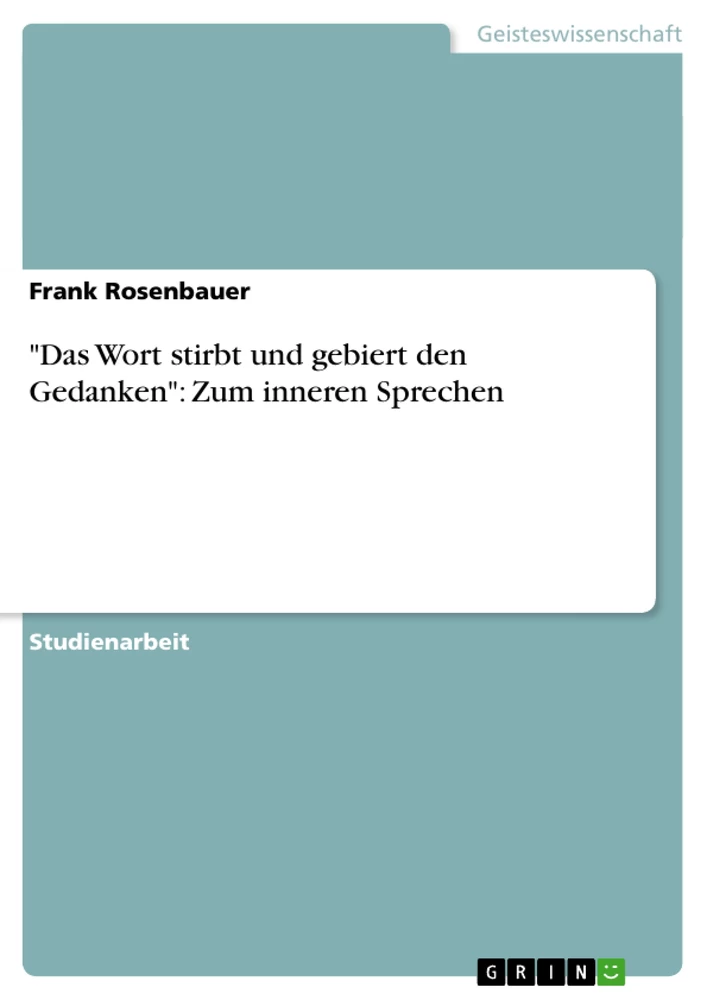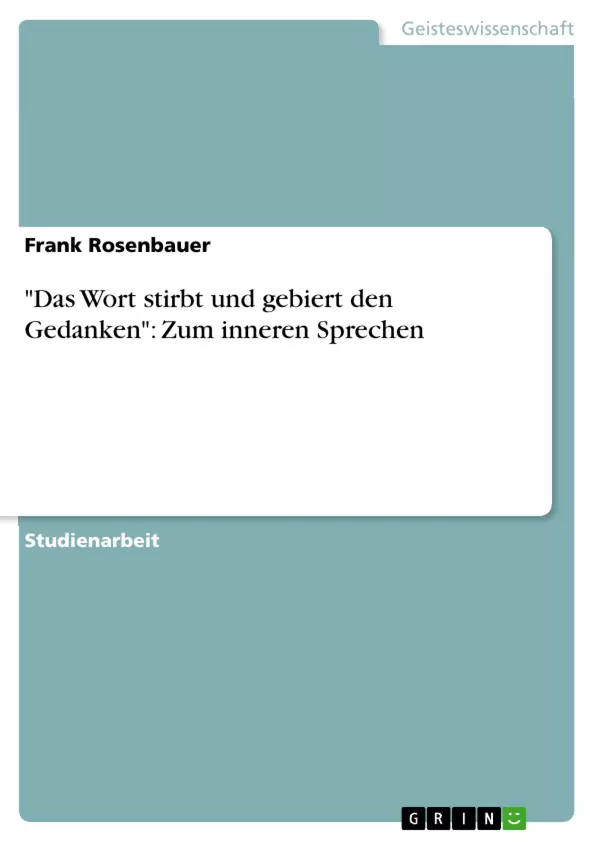Der Begriff des "inneren Sprechens", selten auch "Endophasie" genannt, hat eine lange Tradition. Seit der Antike ist der Begriff, als sprachphilosophisches Konzept, mit der Frage nach dem Verhältnis von Denken und Sprechen verknüpft. (WAHMHOFF, S. 1) Die Frage nach der Funktion des inneren Sprechens war auch, mit Unterbrechungen in den 50er und 60er Jahren diesen Jahrhunders, ein klassisches Thema der Leseforschung. (NEUMANN, S. 4)
Zu Beginn der Forschung wurde innere Sprache mit der Reproduktion von Wörtern oft gleichgesetzt. "Denken heißt schweigend zu sich selbst sprechen", hatte man schon im Altertum formuliert. Beginnend mit Plato, haben Philosophen, Linguisten und Psychologen diesen Gedanken weiterentwickelt. (WILD, S. 63)
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die menschliche Sprache in erster Linie von Philologen und Philosophen wissenschaftlich betrachtet. (KLATT, S. 40) Es wurde lange Zeit angenommen, daß die innere Sprache die selbe Struktur wie die äußere Sprache habe. (LURIJA, S. 153)
Eine der ersten zusammenhängenden Darstellungen einer Theorie der inneren Sprache gab Samuel Stricker im Jahre 1880. In der Einleitung zu seinem "Studien über die Sprachvorstellungen" beschreibt er eine Selbstbeobachtung:
"Ich kann bei der größten Anspannung meiner Aufmerksamkeit in den Sprachorganen keine Spur einer Bewegung entdecken. Und doch kommt es mir vor, als ob ich den Vers, den ich still durchdenke, mitreden würde."
Stricker untersucht seine eigenen Gefühle bei bestimmten Lauten. Dabei stellt er fest, daß er die selben Gefühle hat - ob er den Laut nun laut spricht, oder ob er ihn still denkt. Damit beschreibt Stricker eine enge Beziehung zwischen artikulierter Sprache und sprachlichen Vorstellungen. (WAHMHOFF, S.41)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung/Historie
- Anstöße durch L. S. Wygotski
- Allgemeine Definition nach Wygotski
- Methodische Probleme
- Entwicklung und Entstehung der inneren Sprache
- Belege für die Existenz der inneren Sprache
- "Zerebrale Position" der inneren Sprache
- Funktionen der inneren Sprache
- Die Art der inneren Sprache
- Die Syntax der inneren Sprache
- Wortschatz der inneren Sprache
- Semantik der inneren Sprache
- Verständlichkeit der inneren Sprache für andere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit "Das Wort stirbt und gebiert den Gedanken" beschäftigt sich mit dem Phänomen des inneren Sprechens. Sie analysiert dessen historische Entwicklung, beleuchtet verschiedene Definitionen und Theorien sowie methodische Herausforderungen. Dabei werden die Entstehung und Entwicklung der inneren Sprache, ihre Funktionen, ihre sprachliche Struktur und die Frage nach ihrer Verständlichkeit für andere behandelt.
- Historische Entwicklung des Begriffs "inneres Sprechen"
- Verschiedene Definitionen und Theorien von innerer Sprache
- Methodische Herausforderungen bei der Erforschung der inneren Sprache
- Funktionen der inneren Sprache in verschiedenen Bereichen des Denkens und Handelns
- Die sprachliche Struktur der inneren Sprache (Syntax, Wortschatz, Semantik)
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung/Historie: Der Begriff "inneres Sprechen" wird in seiner historischen Entwicklung von der Antike bis zum 19. Jahrhundert beleuchtet. Es werden die verschiedenen Definitionen und Theorien des inneren Sprechens vorgestellt, die von der Gleichsetzung mit der Repro-duktion von Wörtern bis hin zu "verbalen Motorkontraktionen" reichen.
- Anstöße durch L. S. Wygotski: Die Arbeit von L. S. Wygotski, der das innere Sprechen in den Mittelpunkt seiner Modelle stellt, wird vorgestellt. Wygotski argumentiert, dass das Verständnis der inneren Sprache entscheidend für das Verständnis der psychologischen Natur des Denkens ist.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt die folgenden Schlüsselwörter: inneres Sprechen, Endophasie, Denken und Sprechen, Sprache und Denken, Wygotski, Sprachentwicklung, Funktionen der inneren Sprache, Syntax, Wortschatz, Semantik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „innerem Sprechen“ (Endophasie)?
Es ist der Prozess des lautlosen Sprechens zu sich selbst, der eng mit dem Denken verknüpft ist. In der Forschung wird es oft als Bindeglied zwischen Gedanken und artikulierter Sprache untersucht.
Welchen Beitrag leistete L. S. Wygotski zur Erforschung der inneren Sprache?
Wygotski sah das innere Sprechen als entscheidend für die psychologische Natur des Denkens an. Er untersuchte, wie sich Sprache von einer sozialen Funktion zu einer inneren Denkfunktion entwickelt.
Hat die innere Sprache die gleiche Struktur wie die äußere Sprache?
Lange Zeit wurde dies angenommen, doch spätere Forschungen (u.a. von Lurija) zeigten, dass die innere Sprache oft fragmentarischer ist, eine eigene Syntax besitzt und stärker prädikativ verkürzt sein kann.
Was war die Erkenntnis von Samuel Stricker im Jahr 1880?
Stricker stellte fest, dass beim stillen Denken ähnliche Gefühle in den Sprachorganen entstehen wie beim lauten Sprechen, was auf eine enge Verbindung zwischen motorischen Sprachvorstellungen und Denken hindeutet.
Welche Funktionen erfüllt das innere Sprechen?
Es dient der Planung von Handlungen, der Problemlösung, der Selbstregulation und der Vorbereitung von äußeren Äußerungen.
- Citation du texte
- Frank Rosenbauer (Auteur), 1996, "Das Wort stirbt und gebiert den Gedanken": Zum inneren Sprechen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9821