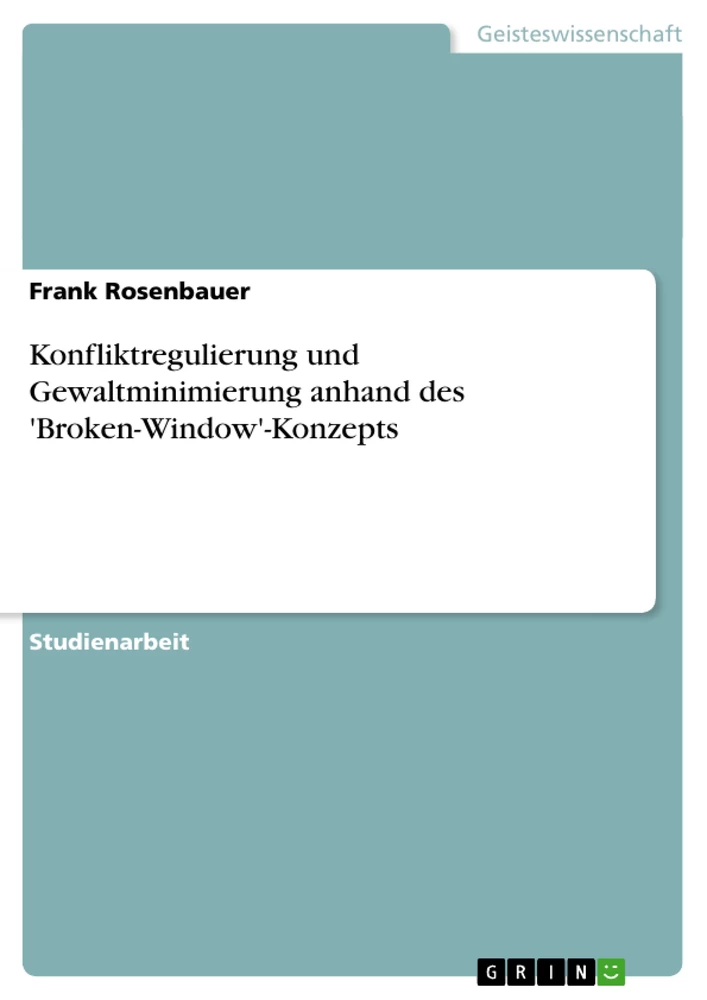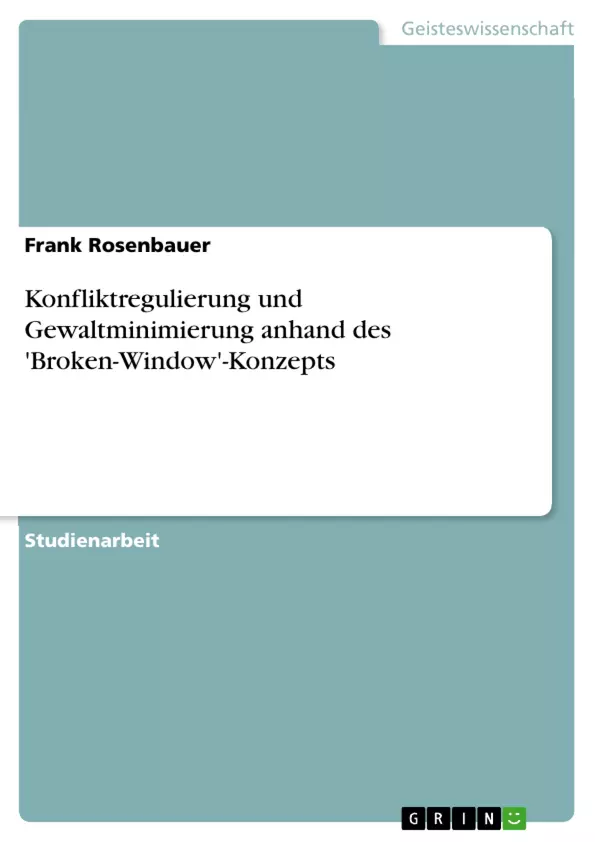„Mit dem Namen des früheren Harvard- (nunmehr UCLA-)Politologen J. Q. Wilson verbindet sich der wohl nachhaltigste und erfolgreichste Versuch einer im vollsten Kuhnschen Sinne paradigmischen Wende kriminologischen Denkens.“ (SACK 1996) Aber können anhand Wilsons folgenreicher „Broken-Windows“-Theorie, die auch unter dem Schlagwort „Zero tolerance“, „Null Toleranz gegenüber Rechtsbrechern“ Furore macht, und anhand seiner vorausgegangenen Überlegungen in dem Werk „Thinking about crime“, Aussagen zum Problem der Gewalt geleistet werden? Diese Theorie ist schließlich von Hause aus keine Gewalttheorie, sondern eine Theorie über das Entstehen und das Minimieren von Kriminalität. Doch Kriminalität trägt die Gewalt mit sich, wie sehr, hängt lediglich von der Definition von Gewalt ab. Und indem Wilson eine Theorie der Entwicklung von „kleiner“ zu „großer“ Kriminalität beschreibt, beschreibt er einen Prozeß gen Gewalt, denn er beleuchtet den Fortgang von der „Ordnungswidrigkeit“ hin zur „Gewaltkriminalität“.
Ein seit wenigen Jahren angewandtes und offenbar erfolgreiches Konzept zur Gewaltminimierung in hochentwickelten Konfliktregelungsgesellschaften wird auf die Broken-Windows-Theorie gestützt. Sie wird beschrieben als das „meistzitierte Verständigungsmedium über die Richtung einer sich neu entwickelnden Kriminalpolitik in allen kapitalistischen Ländern“. Wilson/Kelling haben als „new realists“ den Weg bereitet für eine neue konservative kriminalpolitische Schule, welche die Strategie in der Strafverfolgung verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Konfliktregulierung und Soziale Kontrolle
- Kriminalität und Gewalt
- Gewalt trotz Regulierung
- Rückgang der primären Kontrolle
- Nachahmungseffekte oder Signalsetzung?
- Definitionsmächte
- Rückgang der Ressourcen
- Neue alte Wege der Gewaltminimierung: Broken-Windows-Theorie
- Utilitaristisches Ursachenmodell
- Signalwechsel
- Ressourcenverschwendung vs. Schmetterlingseffekt
- Paradigmenwandel der sekundären Ressource Polizei
- Stärkung der primären Konfliktregulierungsressourcen
- Individuum vs. Gemeinwesen
- Deutsche Rezeption und Umsetzung des Broken-Windows-Konzepts
- Rezeption
- Wissenschaftsbetrieb
- Politik
- Öffentlichkeit
- Polizei
- Umsetzung
- Beispiel Stuttgart
- Rezeption
- Kritik
- Oberflächliche Erfolge
- Bequemer Sündenbock-Effekt
- Finanzierbarkeit
- Gefahr von Übergriffen und Repression
- Gefahr von problematischen Ausdehnungen
- Probleme der Übertragbarkeit
- Zusammenfassung
- Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des „Broken-Windows“-Konzepts zur Konfliktregulierung und Gewaltminimierung. Sie analysiert die Theorie, ihre Rezeption in Deutschland und kritische Aspekte ihrer Umsetzung. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Wirksamkeit und der potenziellen Probleme dieses Konzepts zu vermitteln.
- Das „Broken-Windows“-Konzept und seine theoretischen Grundlagen
- Die Umsetzung des Konzepts in der deutschen Praxis
- Kritische Auseinandersetzung mit den Erfolgen und den Grenzen des Konzepts
- Analyse der gesellschaftlichen Auswirkungen
- Bewertung der langfristigen Wirksamkeit der Strategie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die „Broken-Windows“-Theorie von Wilson/Kelling vor und deren Relevanz für die Gewaltminimierung. Sie hebt hervor, dass die Theorie zwar primär Kriminalität, aber auch den Weg von Ordnungswidrigkeiten hin zu Gewaltkriminalität behandelt. Die Arbeit untersucht die Anwendung und Wirksamkeit dieses Konzepts in hochentwickelten Gesellschaften.
Definitionen: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Begriffe „Konfliktregulierung“, „Soziale Kontrolle“, „Kriminalität“ und „Gewalt“ fest und schafft so eine gemeinsame Basis für die weitere Analyse. Die Abgrenzung dieser Begriffe zueinander ist essentiell für das Verständnis der „Broken-Windows“-Theorie und ihrer Anwendung.
Gewalt trotz Regulierung: Dieser Abschnitt untersucht die Gründe für anhaltendes gewalttätiges Verhalten trotz bestehender Konfliktregulierungsmechanismen. Er beleuchtet den Rückgang primärer Kontrolle, Nachahmungseffekte, den Einfluss von Definitionsmächten und den Mangel an Ressourcen als wesentliche Faktoren. Der Fokus liegt auf dem Versagen bestehender Systeme, Gewalt zu verhindern.
Neue alte Wege der Gewaltminimierung: Broken-Windows-Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die „Broken-Windows“-Theorie detailliert. Es erklärt das utilitaristische Ursachenmodell, den Signalwechsel, die Bedeutung von Ressourcenverschwendung versus Schmetterlingseffekt, den Paradigmenwandel in der Polizeiarbeit, und die Stärkung primärer Konfliktregulierungsressourcen. Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention und der Änderung des gesellschaftlichen Umfelds.
Deutsche Rezeption und Umsetzung des Broken-Windows-Konzepts: Hier wird die Übernahme und Anwendung des Konzepts in Deutschland untersucht. Es werden die Reaktionen des Wissenschaftsbetriebs, der Politik, der Öffentlichkeit und der Polizei analysiert und konkrete Beispiele, wie etwa die Umsetzung in Stuttgart, vorgestellt. Der Abschnitt zeigt die praktische Anwendung und ihre unterschiedlichen Auswirkungen.
Kritik: Dieser Abschnitt präsentiert eine kritische Auseinandersetzung mit dem „Broken-Windows“-Konzept. Die Kritikpunkte umfassen oberflächliche Erfolge, den Sündenbock-Effekt, die Finanzierbarkeit, die Gefahr von Übergriffen und Repression, problematische Ausdehnungen und Probleme der Übertragbarkeit. Es werden die potenziellen negativen Folgen und die Grenzen des Ansatzes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Broken-Windows-Konzept, Konfliktregulierung, Gewaltminimierung, Kriminalität, Soziale Kontrolle, Prävention, Polizei, Null Toleranz, Ressourcen, Deutschland, Kriminalpolitik, Rezeption, Umsetzung, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: "Broken Windows" Konzept
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert das „Broken-Windows“-Konzept zur Konfliktregulierung und Gewaltminimierung. Es untersucht die theoretischen Grundlagen, die deutsche Rezeption und Umsetzung, sowie kritische Aspekte des Konzepts. Ziel ist ein umfassendes Bild seiner Wirksamkeit und potenziellen Probleme.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definitionen von Konfliktregulierung, sozialer Kontrolle, Kriminalität und Gewalt; die Ursachen von Gewalt trotz bestehender Regulierungsmechanismen; die detaillierte Erklärung der „Broken-Windows“-Theorie; die deutsche Rezeption und Umsetzung des Konzepts (inkl. Beispiel Stuttgart); eine kritische Auseinandersetzung mit Erfolgen und Grenzen des Konzepts; und eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet folgende Kapitel: Einleitung, Definitionen, Gewalt trotz Regulierung, Neue alte Wege der Gewaltminimierung: Broken-Windows-Theorie, Deutsche Rezeption und Umsetzung des Broken-Windows-Konzepts, Kritik, Zusammenfassung und Stellungnahme. Jedes Kapitel wird im Dokument kurz zusammengefasst.
Was sind die zentralen Ziele des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, das „Broken-Windows“-Konzept umfassend zu untersuchen, seine Anwendung in Deutschland zu analysieren und kritische Aspekte seiner Umsetzung zu beleuchten. Es möchte ein ausgewogenes Bild der Wirksamkeit und potenziellen Probleme vermitteln.
Welche Kritikpunkte werden am „Broken-Windows“-Konzept geäußert?
Die Kritikpunkte umfassen oberflächliche Erfolge, den Sündenbock-Effekt, die Finanzierbarkeit, die Gefahr von Übergriffen und Repression, problematische Ausdehnungen und Probleme der Übertragbarkeit des Konzepts. Es werden potenzielle negative Folgen und Grenzen des Ansatzes aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Broken-Windows-Konzept, Konfliktregulierung, Gewaltminimierung, Kriminalität, Soziale Kontrolle, Prävention, Polizei, Null Toleranz, Ressourcen, Deutschland, Kriminalpolitik, Rezeption, Umsetzung, Kritik.
Wie wird die „Broken-Windows“-Theorie im Dokument erklärt?
Die Theorie wird detailliert erklärt, inklusive des utilitaristischen Ursachenmodells, dem Signalwechsel, der Bedeutung von Ressourcenverschwendung versus Schmetterlingseffekt, dem Paradigmenwandel in der Polizeiarbeit und der Stärkung primärer Konfliktregulierungsressourcen. Der Schwerpunkt liegt auf Prävention und der Änderung des gesellschaftlichen Umfelds.
Wie wird die deutsche Rezeption und Umsetzung des Konzepts dargestellt?
Die Übernahme und Anwendung in Deutschland wird untersucht. Die Reaktionen des Wissenschaftsbetriebs, der Politik, der Öffentlichkeit und der Polizei werden analysiert, und konkrete Beispiele wie die Umsetzung in Stuttgart werden vorgestellt.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Das Dokument ist für Personen gedacht, die sich akademisch mit dem Thema Konfliktregulierung, Kriminalität, Gewaltprävention und der „Broken-Windows“-Theorie auseinandersetzen. Es richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich ein umfassendes Bild des Konzepts verschaffen möchten.
- Citation du texte
- Frank Rosenbauer (Auteur), 1998, Konfliktregulierung und Gewaltminimierung anhand des 'Broken-Window'-Konzepts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9820