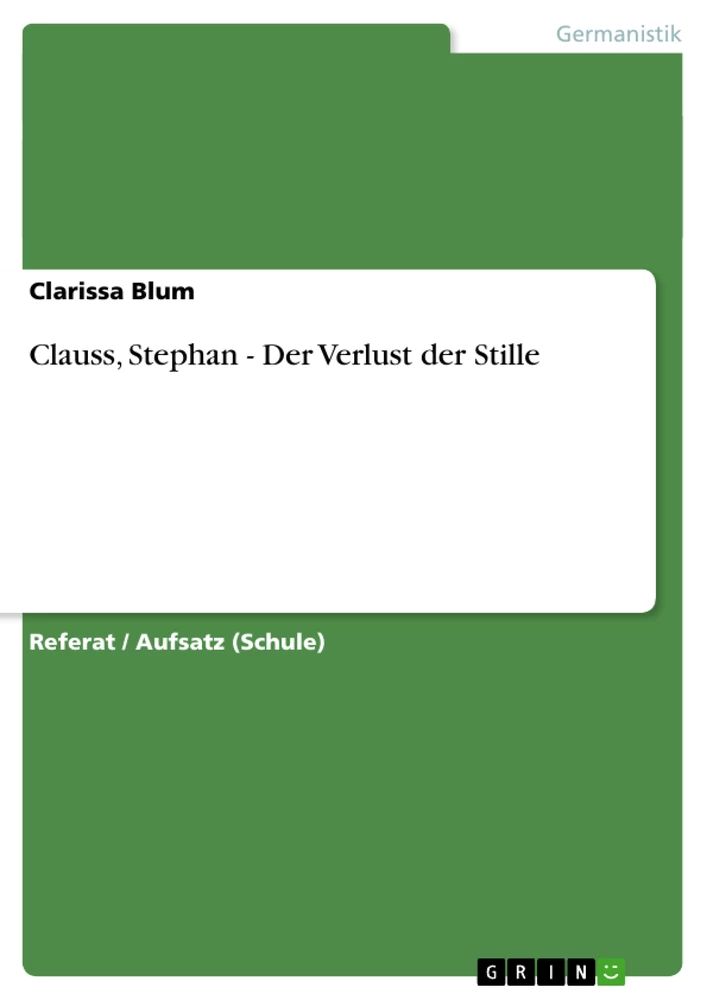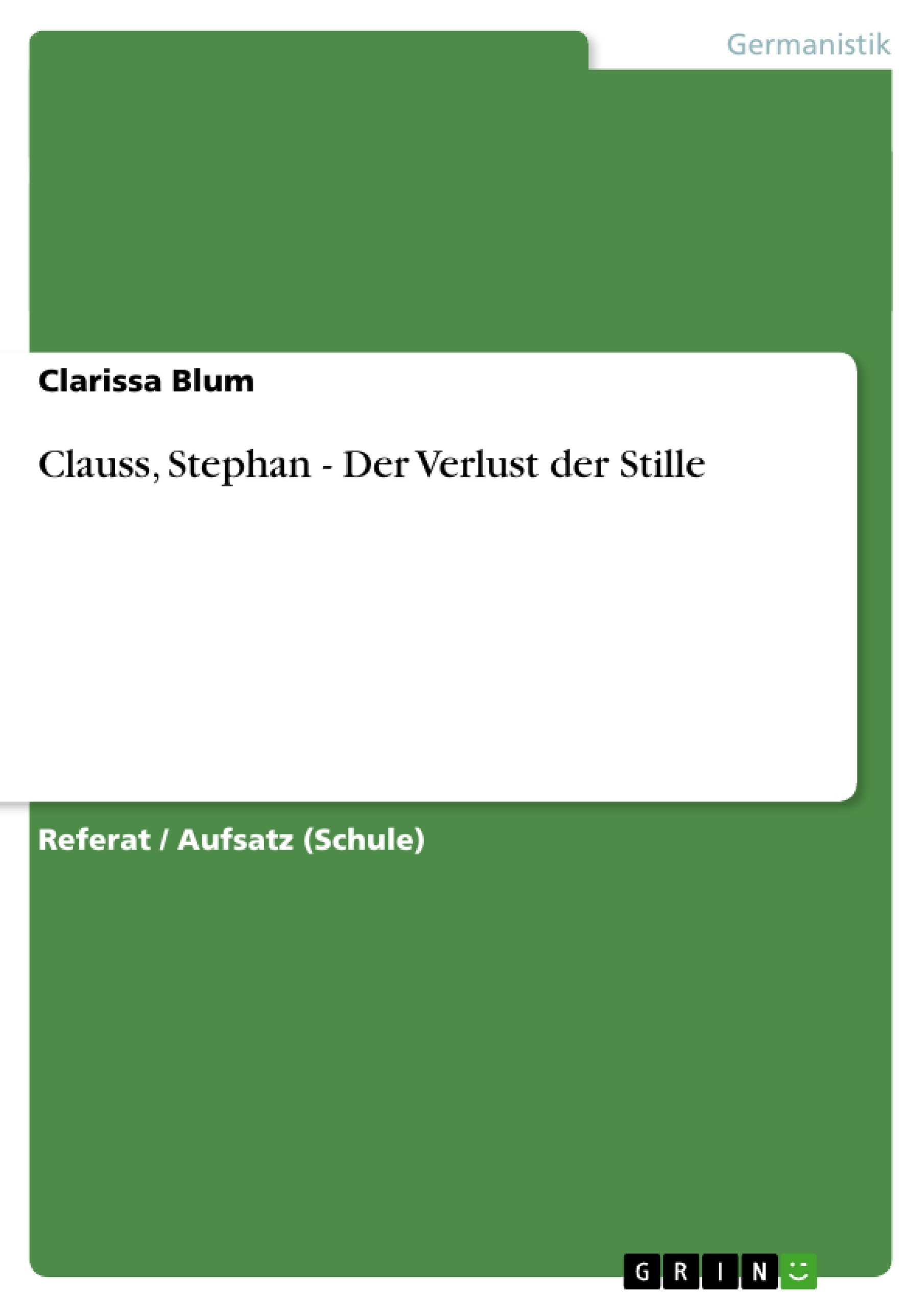In einer Welt, die von einem unaufhörlichen Crescendo der Geräusche beherrscht wird, stellt Stephan Clauss die unbequeme Frage: Haben wir die Stille unwiederbringlich verloren? Ist die Kakophonie des modernen Lebens – von dem Lärm der Großstädte bis zur allgegenwärtigen Beschallung durch Musik – zu einer existenziellen Bedrohung für unsere Lebensqualität geworden? Clauss argumentiert leidenschaftlich, dass Stille weit mehr ist als nur die Abwesenheit von Lärm; sie ist eine essenzielle Voraussetzung für menschliche Entfaltung, Kreativität und ein zivilisiertes Zusammenleben. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die lärmgeplagte Landschaft unserer Zeit, analysiert die subtilen und offensichtlichen Formen der akustischen Umweltverschmutzung und enthüllt, wie der Verlust der Stille unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Dabei scheut er sich nicht, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und liebgewonnene Gewohnheiten zu hinterfragen. Ist Musik im Supermarkt wirklich nur ein harmloser Hintergrund oder eine subtile Form der Manipulation? Steckt hinter unserer Flucht vor der Stille eine tieferliegende Angst vor der Konfrontation mit uns selbst? Clauss fordert uns auf, innezuhalten, zuzuhören und die Stille neu zu entdecken, bevor sie endgültig in den Turbulenzen unserer beschleunigten Welt verschwindet. Ein aufrüttelnder Appell für mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe und eine Rückbesinnung auf die Werte, die uns als Menschen ausmachen. Dieses Buch ist ein Weckruf für alle, die sich nach einem Leben sehnen, das nicht von Lärm, sondern von Stille und innerem Frieden geprägt ist. Es ist eine Einladung, die Stille als Quelle der Inspiration, der Kreativität und der menschlichen Verbundenheit wiederzuentdecken und die heilsame Kraft der Ruhe inmitten des alltäglichen Chaos zu erfahren. Ein Muss für jeden, der sich fragt, wie wir in einer immer lauter werdenden Welt unsere innere Balance bewahren und ein erfülltes Leben führen können.
Erörterung zu ,,Der Verlust der Stille von Stephan Clauss"
1. Stille ist in der heutigen Zeit zum Luxusartikel geworden. Immer mehr nimmt der Lärmpegel zu. Sei es nun der ständige Motorenlärm in der Großstadt oder das Aufheulen des Rasenmähers im idyllischen Dorf. Unterhält man sich mit dem Nachbarn am Gartenzaun, schafft es garantiert ein Flugzeug, die so wichtige Kommunikation zwischen den Gesprächspartnern zu blockieren. Doch es fällt auf, dass der Mensch aber auch gleichzeitig auf der Flucht vor diesem selbst verursachten Lärm ist, da er immer öfter ruhige Orte als Wohnort oder Ferienziel anpeilt. Der Mensch weiß also um den ,,großen Lärm" und will sich ihm immer weiter entziehen. Und TROTZDEM nimmt der Lärmpegel stetig zu. Auch wenn man die Lärmquelle, die von Maschinen ausgeht, zurücksetzten will, bleibt doch noch die Frage, ob dann der Mensch wieder ruhig leben wird, ob er das wirklich will und kann.
An manche Lärmursache hat sich der Mensch inzwischen allerdings gewöhnt, wobei man auf die Definition von Lärm eingehen muss. Denn Lärm wird nicht immer gleich als Lärm empfunden. Man sollte zwischen Unterhaltungsmusik und Motorenaufheulen eines Fahrzeuges unterscheiden.
2. Stephan Clauss ist der Ansicht, dass der Mensch unter jeglicher Art von Lärm leidet: Sei er nun mechanische oder akustische Umweltverschmutzung. Er verurteilt fast kompromißlos jede Art von Geräuschen. Sei es vermeidbarer Krach, entstanden durch unsere heutige Konsumgesellschaft oder sei es Musik, die bei vielen Menschen aber tatsächlich zu einer inneren Führung führt. Seine Argumentation zeigt sich meiner Meinung nach etwas einseitig, da er scheinbar mit Gewalt Stille fordert.
Clauss gibt an, dass Stille mehr als nur Abwesenheit von Lärm ist. Seiner Meinung nach kann sich die menschliche Zivilisation nur dann entfalten, wenn sich das Individuum Zeit und Muße nimmt, um bewusst mit sich und anderen umzugehen.
2.1 Er behauptet, dass der Mensch - unbewußt oder bewußt- immer mehr die Stille unterdrückt. Er kann sich somit dem ,,totalitären Machtanspruch" des Lärms nicht mehr entziehen. Mit diesem drohenden Verlust verliert der Mensch ein ,,unersetzbares Stück Lebensqualität". Für ihn ist Stille nicht nur Abwesenheit von Lärm sondern auch die Voraussetzung und der Bestandteil menschlicher Kultur und damit ein ,,tragendes Element eines zivilisierten Zusammenlebens" im Sinne der Verständigung. Die verbleibende Gesellschaft würde unerträglich sein, da man sich nicht mehr die Zeit nimmt, aufeinander zuzugehen oder sich mit sich selbst zu befassen.
2.2 Um seine Theorie zu unterstützen, benennt Clauss einige Beispiele aus dem täglichen Leben: Er bezeichnet Musik als akustische Lärmverschmutzung, da sie dem indirekten Zuhörer seine Autonomie raubt. Der Kunde im Supermarkt wird mit sanfter Musik zu noch mehr Konsum animiert, der U-Bahn-Wartende sanft gestimmt.
2.3 Weiterhin führt Clauss an, dass der Mensch auf der Flucht vor der Stille sei, da er in ihrer Anwesenheit ,,einen unerwünschten Einbruch in seiner betriebsamen Normalität" sieht. Als Reaktion darauf wirft man den Rasenmäher an oder dreht Musik auf, da der Mensch infolge des Lärmverlustes durch Verwirrung reagiert.
2.4 Dass Lärm als solcher krank macht ist bewiesen. Die Symptome reichen von Schlaflosigkeit bis zum Schlaganfall. Jeder könne unter Lärm direkt leiden, indem er anfällig für Krankheiten wird oder er würde indirekt leiden, indem er eine verstärkte Aggressivitätsbereitschaft aufweist.
Dass Stille heilt (oder Lärm ,,krank macht") weiß jeder Berufstätige: Kommt man abends nach Hause, so zieht man sich zurück und genießt das ruhige Leben: Man nimmt sich Zeit zum Entspannen.
2.5 Außerdem bezweifelt Clauss, dass ,,technische Verbesserung oder politische Kosmetik" die Lebensqualität des Menschen verbessert, denn dadurch würde der Mensch immer noch zu sehr unter dem Druck seiner Umwelt leiden, die ihm keine Freiheit lassen würde, sich auf sich selbst zu besinnen. Er regt den Menschen zu einer ,,Rückbesinnung auf verschüttete Werte" an. Wenn der Mensch sich wieder auf sich selbst besinnen würde, hätte er die Möglichkeit, daraus eine wesentlich größere Kraft für den Alltag zu ziehen.
3.1. Clauss benennt in den Zeilen 15-18 zwei Beispiele zum Thema Musik als akustische Umweltverschmutzung, mit denen er- meiner Ansicht nach- nicht überzeugen kann: Der Kunde im Supermarkt sieht musikalische Unterlegung als harmonischen Unterton an. Ohne ihn wäre die Stimmung in Kaufhaus kühl. Auf einer U-bahn-Station gibt es wesentlich höhere Lärmfaktoren als der, der von der Musik ausgestrahlt wird. Generell gilt auch Musik als Teil der menschlichen Kultur und deshalb darf auf sie nicht verzichtet werden. Somit sind die Beispiele ein Widerspruch zu seiner Theorie ,,Stille ist mehr als nur die Abwesenheit von Lärm" (s.o.).
Ich bin der Ansicht, dass Musik erst dann als ,,akustische Umweltverschmutzung" angesehen werden kann, wenn der Geräuschspegel benachbarten Personen stört. Hierzu läßt sich das gegebene Beispiel vom ,,dynamischen Nachbarn" heranziehen. Hier stimme ich mit dem Autor überein, dass Lärm allgegenwärtig geworden ist und dass man sich seinem Machtanspruch kaum noch entziehen kann.
3.2. Clauss vertritt die Meinung, dass ,,viele Menschen sogar schone regelrechte Angst vor der Stille haben" . Auch hier stimme ich mit Clauss Grundthese überein, dass man sich Lärm kaum noch entziehen kann. Es ist schwierig, sich zurückzuziehen, um sich wirklich auf sich zu besinnen, zumal man sich ständig von anderen Verpflichtungen , und sei es nur das Mähen der Wiese, eingeholt fühlt. Wiederum kann ich die gegebenen Beispielen nicht als überzeugend betrachten. Ich glaube nicht, dass jemand freiwillig und nur aus Angst vor der Stille sich in Arbeit stürzt. Es ist eher die Angst vor der Untätigkeit: Das Leben ist hektischer geworden.
Zum Thema Musik aus Angst vor der Stille verweise ich auf den oben genannten Aspekt ,,Musik ist Teil der Kultur". Hier läßt sich aber noch ergänzen, dass Musik von vielen Menschen auch als Ausgleich benutzt wird. Sei es beim Entspannen nach getaner Arbeit, beim Joggen oder sogar während der Arbeit.
3.3 Clauss behauptet, das Lärm aggressiv macht. Seine Behauptung ist glaubwürdig, da er es an Statistiken belegen kann.
Der Leser wird allerdings hier mit der Frage konfrontiert, was genau Clauss unter Lärm versteht, da er in seinem Text sämtliche Geräusche als Lärm bezeichnet. Ob das wirklich seine These ist, wird nicht deutlich.
3.4 Meiner Meinung nach muss der Mensch sich ändern. Diesem inneren Wandel gehen meiner Ansicht nach aber ,,technische Verbesserungen und politische Kosmetik" voraus. Erst wenn der Gesellschaft die Möglichkeit geboten wird, sich zu verändern, kann sie es auch umsetzen. Andersherum würde eine ,,Rückbesinnung auf verschüttete Werte" viele Menschen in ein seelisches Fiasko stürzen, da sie sich zwischen zwei Welten zu entscheiden hätten.
Clauss sollte in seinem Bericht nicht nur eine Forderung stellen, sondern auch näher darauf eingehen. z.B: Wie kann man einen ,,Bewusstseinswandel" fördern?
4.1 Ich denke, Clauss zielt in seinem Bericht nicht nur auf die äußere Stille, die im Kontrast zum Lärm steht. Hier muss man zwischen äußerer und innerer Stille entscheiden. Als Beispiel kann man Zeile fünf heranziehen: ,,Stille ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Lärm". Die Antwort gibt der Autor in Zeile 42: [Stille ist eine] ,,Rückbesinnung auf verschüttete Werte". Clauss geht meines Erachtens noch einen Schritt weiter, indem er behauptet, dass ,,Stille lange Zeit Voraussetzung und Bestandteil menschlicher Kultur war" (Klosterleben)
(7). Dieser Kerngedanke bildet gleichzeitig die Rückäußerung auf Zeile fünf und 42: Sowohl im alten Griechenland und alten Rom nahm man sich sehr viel Zeit (innere Stille) miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen. Somit ist Stille nicht nur Abwesenheit von Lärm, sondern auch ein wichtiges Kulturgut.
Diese innere Stille/Ruhe kann aber auch vom Auge wahr genommen werden. So ist es mit Sicherheit nachvollziehbar, dass eine Idylle eine weitaus größere innere Ruhe aufkommen lässt, als der Anblick eines grauen Wohnblocks.
4.2 Ich finde die Theorie von Clauss interessant, dass sich ,,die von Clauss so benötigte Stille" nicht nur auf unsere Umwelt punktiert, sondern auch auf unsere Innenleben. Geht es um die innere Stille, so muss der Mensch an sich selbst arbeiten. Ein Exempel wäre, dass das Individuum auf andere mit mehr Zeit zugeht, sei es beim gemütlichen Nachbargespräch oder beim gemeinsamen Spieleabend. Der Mensch kann sich seine Insel der Besinnung also selber errichten. Eine wichtige Voraussetzung für dieses innere Stille ist aber erst dann gegeben, wenn sich auch eine äußere Stille eingestellt hat (Abwesenheit von Lärm), da dieser den Geist eines Menschen aggressiv handeln läßt und somit eine innere Ruhe zerstört oder erst gar nicht aufkommen läßt. ,,Technische Verbesserungen oder politische Kosmetik" wären somit für diesen Reifeschritt notwendig. So wäre z.B. eine Minimierung von Motoren- und Abrollgeräuschen im Hinblick auf die Forschung sinnvoll. Des Weiteren wäre eine Eliminierung des motorisierten Individualverkehr aus den Innenstädten ein Schritt in die richtige Richtung.
5. Abschließend meine ich, dass er den Bogen überspannt, wenn er behauptet, dass sanfte Musikuntermalung in öffentlichen Einrichtungen als ,,akustische Umweltverschmutzung" angesehen werden sollte.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Erörterung zu ,,Der Verlust der Stille von Stephan Clauss"?
Die Erörterung befasst sich mit dem zunehmenden Verlust von Stille in der modernen Gesellschaft, basierend auf den Ansichten von Stephan Clauss. Es wird untersucht, ob Stille ein Luxusgut geworden ist und wie sich Lärm auf den Menschen auswirkt.
Wie definiert Stephan Clauss Stille?
Clauss sieht Stille als mehr als nur die Abwesenheit von Lärm. Für ihn ist sie eine Voraussetzung und ein Bestandteil menschlicher Kultur, ein tragendes Element eines zivilisierten Zusammenlebens im Sinne der Verständigung. Er betont die Bedeutung von Zeit und Muße für die persönliche und gesellschaftliche Entfaltung.
Welche Kritik übt Clauss an der modernen Gesellschaft im Bezug auf Lärm?
Clauss kritisiert die akustische Umweltverschmutzung, einschließlich Musik, als eine Form von Lärm, die die Autonomie des Einzelnen raubt und zu verstärktem Konsum animiert. Er behauptet, dass viele Menschen Angst vor der Stille haben und sich daher in Lärm flüchten.
Welche Auswirkungen hat Lärm laut Clauss auf die Gesundheit und das Verhalten der Menschen?
Clauss argumentiert, dass Lärm krank macht und Symptome von Schlaflosigkeit bis zum Schlaganfall verursachen kann. Er glaubt, dass Lärm zu verstärkter Aggressivität führt und die Fähigkeit des Menschen beeinträchtigt, sich auf sich selbst zu besinnen.
Welche Beispiele nennt Clauss, um seine These zu untermauern?
Clauss führt Beispiele wie Musik im Supermarkt und in U-Bahnen als akustische Lärmverschmutzung an. Er erwähnt auch, dass Menschen Rasenmäher anwerfen oder Musik aufdrehen, um der Stille zu entfliehen.
Welche Gegenargumente werden in der Erörterung gegen Clauss' Thesen vorgebracht?
Die Erörterung argumentiert, dass Musik nicht immer als Lärm empfunden wird und Teil der menschlichen Kultur ist. Es wird auch in Frage gestellt, ob Menschen sich freiwillig aus Angst vor der Stille in Arbeit stürzen, und es wird betont, dass Musik für viele Menschen einen Ausgleich darstellt.
Welche Bedeutung hat die innere Stille im Kontext der Erörterung?
Die Erörterung unterscheidet zwischen äußerer und innerer Stille. Die innere Stille wird als eine Rückbesinnung auf verschüttete Werte und als Voraussetzung für ein zivilisiertes Zusammenleben betrachtet. Sie kann durch äußere Ruhe gefördert werden.
Welche Lösungsansätze werden in der Erörterung vorgeschlagen?
Es wird angedeutet, dass technische Verbesserungen und politische Maßnahmen notwendig sind, um die äußere Stille zu fördern und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auf sich selbst zu besinnen. Dazu gehören die Minimierung von Motoren- und Abrollgeräuschen sowie die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in Innenstädten.
Welche Kritik wird an Clauss' Forderungen geübt?
Es wird kritisiert, dass Clauss in seiner Analyse zu weit geht, wenn er sanfte Musikuntermalung in öffentlichen Einrichtungen als akustische Umweltverschmutzung betrachtet. Es wird auch gefordert, dass er konkrete Vorschläge zur Förderung eines Bewusstseinswandels unterbreitet.
Was ist das Fazit der Erörterung?
Abschließend wird festgestellt, dass Clauss in vielen Punkten zutreffende Ansichten vertritt und dass der Mensch die Stille als ein wertvolles Gut behandeln sollte. Es wird jedoch auch angemerkt, dass seine Forderungen teilweise überzogen sind.
- Quote paper
- Clarissa Blum (Author), 1999, Clauss, Stephan - Der Verlust der Stille, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98045