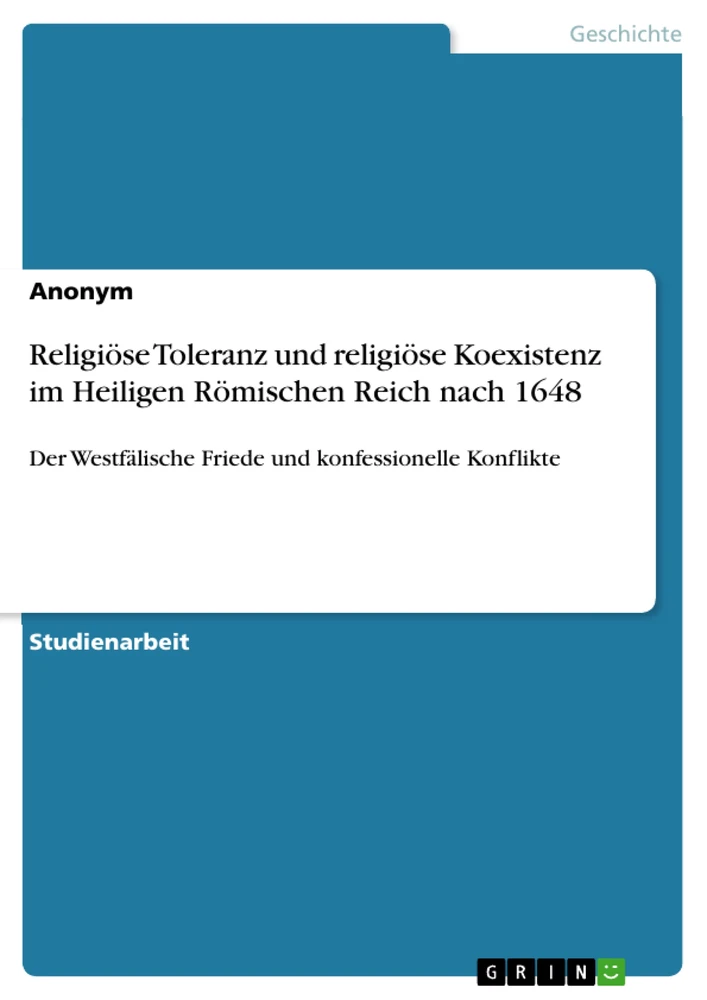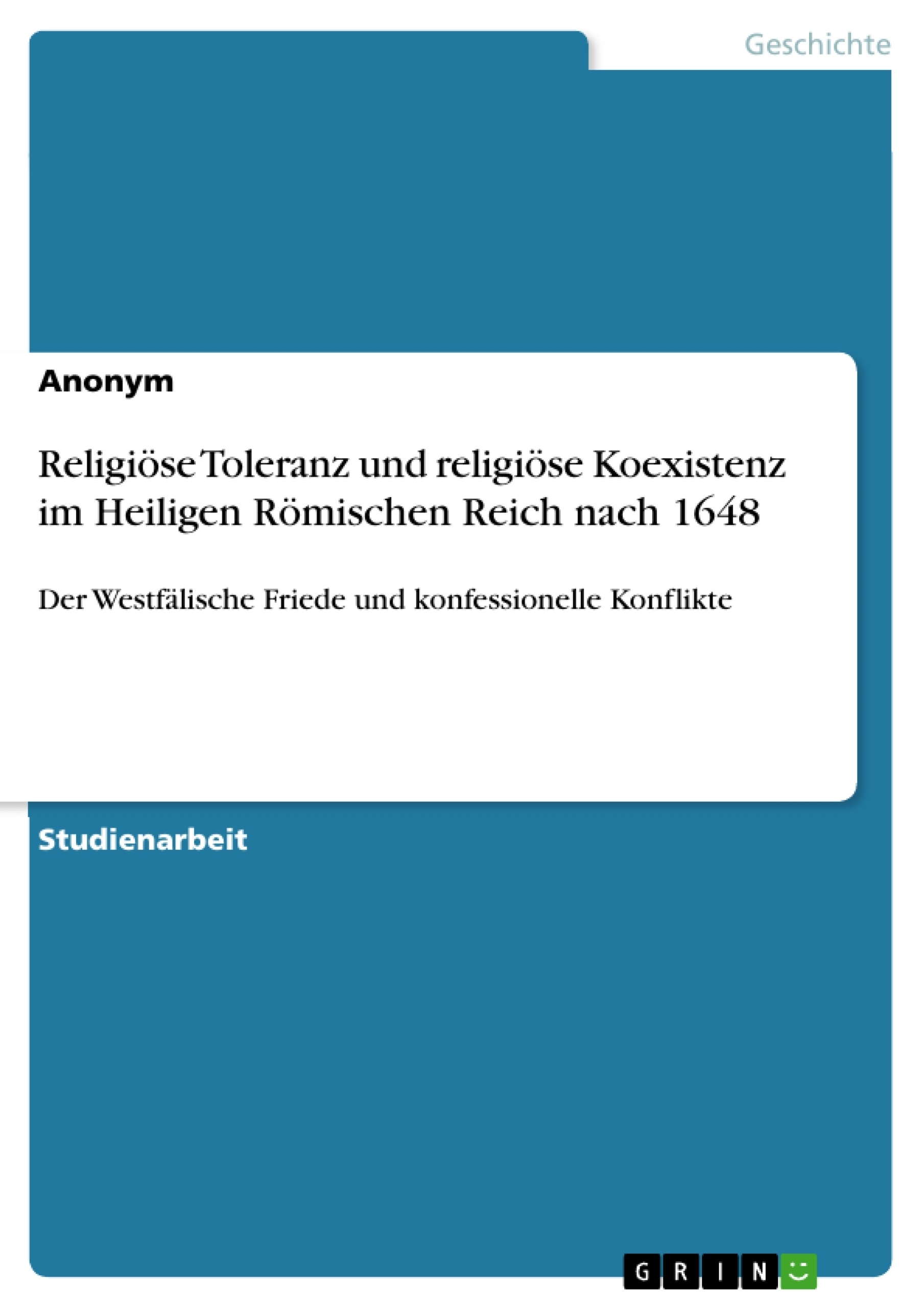Die vorliegende Arbeit untersucht die "konfessionelle Konfliktdynamik" (Whaley 2000) in der zweiten Hälfte der Reichsgeschichte, wobei die Frage nach religiöser Toleranz und religiöser Koexistenz im Vordergrund steht.
Der Westfälische Friede vom 24. Oktober 1648 markierte den Abschluss des Dreißigjährigen Krieges und sollte auch die Zeit der Religionskriege endgültig beenden. Tatsächlich kam es nach 1648 nicht erneut zu einem vergleichbaren Konfessionskrieg – im Gegenteil, die Zahl der religiösen Verfolgungen im Heiligen Römischen Reich nahm sogar ab. Dies brachte Historiker in der Vergangenheit dazu, einen Bedeutungsverlust des Konfessionellen anzunehmen und deshalb beim Westfälischen Frieden eine Epochengrenze anzusetzen. Mit dem Ende des konfessionellen Zeitalters wird gleichzeitig der Beginn einer Säkularisierung impliziert. Konfessionelle Auseinandersetzungen prägten reichspolitische wie auch territoriale Verhältnisse jedoch weiterhin. Ein Wandel ist dennoch wahrzunehmen: Konfessionelle Unstimmigkeiten oder Toleranzdebatten hatten in der Reichspolitik fortan weniger einen theologischen Charakter, Argumente wurden vielmehr rechtlich bzw. juristisch begründet.
Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung der Konfessionen nach 1648
- Religiöse Toleranz und religiöse Koexistenz im Heiligen Römischen Reich nach 1648: Der Westfälische Friede und konfessionelle Konflikte
- Grundlagen des Westfälischen Friedens und Bewertung des Westfälischen Toleranzbegriffs
- Konfessionelle Konflikte um die Auslegung des Westfälischen Friedens
- Fazit und lokale Toleranzpolitik als Erweiterung des Westfälischen Toleranzbegriffs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die „konfessionelle Konfliktdynamik“ in der zweiten Hälfte der frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, wobei die Frage nach religiöser Toleranz und religiöser Koexistenz im Vordergrund steht. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle des Westfälischen Friedens, der die rechtliche, politische sowie gesellschaftliche Ordnung maßgeblich beeinflusste.
- Analyse der Grundlagen des Westfälischen Friedens und seine Bedeutung für die religiöse Toleranz.
- Untersuchung der Konfessionellen Konflikte um die Auslegung des Westfälischen Friedens.
- Bewertung der Grenzen und Möglichkeiten der religiösen Koexistenz im Heiligen Römischen Reich nach 1648.
- Diskussion der lokalen Toleranzpolitik als Erweiterung des Westfälischen Toleranzbegriffs.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Konfessionen im Heiligen Römischen Reich nach 1648. Es beleuchtet die Bedeutung des Westfälischen Friedens als Endpunkt der Religionskriege und die Entwicklung des Konfessionellen in der Folgezeit. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen des Westfälischen Friedens und die rechtliche Basis der darin festgelegten religiösen Toleranz analysiert. Dabei wird auch auf die "perpetua declaratio" des Augsburger Religionsfriedens eingegangen, die in bestimmten Punkten des Westfälischen Friedens festgehalten wurde.
Schlüsselwörter
Religiöse Toleranz, religiöse Koexistenz, Westfälischer Friede, Konfessionelle Konflikte, Konfessionelles Zeitalter, Augsburger Religionsfriede, Perpetua Declaratio, Simultaneumstreit, Corpus Evangelicorum, Reichspolitik, Recht, Juristische Auseinandersetzungen, Frühneuzeitliche Reichsgeschichte, Historische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte der Westfälische Friede von 1648 an der Religionspolitik?
Er beendete die großen Religionskriege im Heiligen Römischen Reich und legte rechtliche Rahmenbedingungen für das Nebeneinander der Konfessionen (Katholiken, Lutheraner, Reformierte) fest.
Kam es nach 1648 noch zu religiösen Verfolgungen?
Die Zahl der Verfolgungen nahm ab, aber konfessionelle Konflikte bestanden auf rechtlicher und politischer Ebene fort. Es herrschte eher eine pragmatische Koexistenz als moderne Toleranz.
Was bedeutet „Säkularisierung“ in diesem Kontext?
Es beschreibt den beginnenden Prozess, bei dem religiöse Argumente in der Politik zunehmend durch rechtliche und juristische Begründungen ersetzt wurden.
Was war das „Corpus Evangelicorum“?
Es war der Zusammenschluss der protestantischen Reichsstände auf dem Reichstag, um ihre Interessen gegenüber der katholischen Mehrheit und dem Kaiser zu wahren.
Wie funktionierte lokale Toleranzpolitik?
Oft gab es auf lokaler Ebene Sonderregelungen (z. B. Simultankirchen), die ein friedliches Zusammenleben ermöglichten, auch wenn die Reichspolitik noch von Misstrauen geprägt war.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Religiöse Toleranz und religiöse Koexistenz im Heiligen Römischen Reich nach 1648, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978285