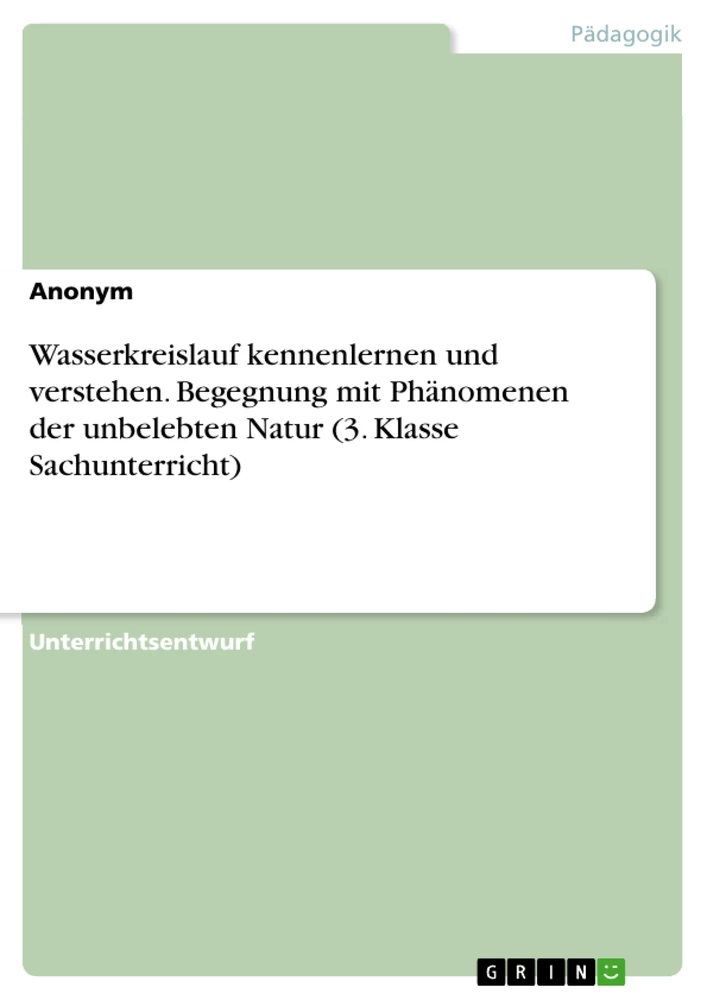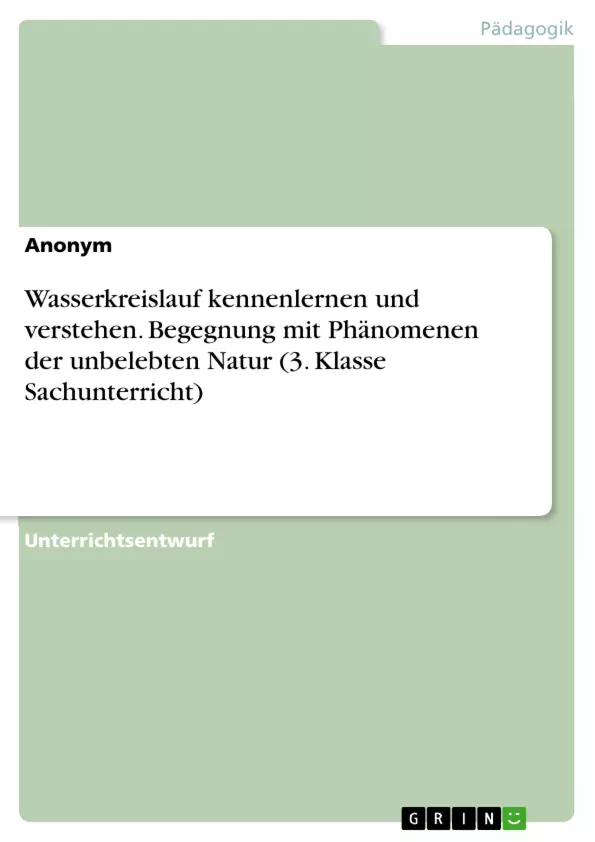Das Thema "Wasserkreislauf" wird im sächsischen Lehrplan für die Grundschule in die dritte Klassenstufe eingeordnet. Es ist ein Bestandteil des vierten Lernbereiches: Begegnung mit Phänomenen der unbelebten Natur. Die Kinder haben in den Unterrichtsstunden zuvor bereits kennengelernt, welche Möglichkeiten es gibt, sich über das Wetter zu informieren und welche Bedeutung Wettervorhersagen haben
Sie haben sich auch mit den Eigenschaften zu dem Thema Wasser auseinandergesetzt und herausgefunden, dass Wasser unterschiedliche Zustandsformen besitzen kann und wie die Begriffe "Gefrieren", "Schmelzen" und "Verdampfen" mit ihnen in Verbindung stehen. In der ausgewählten Unterrichtsstunde werden die Kinder anhand von Experimenten erkennen, was die Begriffe "Verdunsten" und "Kondensieren" bedeuten.
Zudem lernen sie, dass sich das Wasser in der Natur in einem Kreislauf bewegt. Im Anschluss an diese Unterrichtseinheit finden die Kinder mittels verschiedener Experimente heraus, welche Materialien und Gegenstände im Wasser schwimmen, bzw. sinken können.
Inhaltsverzeichnis
- Formale Angaben
- Lehrplananalyse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Lehr- und Lernvoraussetzungen
- Lernziele
- Methodische Analyse
- Einordnung in die Phasen E-E-E
- Einstieg
- Erarbeitung
- Ergebnissicherung
- Verlaufsplanung
- Anhang
- Protokoll zum Thema: „Die Verdunstung“
- Protokoll zum Thema: „Die Kondensierung“
- Tafelbild Wasserkreislauf
- Der „Wassertropfen Fridolin\" von Thomas Hammer
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert eine Unterrichtsstunde zum Thema „Wasserkreislauf“ in der dritten Klasse. Ziel ist es, die didaktische Planung und Durchführung der Unterrichtsstunde anhand verschiedener Kriterien zu beleuchten. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Erläuterung der fachlichen Inhalte und deren didaktische Umsetzung.
- Lehrplananalyse und Einordnung des Themas im sächsischen Lehrplan für die Grundschule
- Sachanalyse der Prozesse „Verdunsten“ und „Kondensieren“ sowie des Wasserkreislaufs
- Didaktische Analyse der Stunde, einschließlich der Einbeziehung der Lerngruppe und der gewählten Lernmethoden
- Analyse der Lernziele und der Relevanz des Themas für den weiteren Bildungsgang der Schüler
- Methodische Analyse der Unterrichtsstunde und deren Einteilung in die Phasen „Einstieg“, „Erarbeitung“ und „Ergebnissicherung“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Lehrplananalyse zeigt, dass das Thema „Wasserkreislauf“ im sächsischen Lehrplan für die dritte Klasse eingeordnet ist. Der Text beleuchtet die bereits vorangegangenen Unterrichtsstunden zum Thema Wasser und die Bedeutung von Wettervorhersagen.
Die Sachanalyse befasst sich zunächst mit dem Verdunsten und Kondensieren von Wasser. Sie erläutert die Unterschiede zwischen Sieden und Verdunsten und erklärt die Faktoren, die das Verdunsten beeinflussen. Im weiteren Verlauf der Sachanalyse wird das Kondensieren genauer betrachtet, wobei die Rolle von Druck und Temperatur sowie die Entstehung von Nebel, Tau, Raureif und Wolken erklärt werden. Abschließend wird der Wasserkreislauf als Ganzes vorgestellt und die einzelnen Prozesse der Verdunstung, Kondensation und Niederschlagsbildung erklärt.
Die didaktische Analyse befasst sich mit der Relevanz des Themas für die Schüler und analysiert die gewählten Lernmethoden. Es wird betont, dass die Lerngruppe durch Experimente und Gruppenarbeiten die Vorgänge des Verdunstens und Kondensierens beobachten und somit die Entstehung des Wasserkreislaufs nachvollziehen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Wasserkreislauf, Verdunsten, Kondensieren, Aggregatzustand, Siedetemperatur, Luftfeuchtigkeit, Nebel, Wolken, Niederschlag, Experimente, Gruppenarbeit, Didaktische Analyse, Lehrplananalyse, Sachanalyse.
Häufig gestellte Fragen
In welcher Klassenstufe wird der Wasserkreislauf im Lehrplan behandelt?
Das Thema ist im sächsischen Lehrplan für die Grundschule in der 3. Klassenstufe im Bereich „Begegnung mit Phänomenen der unbelebten Natur“ vorgesehen.
Was ist der Unterschied zwischen Sieden und Verdunsten?
Sieden geschieht bei einer festen Temperatur (Siedepunkt), während Verdunsten bei jeder Temperatur an der Oberfläche einer Flüssigkeit stattfinden kann.
Wie lernen Kinder die Begriffe „Verdunsten“ und „Kondensieren“?
In der Unterrichtsstunde werden Experimente durchgeführt, bei denen die Schüler beobachten, wie Wasser unsichtbar wird (Verdunsten) und sich wieder als Tropfen niederschlägt (Kondensieren).
Welche Rolle spielen Wolken im Wasserkreislauf?
Wolken entstehen durch die Kondensation von aufgestiegenem Wasserdampf an winzigen Teilchen in der Luft, wenn die Temperatur sinkt.
Wer ist „Fridolin“ in diesem Unterrichtskonzept?
„Wassertropfen Fridolin“ ist eine Geschichte von Thomas Hammer, die im Unterricht genutzt wird, um den Weg des Wassers kindgerecht zu veranschaulichen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Wasserkreislauf kennenlernen und verstehen. Begegnung mit Phänomenen der unbelebten Natur (3. Klasse Sachunterricht), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/977874