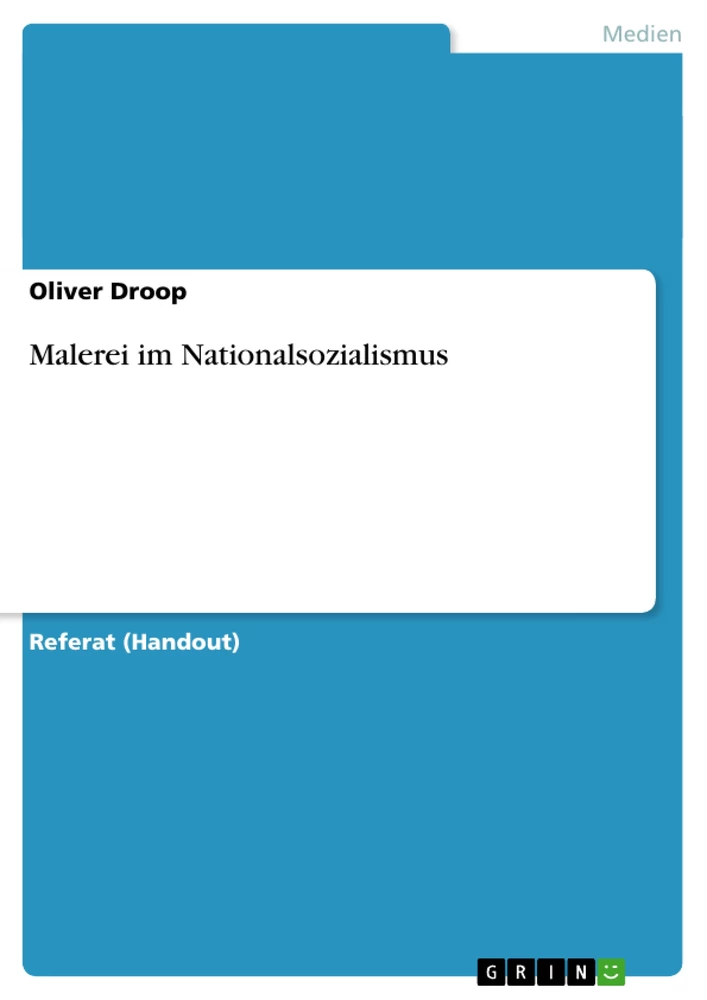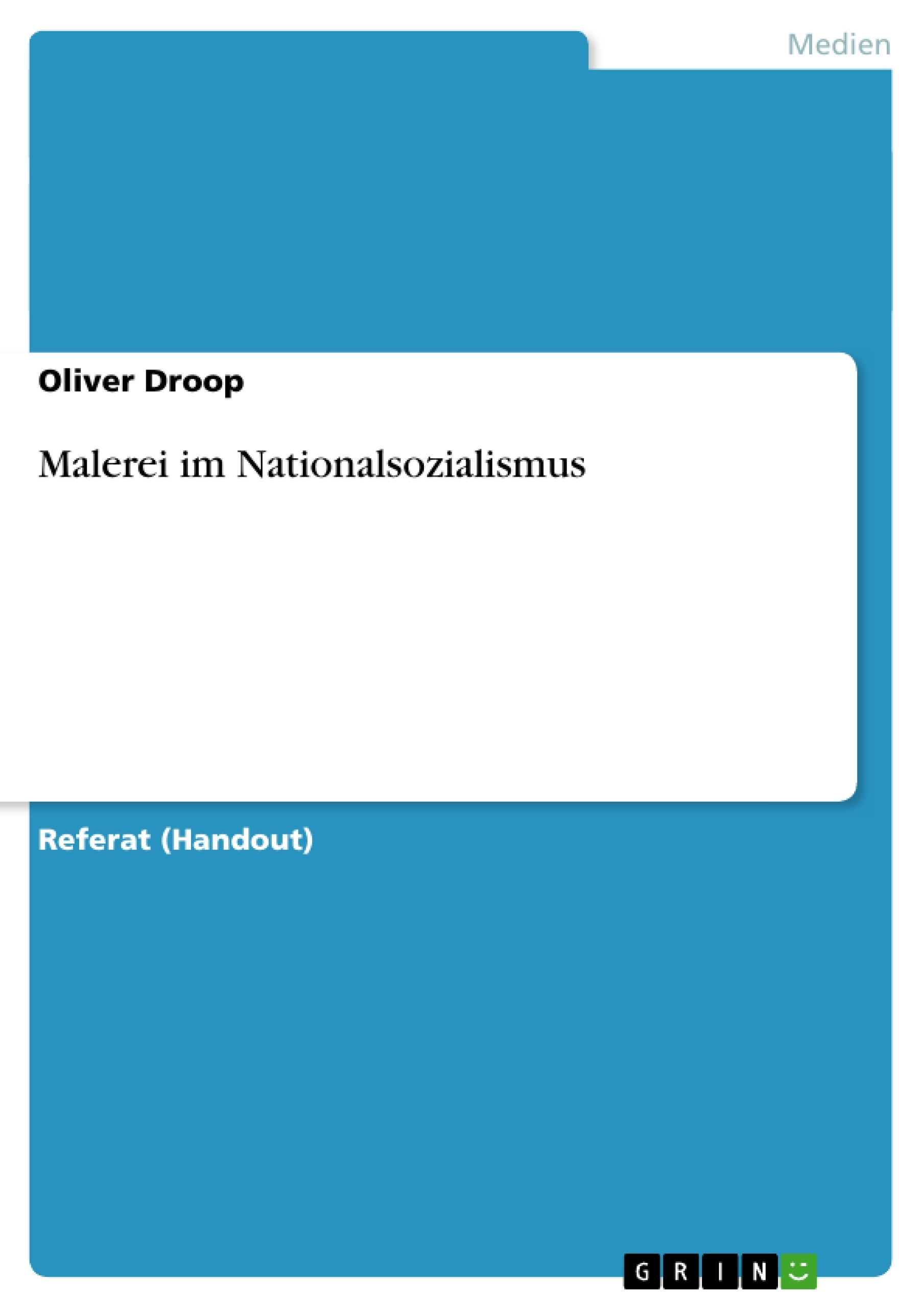Was, wenn die Leinwand zum Schlachtfeld wird und der Pinsel zur Waffe? Tauchen Sie ein in die düstere Welt der "Entarteten Kunst" im Nationalsozialismus, eine Epoche, in der ästhetische Ideologien über Leben und Tod entschieden. Diese fesselnde Analyse enthüllt die perfiden Mechanismen, mit denen das NS-Regime die Kunst instrumentalisierte, um seine rassistische und totalitäre Weltanschauung zu zementieren. Von Hitlers persönlichen Obsessionen, dargelegt in "Mein Kampf", bis hin zu Rosenbergs ideologischen Verdrehungen, die den Expressionismus als "zersetzend" brandmarkten, wird die systematische Verfolgung und Vernichtung moderner Kunst schonungslos offengelegt. Erfahren Sie, wie der Antisemitismus als treibende Kraft hinter der Diffamierung "jüdischer" Kunst diente und wie Goebbels' anfängliche Versprechen der künstlerischen Freiheit in Zynismus umschlugen. Die Rekonstruktion der berüchtigten Ausstellung "Entartete Kunst" von 1937, die als propagandistisches Tribunal gegen Künstler wie Beckmann, Dix, Nolde, Kandinsky und Klee inszeniert wurde, lässt den ideologischen Terror dieser Zeit auf erschreckende Weise lebendig werden. Doch dieses Buch wirft auch ein Licht auf die "Parteikunst", die naturalistische Verherrlichung des "gesunden" Körpers, der Familie und des Krieges, die als Gegenentwurf zur verfemten Moderne propagiert wurde. Entdecken Sie die perfiden Strategien der NS-Kulturpolitik, die von der Zensur und Verfolgung bis hin zur Vernichtung von Kunstwerken reichten und die deutsche Kunstlandschaft nachhaltig prägten. Eine erschütternde Lektüre, die die Bedeutung der Kunstfreiheit und die Gefahren ideologischer Verblendung eindrücklich vor Augen führt – ein Muss für alle, die sich für Kunstgeschichte, Nationalsozialismus und die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte interessieren. Ergründen Sie die Hintergründe der Diffamierung und Zerstörung, die weit über den ästhetischen Bereich hinausreichten und ein Spiegelbild der totalitären Ideologie des Regimes darstellten. Verfolgen Sie die Schicksale der Künstler, deren Werke als "entartet" galten, und die Mechanismen der Verfolgung und Ausgrenzung. Dieses Buch ist ein wichtiges Dokument, das die Notwendigkeit des Schutzes der Kunstfreiheit und der Auseinandersetzung mit den dunklen Kapiteln der Geschichte mahnt. Erfahren Sie, wie die Nationalsozialisten versuchten, die Kunst zu einer Waffe in ihrem ideologischen Krieg zu machen, und wie Künstler und Intellektuelle sich diesem totalitären Anspruch widersetzten. Tauchen Sie tief ein in die Welt der "entarteten Kunst" und der "Parteikunst" und gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Kunst, Politik und Ideologie im Dritten Reich.
Die Malerei im Nationalsozialismus
Entartete Kunst
Gründe und Ursprünge
Mein Kampf
Es gibt wahrscheinlich mehrere Ursprünge der nationalsozialistischen Einstellung gegenüber der Kunst, doch ein wichtiger Faktor dabei spielte Hitlers Buch ,,Mein Kampf". In diesem Werk, 1924 geschrieben, begründet Hitler die Entstehung einer Kultur mit der Unterjochung niederer Völker durch die Arier. Diese Völker würden dann als technisches Instrument einer werdenden Kultur dienen.
Antisemtitismus
Hitlers negative Einstellung den modernen freien Künsten gegenüber zeugte sehr stark von seiner antisemitischen Haltung. So bringt er, aber auch andere, die Kunst immer wieder mit dem Judentum in Verbindung. Dieses sei ein Förderer der Niggerkunst und unfähig, Werke der bildenden Künste herzustellen. In seinem Buch erwähnt er, daß seit 1900 ein Durchbruch der jüdischen Infektion auf dem Gebiet der bildenden Künste erkennbar sei, der sich im Kubismus und im Dadaismus ausdrücke. Das Dulden der Künste in Frankreich erklärt er mit einem ungenügenden Rassebewußtsein. Diese avantgardistische Kunst ist für ihn der Abhub einer kranken, biologischen Grundlage und sei durch die Vermischung von >nordischem< und jüdischem Blut entstanden. Später nennt Hitler Augenfehler, die durch Vererbung oder mechanische Weise entstanden, als Grund für das Produzieren solcher Geisteskrankheiten.
Rosenberg
Für Rosenberg, Parteigenosse und Redakteur des ,,Völkischen Beobachters", liegt der Beginn der Kunstentartung im Impressionismus. Dieser wurde nach seiner Ansicht zum Schlachtruf des allzersetzenden Intellektualismus und
damit zur mythenlosen Sinnlichkeitskunst. Man wollt jedoch etwas ausdrücken und so entstand nach Rosenbergs Ansicht der Expressionismus, für den allerdings nichts mehr zum Ausdrücken da gewesen sei. Es ist verständlich, daß der Expressionismus als feindlich angesehen wurde, da man, hier besonders, sich eigene Gedanken machen konnte. Und eigene Gedanken, sowie der sogenannte Intellektualismus allgemein, waren gefährlich. Auch Rosenberg mag erkannt haben, daß der Betrachter eines Werkes die negative Realität sieht und somit eine negative und, was schlimmer ist, eine kritische Sehweise bekommt. Die Vorbilder in Sachen Kunst lagen für die Nationalsozialisten sowohl in der Antike als auch im 19. Jahrhundert. Für Hitler besteht ein Zusammenhang zwischen den Griechen und den Germanen. Beide mußten, bzw. müssen um ihr Kulturdasein kämpfen. Die Vorliebe für die griechische Kunst erkennt man an den übergroßen und mächtigen Bauwerken der Nazis. Die deutschen Romantiker im 19. Jahrhundert wurden deshalb so geschätzt, da sie ,,altmeisterliche" deutsche Technik mit der Natur, einem sehr bedeutenden Merkmal in der NS-Kunst, vereint haben.
Die moderne Kunst hingegen sei ein Gemenge aus uralten, primitiven Überlieferungen und allerneusten technischen Erkenntnissen, und somit eine rein verstandesmäßig hergestellte Kunst. Der Mythos, der für die Nazis eine Hauptrolle im Kunstgeschehen spielte, fehlte.
Vorgehen des Staates
Kulturzeitschriften
Schon vor der Machtergreifung verfügte die NSDAP über sehr viele Zeitungen und Zeitschriften, darunter auch einige auf dem Kultursektor. Dort erschienen schon früh antisemitische Zeichnungen, meist Karikaturen, die zum Teil ohne jegliches Können entstanden. Ein bedeutender Karikaturist war Hans Schweitzer, der für die Zeitung ,,Der Stürmer" zeichnete. Seine Zeichnungen entsprachen der Vorstellung der Partei. Er brachte das Bild des ,,eisenharten, willensstarken, deutschen Kämpfers" zu Papier. Eine solche Zeichnung sollte auffallen und der Betrachter sollte sich identifizieren können.
Kunsterhaltung
Joseph Goebbels, späterer Reichspropagandaminister, sprach sich anfangs, bis 1939, für die Erhaltung der Kunst und die Kulturschaffung in Deutschland aus. So war er interessiert, bedeutende Künstler wie Richard Strauß im Reich zu behalten. Wobei das Interesse an den Leistungen dieser Künstler mal dahingestellt sei. Bei der Gründung der Reichskammer der bildenden Künste 1933 verspricht Goebbels keine Gesinnungsriecherei gegenüber Kunstschaffenden. Auch wisse er, daß es bei der Kunst nicht darauf ankomme, was man will, sondern was man kann. Leider stimmte dieser Satz mit der nationalsozialistischen Kunstschaffung nicht überein.
Ausstellung
Trotzdem sah man direkt am Anfang schon die Kunst als entartet an und begann mit der Kunstvernichtung. So wurde der Partei durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums die Möglichkeit gegeben, unliebsame Museums- oder Galeriedirektoren zu entlassen. Die erste Kunstausstellung fand im Herbst 1933 statt. Man versuchte den deutschen Expressionismus zu erhalten. So gab es eine Ausstellung mit Macke, Nolde und Heckel, die allerdings nach 3 Tagen wieder geschlossen wurde. Emil Nolde sei negroid, pietätlos, roh und bar jeder inneren Formkraft. Nicht nur ihm wurden tückische Attacken gegen den ,,Arier" Jesus vorgeworfen. Noch mehrmals zeigte man die Werke der Expressionisten. Doch ließ man den Besucher nicht hilflos das Kunstwerk betrachten, sondern gab ihm einen wertenden Ausstellungsführer mit. Auch schon der Name der Ausstellung verriet einiges. So z.B.: ,,Kunst im Dienste der Zersetzung" oder ,,Verfallskunst seit 1910". Seit 1935 gab es Schandausstellungen, in denen man Werke von z.B. Liebermann, Munch, Beckmann und Dix fand. Diese sogenannten Schandkollektionen hatten NS-Künstler aus ganz Deutschland zusammengetragen. Dabei kamen etwa 5000 Gemälde und 12000 Graphiken zusammen. 1936 gab es eine deutliche politische Radikalisierung, die sich auch stark auf die Kunst auswirkte. Kunstzeitschriften, die nicht antisemitisch genug waren, wurden verboten, NS-Künstler durften nur Parteimotive malen.
Entartete Kunst
Am 19.Juli 1937 wurde die größte Ausstellung über ,,Entartete" Kunst eröffnet. Die Ziele waren, anhand von Originaldokumenten Einblick in den grauenhaften Kulturzerfall zu geben und die gemeinsamen Wurzeln von politischer und kultureller Anarchie aufzuweisen. Um die Bedeutsamkeit dieser Ausstellung hervorzuheben, war der Eintritt für Jugendliche verboten und ansonsten gratis. In dem Ausstellungsführer wurden die einzelnen Kunstwerke mit kommentierenden Texten versehen, so heißt es zum Beispiel neben dem Bild eines abstrakten Katzenkopfes aus Stein: ,,Wenn ein unheilbar Irrsinniger, ein Dilettant wohlgemerkt, eine Katze formt, so sieht das etwa so aus." Man hatte die Werke in acht Gruppen eingeteilt, deren Name schon einiges aussagte: Kein Form- und Farbempfinden, Hohn auf Christliches, Politisch falsch, Antikriegsmalerei, verletzte Moral, Juden, kein Rassebewußtsein, Verhöhnung geistigen Ideals. Bedeutende Künstler in dieser Ausstellung waren Beckmann, Dix, Nolde, Ernst, Feininger, Kandinsky, Klee, Kokoschka, Nay.
Danach
Nach dieser Ausstellung wurden die Kunstwerke verkauft, meistens in die Schweiz, oder verbrannt. So fand am 27. Mai 1943 in Paris eine Bilderverbrennung statt. Hier wurden ,,nur" 500 Werke der insgesamt 100000 aus ganz Europa zusammengeraubten Kunstwerke dem Feuer überlassen.
Parteikunst
Kunstart
Neben den Zeitschriften über ,,Entartete Kunst", gab es auch solche über die ,,deutsche Kunst im Sinne des Staates". Diese Blätter stammten meistens von der NS-Kulturgemeinde, die diktatorisch vorgab, ob ein Kunstwerk gut oder schlecht, ästhetisch oder unästhetisch, künstlerisch oder nicht sei. Die Malerei hatte den Zweck bekommen, Staatsziele oder nationalsozialistische Ideen auszudrücken. Dabei kam es weniger auf das Können, sondern auf die Aussagekraft eines Kunstwerkes an. Bilder, auf denen der Führer oder Parteisymbole zu sehen waren, wurden nicht selten mit Anerkennungen belohnt.
Motive
Im 3. Reich gab es einen Naturalismus in der Malerei, der auf der naturalistischen Auffassung beruhte. Es sollte das freie und natürliche Leben dargestellt werden. Städtemalerei gab es überhaupt nicht. Ein häufiges Bildthema war die Technik, die ziemlich verabsolutiert dargestellt wurde. Meistens handelte es sich hierbei um Waffen oder andere Kriegsmittel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Die Malerei im Nationalsozialismus"?
Der Text behandelt die nationalsozialistische Einstellung zur Kunst, insbesondere zur modernen Kunst, die als "entartet" betrachtet wurde. Er untersucht die Gründe für diese Ablehnung, die Rolle von Hitlers "Mein Kampf", Antisemitismus und die Ansichten von Persönlichkeiten wie Rosenberg. Der Text beschreibt auch die Maßnahmen des Staates zur Verfolgung und Vernichtung dieser Kunst und zur Förderung einer Kunst, die den nationalsozialistischen Idealen entsprach.
Welche Rolle spielte Hitlers "Mein Kampf" bei der nationalsozialistischen Kunstauffassung?
Hitler begründete in "Mein Kampf" die Entstehung einer Kultur mit der Unterjochung niederer Völker durch die Arier. Diese Völker sollten als technisches Instrument einer werdenden Kultur dienen. Dies trug zur ideologischen Grundlage für die Ablehnung moderner Kunst bei.
Wie beeinflusste der Antisemitismus die Ablehnung moderner Kunst?
Hitler und andere Nationalsozialisten brachten moderne Kunst immer wieder mit dem Judentum in Verbindung, das sie als Förderer der "Niggerkunst" und unfähig zur Schaffung bildender Kunstwerke betrachteten. Sie sahen in Kubismus und Dadaismus eine jüdische "Infektion" im Bereich der bildenden Künste.
Was waren die Ansichten von Rosenberg zur modernen Kunst?
Rosenberg sah den Beginn der Kunstentartung im Impressionismus und den Expressionismus als Ausdruck eines allzersetzenden Intellektualismus. Er betrachtete den Expressionismus als feindlich, da er eigene Gedanken zuließ, was für die Nationalsozialisten gefährlich war.
Welche Maßnahmen ergriff der Staat gegen "entartete Kunst"?
Der Staat entließ unliebsame Museums- und Galeriedirektoren, organisierte Ausstellungen, die moderne Kunst verunglimpften (z.B. "Kunst im Dienste der Zersetzung"), verbot nicht-antisemitische Kunstzeitschriften und förderte NS-Künstler, die Parteimotive malten. 1937 wurde die große Ausstellung "Entartete Kunst" eröffnet, gefolgt vom Verkauf oder der Verbrennung der Kunstwerke.
Was waren die Ziele der Ausstellung "Entartete Kunst"?
Die Ziele waren, Einblick in den "grauenhaften Kulturzerfall" zu geben und die gemeinsamen Wurzeln von politischer und kultureller Anarchie aufzuweisen. Die Kunstwerke wurden mit kommentierenden Texten versehen, um sie zu diskreditieren.
Welche Kunstart wurde im Nationalsozialismus gefördert?
Es wurde ein Naturalismus gefördert, der das freie und natürliche Leben darstellen sollte. Beliebte Motive waren gesunde Menschen, Familien, Bauern, Arbeiter, die Natur und Krieg. Bilder mit dem Führer oder Parteisymbolen wurden oft belohnt.
Welche Rolle spielten Kulturzeitschriften im Nationalsozialismus?
Die NSDAP verfügte über viele Zeitungen und Zeitschriften, darunter auch solche im Kulturbereich. Diese enthielten oft antisemitische Karikaturen und Zeichnungen, um die Ideologie der Partei zu verbreiten.
Welche Motive waren in der Malerei des 3. Reiches beliebt?
Beliebte Motive waren der Mensch mit einem gesunden Körper, die Familie, Bauern und Arbeiter als Symbol des Schaffens, die Natur und Kriegsdarstellungen, die oft Verwundete zeigten, denen von Kameraden geholfen wird.
Wie ging man nach der Ausstellung "Entartete Kunst" vor?
Nach der Ausstellung wurden die als "entartet" eingestuften Kunstwerke entweder ins Ausland verkauft, meist in die Schweiz, oder öffentlich verbrannt, um sie der Öffentlichkeit zu entziehen.
- Quote paper
- Oliver Droop (Author), 1995, Malerei im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97179