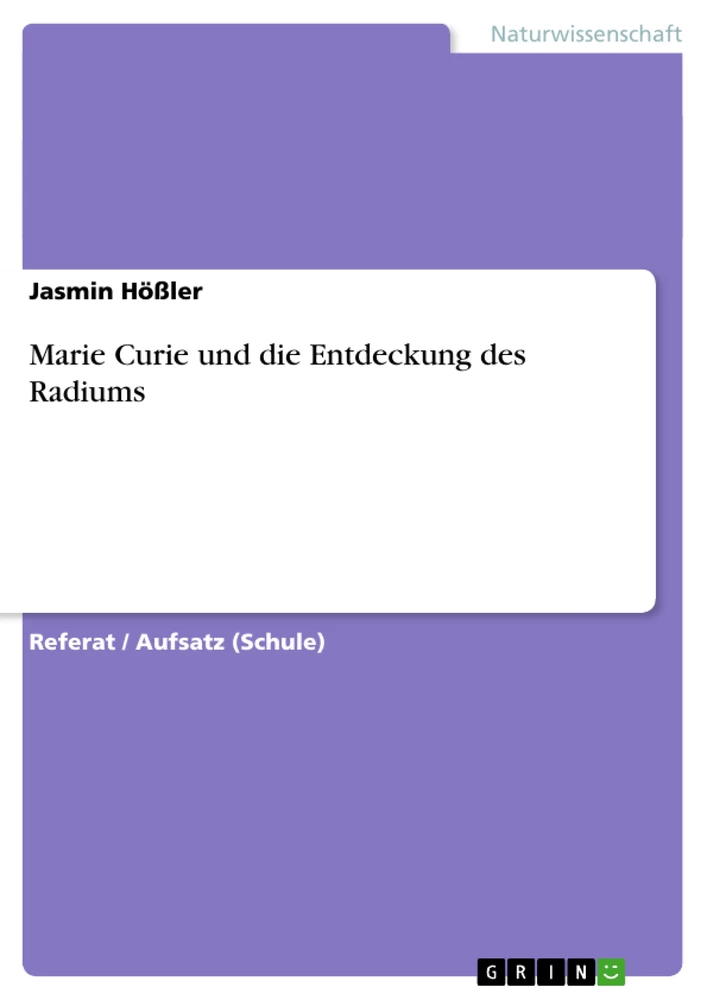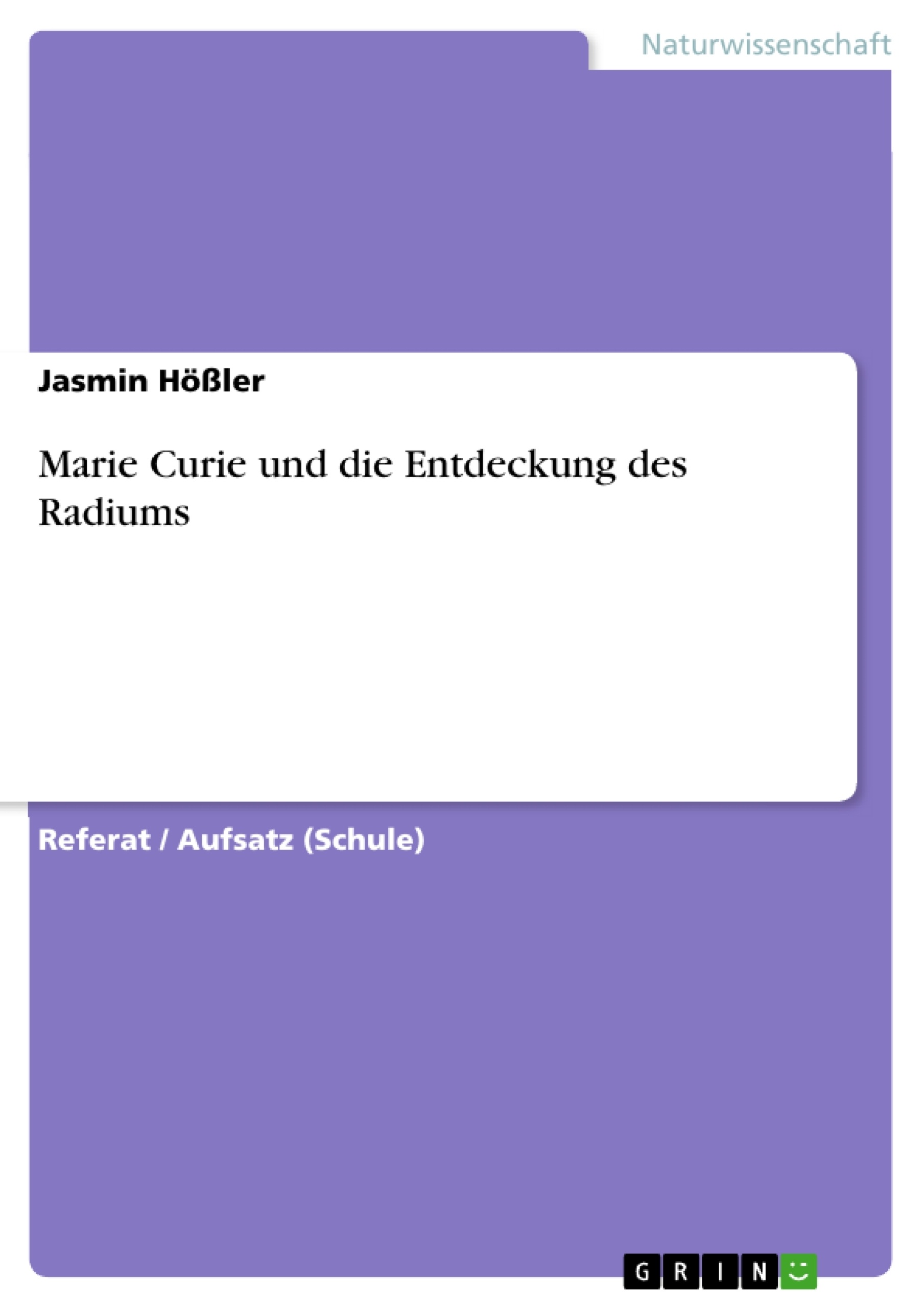Eine fesselnde Reise in das Leben einer außergewöhnlichen Frau, deren Name untrennbar mit wissenschaftlichem Fortschritt und menschlicher Tragödie verbunden ist: Marie Curie. Tauchen Sie ein in die Welt einer jungen Polin, die, getrieben von unstillbarem Wissensdurst, Armut und gesellschaftliche Barrieren überwindet, um in Paris eine bahnbrechende wissenschaftliche Karriere zu verfolgen. Erleben Sie, wie sie an der Seite ihres genialen Ehemanns Pierre Curie die Geheimnisse der Radioaktivität entschlüsselt, eine Entdeckung, die die Medizin revolutioniert und ihnen den Nobelpreis einbringt. Doch der Ruhm hat seinen Preis: Die gefährliche Arbeit mit radioaktiven Substanzen fordert ihren Tribut, und ein tragischer Unfall reißt Pierre aus dem Leben. Marie bleibt als Witwe zurück, gezeichnet von Verlust und Krankheit, aber unerschütterlich in ihrem Engagement für die Wissenschaft. Dieses Buch ist mehr als eine Biografie; es ist eine Hommage an eine Pionierin, die sich in einer von Männern dominierten Welt behauptet, eine Liebesgeschichte zwischen zwei brillanten Köpfen und eine Mahnung an die ethischen Fragen, die mit wissenschaftlichem Fortschritt einhergehen. Entdecken Sie die verborgenen Facetten von Marie Curies Persönlichkeit, ihre innere Stärke und ihre unermüdliche Hingabe an die Forschung, die sie zu einer der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen aller Zeiten machten. Folgen Sie ihrem Weg von einer bescheidenen Kindheit in Polen bis zur internationalen Anerkennung, von den ersten unscheinbaren Experimenten bis zur Entdeckung des Radiums, von persönlichem Leid bis zu wissenschaftlichen Triumphen. Lassen Sie sich von Marie Curies Geschichte inspirieren, einer Geschichte von Mut, Ausdauer und dem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Wissenschaft. Erleben Sie die Höhen und Tiefen ihres Lebens, ihre Kämpfe und Erfolge, ihre Liebe und ihren Verlust, und erfahren Sie, wie sie die Welt für immer veränderte. Eine tiefgründige und bewegende Darstellung über eine Frau, die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Bild der Frau in der Wissenschaft nachhaltig prägte. Schlüsselwörter: Marie Curie, Pierre Curie, Radioaktivität, Nobelpreis, Wissenschaftlerin, Biografie, Polen, Paris, Forschung, Radium, Polonium, Frauen in der Wissenschaft, Geschichte, Medizin, Physik, Chemie, Atom, Entdeckung, Tragödie, Liebe, Hingabe, Krieg, Innovation, Strahlung, Krebs, Sklodowska, Sorbonne, Labor, Experimente, Gesundheit, Vermächtnis.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Eine Kindheit in Polen
- Der Weg in die Freiheit
- Studieren in Paris
- Pierre Curie
- Die Suche nach dem Erfolg
- Die fruchtbare Zeit der Arbeit
- Die ersten Entdeckungen
- Die Entdeckung des Radiums
- Das Radium und seine Folgen
- Der Nobelpreis
- Der 19. April 1906
- Die Witwe
- Die Erinnerung bleibt
- Anhang (Fotos)
Vorwort
Marie ist eine Frau, sie gehört einer unterdrückten Nation an, sie ist arm, sie ist schön. Eine innere Berufung läßt sie Polen, ihre Heimat, verlassen, um in Paris zu studieren, wo sie Jahre der Einsamkeit, der Schwierigkeiten durchlebt.
Sie begegnet einem Mann, der ein Genie ist wie sie selbst. Sie heiratet ihn. Ihr Glück ist einzigartig.
Die härteste erbittertste Anspannung läßt sie eine magische Substanz entdecken, das Radium Ihre Entdeckung schenkt nicht nur einer neuen Wissenschaft, einer neuen Philosophie das Leben; sie bringt der Menschheit die Möglichkeit, eine furchtbare Krankheit zu bekämpfen. In dem Augenblick, in dem der Ruhm der beiden Gelehrten sich auf der Welt verbreitet, fällt ein schwarzer Schatten auf Marie. Der wunderbare Gefährte wird ihr mit einem Schlag durch den Tod entrissen.
Trotz der Not ihres Herzens, der körperlichen Leiden, setzt sie das begonnene Werk fort, entwickelt sie glanzvoll sie Wissenschaft, die sie beide begonnen haben. Der Rest ihres Lebens ist nichts als immerwährende Hingabe.
Den Kriegsverwundeten widmet sie ihre Opferkraft, ihre Gesundheit. Später einmal wird sie ihren Rat, ihr Wissen, jede Stunde ihrer Zeit ihren Schülern, den künftigen Wissenschaftlern geben, die aus der ganzen Welt kommen.
Als die Mission erfüllt ist, stirbt sie, erschöpft; den Reichtum hat sie abgelehnt, die Ehrungen hat sie mit Gleichmut über sich ergehen lassen.
Eine Kindheit in Polen
Maria Salomee, wie sie getauft werden sollte, wurde ohne besondere Komplikationen in dem Schlafzimmer einer kleinen Wohnung in Warschau geboren, in einer der Straßen mit Kopfsteinpflaster, die von der mit roten Backsteinzinnen bekrönten Stadtmauer ausgehen. Neben dem Eingang des Hauses in der Fretastraße befindet sich eine Tafel, die an ihre Geburt erinnert-den 7.November 1867.
Maria Sklodowska, die später als Marie Curie bekannt wurde, gehörte einer Generation an, die den Kampf um die Existenz der Nation Polens als etwas Alltägliches akzeptiert hatte. Als Kind brauchte sie von der Tür aus nur ein paar Schritte zu dem Platz zu gehen, wo in Jahre 1656 die Bürger von Warschau niedergemetzelt worden waren, als die ihre Heimat gegen die Schweden verteidigten.
Maria mußte als jüngstes Familienmitglied im Eßzimmer schlafen und das Sofa morgens um sechs aufgeräumt haben.
Sie war ein schüchternes Kind, klein und nervös, aber altklug für ihre Jahre, so sagte man. Das bedeutete wahrscheinlich, daß sie über eine vernünftige Denkweise verfügte, die auf Menschen, die sie weniger gut kannten, wie eine gewisse Kälte gewirkt haben mag. Das war ein Teil ihres Erbes; von ihrem Vater hatte sie nicht nur den Verstand und die Genauigkeit, sondern auch ein nach innen gerichtetes Wesen und die Bereitwilligkeit, Konventionen zu übernehmen. Von ihrer Mutter zeigte sich dieser außerordentlich starke Zug besonders kraftvoll in ihrer religiösen Haltung.
Die Intensität, mit der sie täglich ihrem katholischen Glauben huldigte, beeindruckte das kleine Mädchen. In den wohlbesuchten Stadtkirchen entwickelte Madame Sklodowska öffentlich eine kompromißlose Güte und Pflichterfüllung.
Maria bewunderte ihre Mutter wegen dieser Charaktereigenschaften.
Ihr ganzes Leben lang litt Maria an Anfällen von Scheuheit und Schüchternheit.
Als sie noch ein Kleinkind war, hatte man sie vor ihre Klasse gestellt und sie ihr neuerworbenes Russisch vortragen lassen, zu Ehren eines streng blickenden, russisch sprechenden Schulinspektors; das Trauma dieser harmlosen Erfahrung blieb ihr das ganze Leben lang. Die schüchternen Verhaltensweisen und sensiblen Reaktionen waren in Wirklichkeit nur äußere Symptome tieferer nervöser Störungen. Es gab Zeiten, in denen sie unter der Anspannung zusammenbrach.
Der Weg in die Freiheit
Die ersten Schritte ihrer Erziehung waren von den vielen Lehrern, die zu ihrer Familie gehörten, geleitet worden, dann hatte sie kleine private Erziehungseinrichtungen besucht und schließlich die staatlichen Institutionen Warschaus durchlaufen. Triumphierend und mit einer Goldmedaille belohnt ging sie daraus hervor.
Ihre beiden Schwestern planten im Sinne der Familientradition eine Laufbahn als Lehrerinnen, und ihr Bruder Jozef studierte Medizin. Die Knabengymnasien in Polen lehrten als Hauptfächer Russisch, Latein und Griechisch, und gute Noten in diesen Fächern gaben den Schülern das Recht, sich entweder um die Aufnahmeprüfung an der Universität zu bewerben oder an Aufnahmeprüfungen für eine der technischen Hochschulen des Russischen Reiches teilzunehmen.
Es gab jedoch nicht die entfernteste Chance einer höheren Bildung für Frauen. An den polnischen Mädchenoberschulen wurden keine klassischen Sprachen gelehrt, und so waren die polnischen Frauen automatisch davon ausgeschlossen, die Zutrittsvoraussetzungen für die Universitäten des Reiches zu erwerben.
Die einzige Lösung bestand darin, das Land zu verlassen und an einer ausländischen Universität ein Examen zu machen.
Am stärksten war Maria von Physik und Mathematik begeistert.
Für sie gab es ein einziges, eigensinniges Ziel: sie wollte lernen. Doch die Umstände schienen sich dagegen verschworen zu haben, aus dieser ihrer Fähigkeit das Beste zu machen. Sie hatte weder die Vorbereitung zum Baccalauréat noch die sieben Jahre Lycée, die dazu gehörten, absolviert. Überdies gab es andere Nachteile eines naturwissenschaftlichen Studiums in Paris, die sie nicht wissen konnte.
Studieren in Paris
Im zarten Alter von 17 Jahren versuchte sie sich als Lehrerinn, und unterrichtete gegen ein kleines Entgeld die Kinder der reichen Familien. Den größten Teil des Geldes schickte sie nach Hause, um das Studium ihrer Schwester Bronia zu finanzieren. Wenn diese fertig ist mit ihrem Studium, sollte Maria Geld von ihr bekommen.
1894 hat Maria Slodowska endlich die Möglichkeit zu studieren. Über drei Jahre lang führte sie dann ein Leben, welches einzig und allein dem Studium gewidmet ist. Die Armut in ihrer Studentenzeit war kaum zu ertragen.
Der Tag im Jahre 1893, an dem sie ihr Abschlußexamen begann, war, wie sie wußte, eine Prüfung fürs Leben. Ein Scheitern würde die Rückkehr nach Polen und Gouvernantenschaft bedeuten. Doch sie war erfolgreich.
Als ,, licenci é e è s sciences physiques" nahm sie den ersten Platz ein - kein schlechter Abschluß für ein nervöses Mädchen, das drei Jahre zuvor keine geregelte naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt hatte.
Der Triumph der Jahre 1891-1893 war zwar durch eine eiserne Selbsdisziplin unter strengem Abschluß persönlicher Beziehungen errungen worden, aber das Jahr 1894 erlaubte, zweifellos als Ergebnis des Erfolgs im Physikexamen, eine gewisse Lockerung. Sie war jetzt 26 Jahre alt, und ihr Gewinn war beträchtlich.
Während ihres Studiums hatte sie öfters die Möglichkeit gehabt, in einem Laboratorium zu experimentieren.
Ihre Liebe zur Physik war geboren, es war eine glühende Liebe, die ein Leben lang anhielt.
Pierre Curie
Sie lernte Pierre Curie in der Wohnung eines polnischen Physikers kennen, der sich in Paris aufhielt. Pierre war groß, hatte einen Bürstenhaarschnitt, kastanienbraun, und trug einen kleinen Spitzbart. Sie hielt ihn für einen jungen Mann, obwohl er weder jung aussah noch war: in Wirklichkeit war er 35 Jahre alt. Sie hatten die gleichen Ansichten und Interessen. Er war Physiker und hoch gebildet, zwei Ziele, nach denen Marie leidenschaftlich strebte. Schon bald nach ihrer ersten Begegnung im April 1894 veröffentlichte er einen Bericht, der seine letzte Arbeit beschrieb: es war nur einer in einer bereits herausragenden Reihe von physikalischen Studien. Die junge Studentin, der die Veröffentlichung von experimentellen Ergebnissen als die höchste Blüte der Vollendung erscheinen mußte, dürfte von Curies Ehre, seine Arbeiten in den Berichten der Académie des Sciences zu publizieren, tief beeindruckt gewesen sein. An den oberen Rand eines Sonderdrucks schrieb er die Widmung: "Für Mademoiselle Sklodowsksa, in Hochachtung und Freundschaft, vom Autor P. Curie." Der Titel war ,,Über Symmetrie in physikalischen Erscheinungen. Symmetrie in einem elektrischen Feld und in einem magnetischen Feld."
Sie interessierte sich stark für das, was er machte, und sie begann, sich ebenfalls für das zu interessieren, was er war. Er war der Sohn eines humanistischen Arztes und hatte sich leicht und mühelos in naturwissenschaftliche Gegenstände eingearbeitet. Pierre war 21, als er gemeinsam mit seinem Bruder Jacques als Physiker zu arbeiten begann. Am 26.Juli 1895 heirateten sie, jedoch arbeiteten beide an ihrer Zukunft weiter.
Die Suche nach dem Erfolg
Maries Schwester Bronia hatte eine ärztliche Praxis übernommen, und Marie konnte sie außerhalb der Sprechzeiten für ihre eigene Zwecke benutzen. In der Zwischenzeit nahm sie in einem Laboratorium der Sorbonne ernsthafter die experimentelle Physik wieder auf, um sorgfältig nach einem Gegenstand Ausschau zu halten, der für eine Doktorarbeit geeignet wäre.
Ihr gemeinsamer wissenschaftlicher Traum war einfach, und in jenen idylischen Tagen gab es kein Hindernis für ihn. Pierre bereitete seine Kurse an der Hochschule für Physik und Chemie mit großer Sorgfalt vor, und als sie ihm bei dieser Arbeit half, stellte Marie fest, daß sie viel von seiner ausgiebigen theoretischen und praktischen Erfahrung als Physiker lernen konnte. Das ergab eine solide Grundausbildung für die Forschung, die sie gerade begann. Sie erhielt die Erlaubnis, in der Schule zu arbeiten, so daß sie an der Seite ihres Mannes sein konnte.
Aber für die finanzielle Sicherung der Forschung, die sie sich vornahm, wollte sie selbst verantwortlich sein. Es handelte sich um eine Studie darüber, wie die magnetischen Eigenschaften von Stahl bei verschiedenen Temperaturen je nach der chemischen Zusammensetzung variieren. Sie konnte sich auf die Direktoren verschiedener metallverarbeitender Betriebe verlassen, die ihr kostenlose Proben von Stahlsorten überließen, sowie auf den Professor der Hochschule für Bergbau, den hervorragenden Vertreter der physikalischen Chemie Henrie le Chatelier, der ihr weitere Proben besorgte und bei den chemischen Analysen half. Der Gegenstand, den sie erforschte, der Magnetismus, war natürlich ein Bereich, in dem ihr Mann bereits eine führende Autorität war, und so hatte sie für ihre erste Entdeckungsreise in unbekannte Gebiete der Wissenschaft einen führenden französischen Chemiker, der ihr die linke Hand hielt, und einen führenden französischen Physiker, der ihre rechte hielt.
Ihr erster Bericht, der im Herbst 1897 abgeschlossen wurde, war überlang und nicht besonders originell, er war indessen außergewöhnlich sorgfältig abgefaßt und zeigte, daß die junge Frau ebenso fähig war wie irgend ein anderer Arbeiter auf diesem Feld, viele Stunden lang mit ausdauernder Hingabe am Labortisch die Details des gewählten Problems gewissenhaft zu beobachten. Wenn nichts sonst, so hatte sie sich in der Art und Weise geübt, wie sie eine künftige physikalisch - chemische Arbeit angreifen würde.
Die erste Bedrohung ihrer Gewohnheiten trat ein, als Marie feststellte, daß sie ein Kind erwartete. Von Anfang an hatte sie eine schwierige Schwangerschaft und ärgerte sich sehr über die Übelkeit, die oft den ganzen Tag anhielt und sie am Arbeiten hinderte. Am 12. September wurde sie durch Pierres Vater Eugène Curie von einer Tochter entbunden, Irène.
Wenn Marie ihre Laufbahn fortsetzen wollte, mußte ein Dienstmädchen angestellt werden. Die Probleme, denen die gebildete arbeitende Mutter mit ihrem Kind entgegensah, waren gewaltig. Es gab nur wenige weiblich Laboratoriumsphysiker, die ihre Karriere nach dem ersten Examen fortgesetzt hatten, aber selbst in der liberaleren Atmosphäre Frankreichs wurde es als außergewöhnlich, wenn nicht als verantwortungslos betrachtet, wenn eine junge Mutter sich in dieser Weise nur wenige Wochen nach ihrer Wiederherstellung betätigte. Aber in Bezug auf ihre wissenschaftliche Zukunft war Marie Curie eigensinnig. Nun blieb nur noch, den Gegenstand der Dissertation zu suchen. Das sollte die wichtigste Entscheidung ihres wissenschaftlichen Lebens sein. Es sollte nicht nur ihre weitere Laufbahn, sondern auch ihr Privatleben und das ihres Mannes bestimmen
Die fruchtbare Zeit der Arbeit
Im Jahre 1897 wäre die neueste Entdeckung der Röntgenstrahlen von Wilhelm Röntgen offensichtlich ein Feld für Marie Curie gewesen, auf dem sie für ihre Promotion hätte arbeiten können, aber sie lehnte es ab.
Der Effekt, den sie untersuchen wollte, war, wie so oft, wenn eine neue breite Front wissenschaftlicher Untersuchungen eröffnet wird, von zwei Männern beobachtet worden, die gleichzeitig und unabhängig von einander in verschiedenen Laboratorien arbeiteten. Die experimentelle Methode bestand darin, eine Photoplatte und ihre Aluminiumabdeckung mit dem Uransalz auf das Fensterbrett des Laboratoriums zu legen , um Sonnenlicht einzufangen. Wenn man die Platte entwickelte, entdeckte man, daß sie an der Stelle, auf der das Uransalz gelegen hatte, geschwärzt war. Es war mehr als überraschend, daß das Uran die Platte trotz des dicken Aluminiumschutzes beeinflussen konnte. Henrie Becquerel und Silvanus P. Thompson machten diese Entdeckung.
Am 26. Und 27. Februar 1896 hatte Becquerel einige Photoplatten in schwarzen Stoff gewickelt, sie mit Aluminium abgedeckt und einige Kristalle Kalium-Uranylsulfat auf das Aluminium gelegt. Da es ein trüber Tag war und er vor allen daran interessiert war, die Wirkung des Sonnenlichtes auf die Kristalle zu beobachten, legte er die Platten mit den Kristallen in eine Schublade und machte sie zu. Aus irgendeinem Grund beschloß er sie drei Tage später aus der Schublade zu nehmen, sie auszupacken und sie unverzüglich zu entwickeln.
Er war reichlich verblüfft, als er sah, daß sie an den Stellen, wo sie von den Kristallen bedeckt gewesen waren, deutlich dunkle Stellen zeigten.
Somit konnte er die Entdeckung verkünden, daß Uransalze Strahlen aussenden, die, wie die Röntgenstrahlen, die Materie durchdringen. Becquerel hatte die Radioaktivität entdeckt.
Zu diesem Zeitpunkt beschloß Marie Curie, die Uranstrahlen als mögliches Feld für ihre Dissertation zu betrachten. Die interessante Frage war: Woher nahm die Uranverbindung die Energie, mittels derer sie fotografische Emulsionen durch verschiedene Lagen von Schutzpapier, selbst durch Metall hindurch schwärzte?
Die Curies betrachteten das Problem. Das erste Problem, das sie lösen mußten, war die Frage nach einem Arbeitsplatz. Marie brauchte ein Laboratorium. Ein offensichtlich geeigneter Ort war die Hochschule für Physik und Chemie.
Curie fand einen kleinen verglasten Raum im Erdgeschoß der Schule, der teilweise als Lagerraum und teilweise zur Aufbewahrung vor Laborapparaten diente. Es war klar, daß die Experimente, die sie vorhatten, nur ein Minimum an billiger Ausstattung erfordern würden, und es muß auch deutlich gewesen sein , daß ihre Chancen , die Promotion abzuschließen, minimal waren.
Der hauptsächliche Nachteil des Raumes war seine Feuchtigkeit. Ganz abgesehen von der Ungemütlichkeit war dies eine ernsthafte Behinderung für die elektrostatischen Experimente, die sie durchführen wollte.
Die ersten Entdeckungen
Sie begann damit nach anderen Substanzen außer Uran zu suchen, die die Luft zu einem Leiter von Elektrizität machen können. Von Bekannten aus der Hochschule für Chemie und Physik und in ihrer Umgebung erbettelte und lieh sie so viele Proben von Metallen, Metallverbindungen und Mineralen, wie sie bekommen konnte. Das Grundexperiment war einfach. Die jeweilige Substanz legte sie auf eine Metallplatte, der gegenüber sich eine weitere , einen Kondensator bildende Metallplatte befand und benutzte ihr Elektrometer
(Elektroskop: elektrostatisches Instrument zum Nachweisen elektrischer Ladungen auf isolierten Körpern), um festzustellen, ob durch die Luft zwischen den Platten Strom floß. Auf diese Weise konnte sie rasch Dutzende von Stoffen mit jener Sorgfalt erproben, die zu der wissenschaftlichen Methoden gehörte, von der sie bereits besessen war. In kurzer Zeit hatte sie die ersten Ergebnisse. Sie fand heraus, daß Thorium und seine Verbindungen bewirkten, daß die Luft Elektrizität leitete, und Strahlen aussendeten, die, soweit sie beurteilen konnte, von derselben Art waren, wie Becquerel sie am Uran beobachtet hatte. Das war ein kleiner Triumph. Die Entdeckung machte sie wenige Tage nach dem Beginn ihrer Experimente: Kein Forscher, der mit der Arbeit für seine Dissertation beginnt, konnte auf mehr Glück hoffen. Sofort begann sie mit einer weiteren systematischen Untersuchung und benutzte nun das Elektrometer, um die Stärke des Stroms zu messen, der von den verschiedenen Verbindungen von Uran und Thorium verursacht wurde. Es spielte überhaupt keine Rolle, ob das Uransalz feucht oder trocken war, ob in Klumpen oder pulverförmig, noch welche anderen Elemente in dem Salz enthalten waren. Das war eine hochbedeutende Information, wie bedeutend, konnte sie in diesem Augenblick noch nicht erkennen, aber es wurde ihr zu gegebener Zeit deutlicher.
Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist dies die wichtigste Arbeit von Marie Curie und nicht die anderen Entdeckungen, durch die sie wesentlich berühmter werden sollte. Sie brachte nämlich den Beweis, daß die Strahlung nicht die Auswirkung irgendeiner Interaktion zwischen den Molekülen war, die sich zu neuen Gestalten umformen, wie in einer üblichen chemischen Reaktion, wo Energie, wie etwa Licht oder Hitze, als Produkt einer solchen Reaktion abgegeben wird. Die Strahlungsenergie hat einen anderen Ursprung und muß von dem Atom selbst herrühren, unabhängig davon, welche Verbindung das Atom hat und wie es sich verhält: Die Strahlung muß eine Eigenschaft des Atoms sein. Von dieser einfachen Entdeckung her konnte die Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts die Atomstruktur erhellen, und aus der Kenntnis der Atomstruktur resultierten alle praktischen Folgen ihrer Spezifizierung.
In die Messung der Leitfähigkeit von Luft aufgrund Uranhaltiger Stoffe schloß sie in ihre systematischen Studien auch zwei Uranminerale ein, Pechblende
(Pechblende: Uranpecherz, wichtigstes Uranerz, enthält bis zu 95% Uranoxid. Ausgangsstoff für die Reindarstellung von Uranisotopen und Radium)
und Chalkolit. Das Elektrometer zeigte, daß Pechblende viermal so aktiv wie das Uran selbst war, Calkolit war doppelt so aktiv. Sie kam zu dem Ergebnis, daß, wenn ihre früheren Messungen, die den Urangehalt und die Aktivität miteinander zu verbinden suchten, richtig waren - und das waren sie - diese beiden Minerale geringe Mengen eines anderen Stoffes enthalten mußten, der weit aktiver als Uran selbst sein mußte.
Offensichtlich hatte Marie Curie bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ihrer Karriere erkannt, daß ihre Rolle als Physikerin ungewöhnlich schwer zu handhabende Probleme mit sich bringen würde, darunter den Unglauben oder Zweifel mancher Wissenschaftler an der Fähigkeit einer Frau, eine derart originäre Arbeit zu leisten.
Am 12. April 1898 legte sie ihren Bericht, der kurz und bewundernswert einfach von ihrer Arbeit Rechenschaft ablegte, dem früheren Professor Gabriel Lippmann vor. Doch es war zu spät. Durch einen bemerkenswerten und herzzerreißenden Zufall war sie , gerade wie
Thompson von Becquerel geschlagen worden, im Wettbewerb darum geschlagen worden, wer als erster die Entdeckung bekannt gab, daß Thorium in derselben Weise wie Uran Strahlen aussendet. Ohne ihr Wissen hatte der Deutsche Gerhard Schmidt zwei Monate früher in Berlin sein Ergebnis publiziert.
Die Entdeckung des Radiums
Das unerschütterliche Interesse , das die Curies ihrem Laboratorium widmeten, begann, sie wunderbar zu belohnen.
Sie lösten die zerstoßene Pechblende in einer Säure auf und trennten ihre verschiedenen Elemente mittels der Standardtechniken der analytischen Chemie, die damals zugänglich waren. Marie Curie übernahm die Rolle einer Chemikerin und brachte sich die Fertigkeiten für die endlos wiederholten und langweiligen Tätigkeiten bei, die diese Art der Trennung erfordert.
Ihre Vermutung, daß die Pechblende eine kleine Menge einer Substanz enthält, die eine weit höhere Aktivität als Uran aufweist, wuchs bei jedem Stadium der Trennung und Reinigung. Zum Schluß war es deutlich, daß sie diesen Stoff von allem übrigen außer von einem einzigen Element trennen konnte: Bismut.
Am selben Tag füllten Pierre und Marie eine winzige Probe des Bismutsulfides, das sie gesammelt hatten, in eine Glasröhre und begann, sie nach und nach zu erhitzen. Sie beobachteten, wie das Bismutsulfid in den heißeren Teilen der Röhre verblieb, während sich bei 250-300° ein feines schwarzes Puder am Glas absetzte. Die Röhre wurde so lange erhitzt, bis sie zersprang.
Sie hatten gefunden, was sie brauchten. Pierrre kratzte das schwarze Pulver von der Röhre ab und maß seine Aktivität. Schließlich hatten sie Probe produziert, deren Aktivität 330mal größer war als die des Uran.
Bis zum 27. Juni 1898 stellte Marie Stoffe her, die etwa 300mal aktiver waren, und vermerkte den Triumph mit immer kühneren Strichen in ihrem Notizbuch.
Es gab jetzt keinen Zweifel mehr, sie hatte ein neues Element entdeckt.
Jedesmal, wenn sie wieder ein wenig Bismut entfernt hatte, zeigte die neue Substanz noch dramatischer ihre Anwesenheit. Sie schrieben in einem Bericht, den sie rasch für die Veröffentlichung vorbereiteten: "Wenn die Existenz dieses neuen Metalls bestätigt wird, schlagen wir vor, es Polonium zu nennen, nach dem Namen des Vaterlandes des einen von uns."
In diesem Bericht benutzten die Curies zum ersten Mal das Wort radioaktiv, um das Verhalten von uranähnlichen Stoffen zu beschreiben.
Zu der Zeit war Marie Curie sicher, Polonium werde ihre große Entdeckung sein, und aus diesem Grunde hatte sie ihm den Namen vorbehalten, der ihr am liebsten war. Doch Pierre kam zu der Erkenntnis, daß hinter dem Polonium noch etwas anderes lag, wonach sie weiter graben mußten.
Sie hatten die bedeutsame Tatsache entdeckt, daß, wenn Bismut und Polonium ausgeschieden waren, die verbleibende Flüssigkeit immer noch hochgradig radioaktiv war. Einfache Tests zeigten, daß dies weder auf das Uran noch das Polonium zurückzuführen war, die ja beide ausgesondert waren. Die wesentliche Unreinheit der Flüssigkeit war auf Barium zurückzuführen, einem wohlbekannten Element, das bekanntlich nicht radioaktiv ist. Es mußte also nicht ein, sondern zwei zuvor unbekannte und unerwartete Elemente in ihre Pechblendenprobe geben.
Durch mehrfaches neues Lösen und Kondensieren kamen sie schließlich zu einem Stoff, dessen Radioaktivität nicht weniger als 900mal höher war als die von Uran.
Auf die Mitte einer undatierten Seite kritzelte Pierre Curie etwa Anfang Dezember 1898 die folgenden Zeilen:
also Radiumsulfat
besser löslich in H²SO4 als Bariumsulfat
Sie hatten einen Namen für ihr neues Element gefunden. Sie hatten beschlossen, es Radium zu nennen.
Der erste Schritt war der Versuch, Radium wie auch Polonium in reiner Gestalt herzustellen. Es war den Curies beängstigend deutlich geworden, daß die Tasse voll Pechblende, die sie einige Monate zuvor so sorgfältig abgewogen , in den Mörser getan und vollständig mit dem Stampfer zerrieben hatten, derart winzige Mengen ihrer neuen Elemente enthielt, daß sie als Quelle nutzlos war. Sie brauchten nicht eine Tasse voll, sondern einen ganzen Berg. Das Problem, den Berg zu finden, ließ sich nicht so einfach lösen.
In den ersten Monaten hatte sie aus ihrer Pechblende hunderte, wenn nicht tausende von Litern an Flüssigkeit extrahiert und sie geduldig buchstäblich auf Fingerhutmengen von Radiumlösung reduziert. Am 23. Juli 1900 hatte sie in voreiligem Triumph in ihr Notizbuch geschrieben: ,,Reines Radium in dieser Kapsel". Doch die Menge war zu wenig, als daß sie sein Atomgewicht messen konnte.
Am 28. März 1902 stellte Marie Curie den Wert fest und schrieb die ersten Zahlen nach zwei Jahren in ihrem Notizbuch auf: Ra=225,93.
Das Radium und seine Folgen
Radium war zu der Zeit das erste Mittel gegen Krebs, und die Leute wendeten es erfolgreich an.
Pierre und Marie Curie waren jedoch ständig einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt. Ihre Hände waren rauh und rissig, die Fingerspitzen schmerzten, und Pierre hatte Gliederschmerzen, was er aber auf Rheumatismus zurückführte.
1900 setze Pierre, ohne sich um die Gefahr zu kümmern, seinen Arm der Radiumbestrahlung aus. Er verfolgt ihre Entwicklung und beschreibt in einem Brief an die Akademie kaltblütig die beobachteten Symptome:
,,Die Haut hat sich auf einer Oberfläche von sechs Quadratzentimetern gerötet, das Aussehen ist dem einer Verbrennung ähnlich, doch ist die Haut nicht oder kaum schmerzhaft. Nach einigen Tagen begann die Rötung stärker zu werden, ohne sich auszubreiten; am zwanzigsten Tag bildeten sich zuerst Krusten, dann eine Wunde, die man mit Verbänden behandelte; am zweiundvierzigsten Tag hat die Haut begonnen, von den Rändern ausgehend, gegen die Mitte zu verheilen, und zweiundfünfzig Tage nach der Bestrahlung bleibt noch eine Fläche von einem Quadratzentimeter als Wunde zurück, die einen ins Graue spielenden Ton annimmt, der darauf schließen läßt, daß eine tiefere Verwundung vorliegt.
Anfang 1904 war Marie wieder schwanger geworden, doch sie verlor das Kind.
Die Strahlenbelastung war zu hoch, sie betrug ca. 1 rem pro Woche, heutzutage dürfen werdende Mütter, die in der Radiumindustrie arbeiten, ihre Körper keiner höheren Dosis als 0,03 rem pro Woche aussetzen.
1904 wurde sie noch einmal schwanger, dieses Kind mit dem Namen Eve kam am 6. Dezember 1904 gesund zur Welt
Der Nobelpreis
1903 erhielten Marie und Pierre Curie den Nobelpreis für Physik, 1911 den Nobelpreis für Chemie für die Gewinnung reinen Radiums aus Radiumsalzen und Feststellung der Eigenschaften des Metalls.
Der 19. April 1906
Am 19. April 1906 starb Pierre Curie.
Er wurde von einer Kutsche mit wildgewordenen Pferden überfahren. Sein Schädel zerschmetterte in 16 Knochenfragmenten.
Die Witwe
Marie mußte ihr restliches Leben allein mit ihren beiden Kindern verbringen.
Sämtliche Skandale in den Zeitungen über sie und einem jüngeren Physiker müßte sie durchstehen.
Im ersten Weltkrieg setzte sie sich erfolgreich für die Kriegsopfer ein, doch für die lebenslange radioaktive Strahlung, der ihr Körper ausgesetzt war, mußte sie bezahlen.
Sie hatte hohes Fieber und war sehr erschöpft, am 3. Juli 1934 konnte sie das letzte Mal von dem Thermometer, das sie mit zitternder Hand hält, ihre Temperatur ablesen. Die abnormen Symptome, der Blutbefund, der von den bekannten Fällen perniziöser Anämie abweicht, verraten die wahre Ursache der Erkrankung: die Einwirkung des Radiums. Madame Curie ist am 4. Juli 1934 in Sancellemoz verstorben.
Am Freitag, 6. Juli nahm sie in aller Bescheidenheit ihren Platz auf dem Friedhof von Sceaux ein. Ihre Geschwister warfen eine Handvoll polnischer Erde, die sie von daheim mitgebracht haben, in das offene Grab.
Die Erinnerung bleibt
Ein Jahr später wird das Buch, das Marie Curie vor ihrem Tod nicht vollendet hatte, den jungen Physikern ihre letzte Botschaft bringen.
Im Radium - Institut, wo die Arbeit wieder beginnt, hat der umfangreiche Band seinen in der Bibliothek neben den anderen wissenschaftlichen Werken eingenommen. Der graue Einband trägt den Namen des Autors:
>Madame Pierre Curie, Professor an der Sorbonne, Nobelpreis für Physik, Nobelpreis für Chemie.<
Der Titel besteht aus einem einzigen Wort:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text ist eine Biografie von Marie Curie, beginnend mit ihrer Kindheit in Polen, über ihr Studium in Paris und ihre bahnbrechenden Entdeckungen im Bereich der Radioaktivität, bis hin zu ihrem Tod. Er beschreibt ihre Zusammenarbeit mit Pierre Curie, ihre Entdeckung von Polonium und Radium, ihre Auszeichnungen (einschließlich Nobelpreise), den tragischen Tod von Pierre, und Maries anhaltende Arbeit und Hingabe an die Wissenschaft, trotz persönlicher Verluste und gesellschaftlicher Herausforderungen.
Wo wurde Marie Curie geboren?
Marie Curie, geboren als Maria Salomee Sklodowska, wurde in Warschau, Polen, geboren.
Warum ging Marie Curie nach Paris?
Marie ging nach Paris, um zu studieren, da Frauen in Polen zu dieser Zeit keinen Zugang zu höherer Bildung hatten.
Wer war Pierre Curie?
Pierre Curie war ein französischer Physiker und der Ehemann von Marie Curie. Er arbeitete eng mit Marie zusammen an Forschungen zur Radioaktivität.
Welche Elemente entdeckten Marie und Pierre Curie?
Marie und Pierre Curie entdeckten die radioaktiven Elemente Polonium und Radium.
Was ist Radium und wozu wurde es verwendet?
Radium ist ein radioaktives Element, das von Marie und Pierre Curie entdeckt wurde. Es wurde zunächst als Mittel gegen Krebs eingesetzt.
Wie starb Pierre Curie?
Pierre Curie starb bei einem Verkehrsunfall. Er wurde von einer Kutsche überfahren.
Wann erhielt Marie Curie den Nobelpreis?
Marie Curie erhielt 1903 zusammen mit Pierre Curie den Nobelpreis für Physik und 1911 den Nobelpreis für Chemie.
Welche Auswirkungen hatte die Radioaktivitätsforschung auf Marie Curie?
Die lebenslange Arbeit mit radioaktiven Substanzen führte zu gesundheitlichen Problemen und letztendlich zu Marie Curies Tod. Sie starb an den Folgen der radioaktiven Strahlung.
Welche Rolle spielte Marie Curie im Ersten Weltkrieg?
Marie Curie setzte sich im Ersten Weltkrieg für die Kriegsopfer ein und trug zur medizinischen Versorgung bei.
Was war Marie Curies Dissertationsthema?
Marie Curies Dissertationsthema war die Untersuchung der Uranstrahlen und die Entdeckung anderer radioaktiver Substanzen.
Was bedeutet der Begriff "radioaktiv"?
Der Begriff "radioaktiv" wurde von den Curies geprägt, um das Verhalten von uranähnlichen Stoffen zu beschreiben, die Strahlung aussenden.
Wie wurde Marie Curies Leistung in der Wissenschaft anerkannt?
Marie Curie wurde durch zwei Nobelpreise, eine Professur an der Sorbonne und ein ihr gewidmetes Radium-Institut geehrt.
- Citar trabajo
- Jasmin Hößler (Autor), 1998, Marie Curie und die Entdeckung des Radiums, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97106