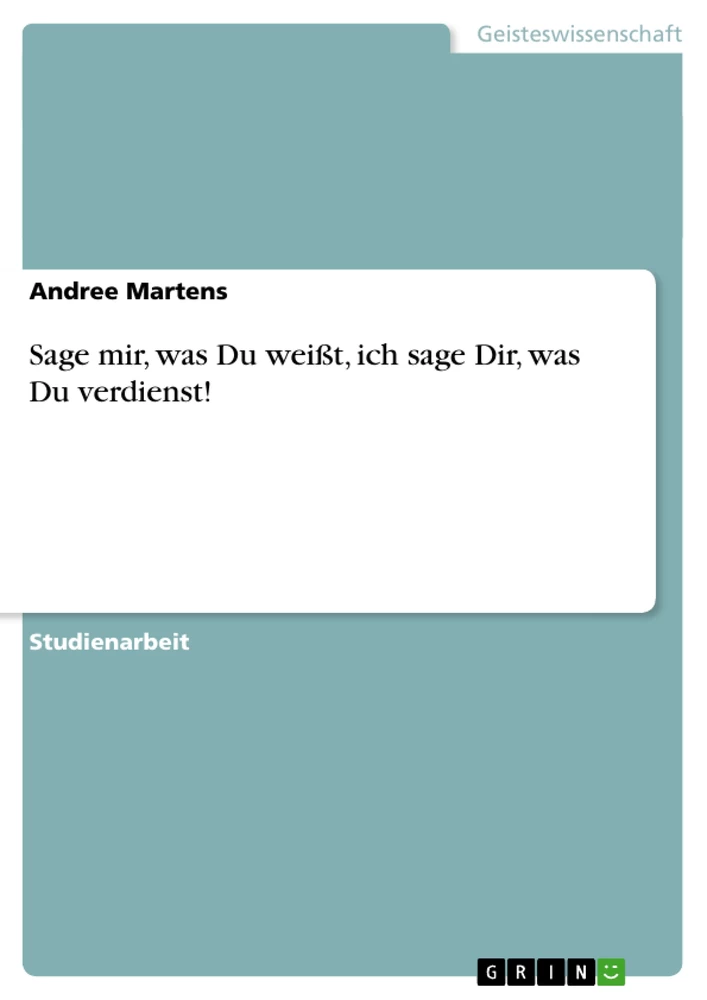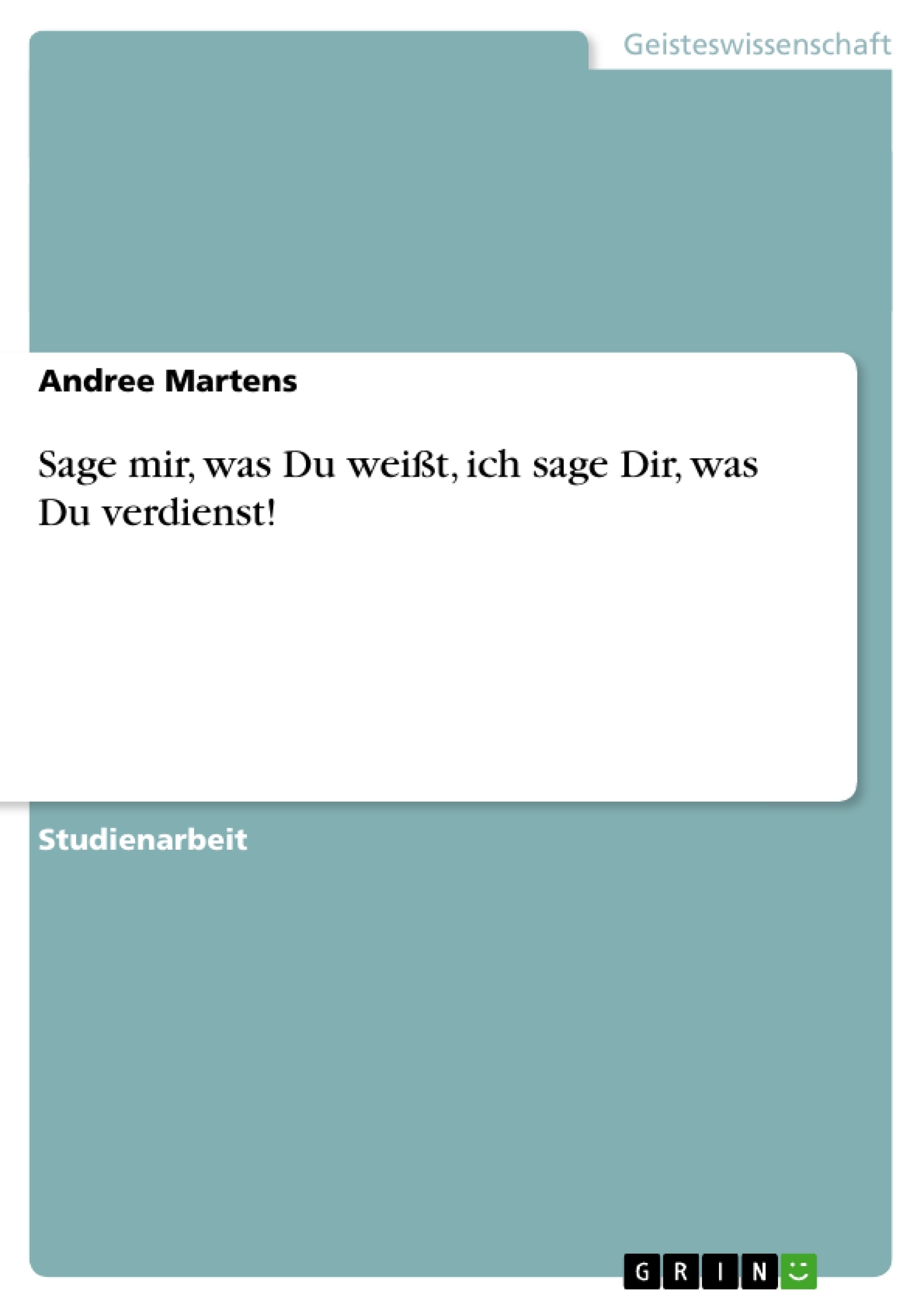Bildung ist in modernen, industrialisierten Gesellschaften zu einem wichtigen Kriterium der sozialen Differenzierung geworden. Durchgängig wird beispielsweise die formale Bildung in sozialstatistischen Erhebungen als Indikator für die soziale Lage von Individuen und Haushalten verwandt.
Warum ist Bildung Katalysator sozialer Ungleichheit? Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen: Wer besser ausgebildet ist, verdient besser. Diese Aussage verweist zwar auf einen Zusammenhang zwischen Ausbildungsniveau und Einkommensniveau, begründet ihn aber nicht.
Versuche einer Begründung liefern hingegen verschiedenste Erklärungsansätze, die starke Divergenzen aufweisen, wie sie den Zusammenhang von Bildung und Einkommen und Kausalitäten dieser beiden Variablen formulieren. Müller und Mayer, die sich mit den verschiedensten Thesen zum Verhältnis von Bildung, Beruf und Einkommen auseinandersetzen, schreiben zur Charakterisierung des Diskussionsstandes, "daß fast jede denkbare Behauptung über die Beziehungen zwischen sozialer Herkunft, Bildung und beruflichem Status auch tatsächlich vertreten worden ist."
Zur Erklärung des Zusammenhangs von Bildung und Einkommenshöhe werden im Rahmen dieser Arbeit drei Konzepte herangezogen: das Mitte der 60er Jahre von Blau und Duncan vorgelegte Statuszuweisungsmodell, die aus der Ökonomie stammende Humankapital-Theorie und Thurows Theorie der Arbeitsplatzkonkurrenz.
Zur anschließenden empirischen Überprüfung dieser Hypothesen dienen Daten einer Längsschnittsuntersuchung von Blossfeld, Hannan und Schömann zur Verdienstentwicklung im Lebenslauf bei Männern. Die genannten Autoren überprüfen in dieser Untersuchung nicht nur den Einfluß der Variable Bildung auf die Einkommenshöhe, bzw. die Entwicklung des Einkommens, sondern ziehen auch zahlreiche andere Variablen- wie beispielsweise gesamtwirtschaftliche Faktoren - hinzu. Dies ermöglicht eine Überprüfung der generellen Frage, ob Bildung wirklich die entscheidende Determinante für die Einkommenshöhe darstellt oder ob andere Determinanten nicht schwerer wiegen?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ausgesuchte Theorien der Mobilitätsforschung
- II.1 Die frühe Mobilitätsforschung
- II.2 Die Statuszuweisungstheorie
- II.2.1 Die Statuszuweisungstheorie und die Höhe der Arbeitseinkommen von Berufsanfängern
- II.3 Die Humankapitaltheorie
- II.3.1 Die Humankapitaltheorie und die Höhe der Arbeitseikommen von Berufsanfängern
- II.3.2 Die Humankapitalttheorie und die Auswirkungen der Bildungsexpansion
- II.3.3 Die Humankapitaltheorie und die Verdienstentwicklung auf ein und demselben Arbeitsplatz
- II.4 Die Theorie der Arbeitsplatzkonkurrenz
- II.4.1 Die Theorie der Arbeitsplatzkonkurrenz und die Höhe des Arbeitseinkommens von Berufsanfängern
- III. Die empirische Überprüfung der Hypothesen
- III.1 Übersicht der Hypothesen
- III.2 Datenbasis und Variablendefinition
- III.2.1 Datenbasis
- III.2.2 Reliabilitätsprobleme
- III.2.3 Die Operationalisierung der Variable Bildung
- III.3 Ergebnisse der empirischen Überprüfung
- III.3.1 Die Phase des Berufseintritts
- III.3.1.1 Ausbildungsniveau und Einkommen
- III.3.1.2 Die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf das erste Arbeitseinkommen
- III.3.2 Die Phase der Verweildauer auf ein und demselben Arbeitsplatz
- III.3.1 Die Phase des Berufseintritts
- IV. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Bildung und Einkommenshöhe. Sie analysiert verschiedene Theorien der Mobilitätsforschung, die diesen Zusammenhang erklären, und überprüft die daraus abgeleiteten Hypothesen anhand empirischer Daten. Ziel ist es, den Einfluss von Bildung auf die Entwicklung des Arbeitseinkommens in verschiedenen Phasen des Erwerbsverlaufs zu untersuchen und die Rolle von Bildung im Kontext sozialer Ungleichheit zu beleuchten.
- Die Rolle von Bildung als Katalysator sozialer Ungleichheit
- Die Analyse verschiedener Theorien zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Bildung und Einkommen
- Die empirische Überprüfung der Hypothesen anhand von Längsschnittstudien
- Die Untersuchung des Einflusses der Bildungsexpansion auf die Entwicklung der Arbeitseinkommen
- Die Bedeutung von Bildung im Kontext sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildung und Lebenschancen. Es erläutert, wie Bildung in modernen Gesellschaften zum Kriterium der sozialen Differenzierung geworden ist. Die Einführung stellt zudem die drei zentralen Theorien der Mobilitätsforschung vor, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden.
Kapitel zwei widmet sich den Theorien der Mobilitätsforschung. Es werden die Statuszuweisungstheorie, die Humankapitaltheorie und die Theorie der Arbeitsplatzkonkurrenz vorgestellt und ihre jeweiligen Ansätze zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Bildung und Einkommen dargestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Modell der Humankapitaltheorie und dessen Anwendung auf die Entwicklung der Arbeitseinkommen im Verlauf des Berufslebens.
Kapitel drei befasst sich mit der empirischen Überprüfung der in Kapitel zwei aufgestellten Hypothesen. Es wird die Datenbasis der Untersuchung erläutert und die Operationalisierung der Variable Bildung dargestellt. Anschließend werden die Ergebnisse der empirischen Analyse vorgestellt, die den Einfluss von Bildung auf die Einkommenshöhe in verschiedenen Phasen des Berufseintritts und der Verweildauer auf ein und demselben Arbeitsplatz beleuchten.
Schlüsselwörter
Soziale Mobilität, Bildung, Einkommen, Statuszuweisungstheorie, Humankapitaltheorie, Arbeitsplatzkonkurrenz, Bildungsexpansion, soziale Ungleichheit, empirische Forschung, Längsschnittstudie, Erwerbsverlauf, Berufseintritt.
- Quote paper
- Andree Martens (Author), 2000, Sage mir, was Du weißt, ich sage Dir, was Du verdienst!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9709