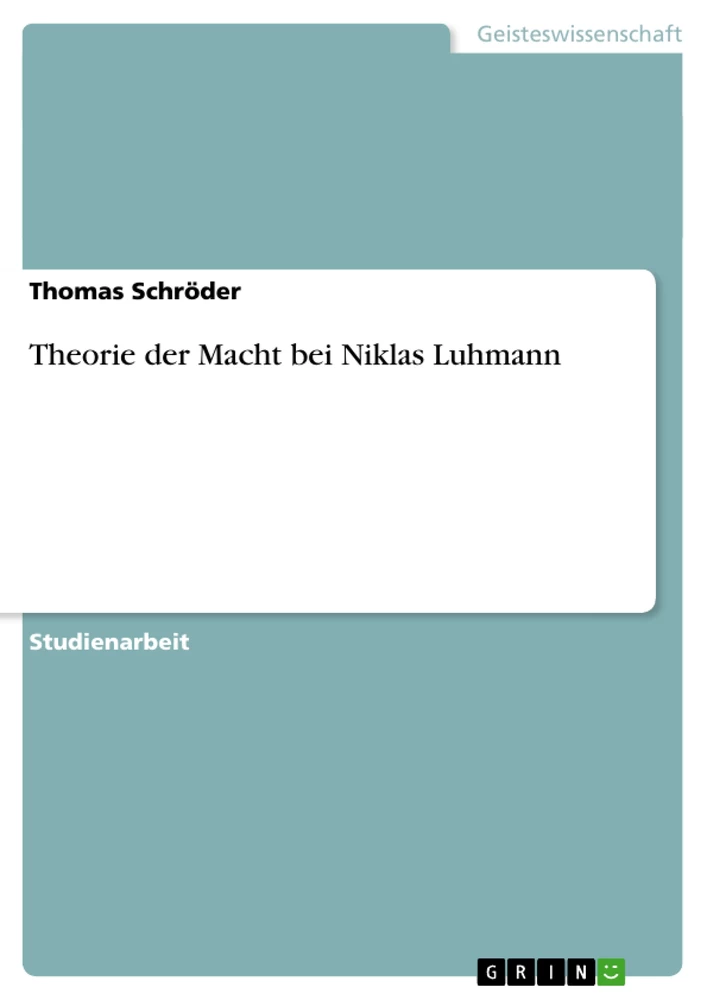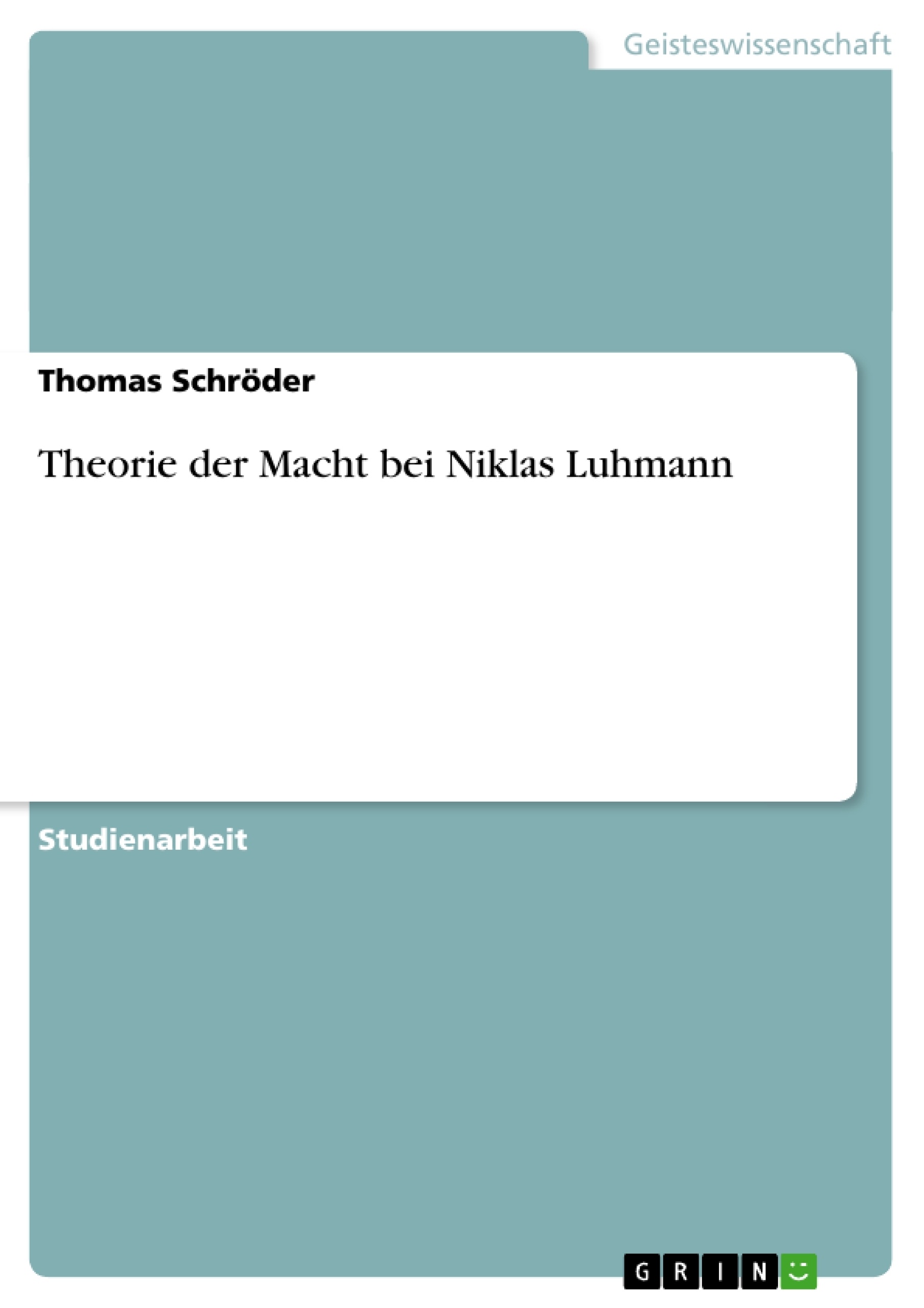Die weltweite Vernetzung von Systemen und Systemstrukturen scheint analog zum Theorem der Globalisierung mit zunehmender Eigendynamik und Rasanz eine Entwicklung zu nehmen, die sich mehr denn je dem Einfluß und der Steuerbarkeit durch Politik entzieht. Durch die strukturell asymmetrische Lagerung der Grundbedingungen der multilateralen Weltgesellschaft auf der einen und der territorialen Gebundenheit der Politik auf der anderen Seite, kommt es scheinbar zunehmend zum Rückgang der politischen Einflußmöglichkeiten.
Die Frage, inwieweit das politische System überhaupt noch steuerungsfähig ist, verweist auf ein dirigistisches Vorverständnis und soll hier mit der kritischen Bemerkung präzisiert werden, dass das Steuern im Sinne von Navigieren und richtunggebendem Lenken nicht notwendig als zentrale Aufgabe von Politik aufgefasst werden muß. Die Gegenposition stellt in Betracht, dass das politische System zunehmend die Fähigkeit verliert, sich (im Sinne von Talcott Parsons Begriff des collectiv goal attainment) hinreichend an strukturelle Veränderungen anpassen zu können.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur systemtheoretischen Annäherung an diesen Fragenkomplex leisten. Eine Theoretisierung von Macht (als Einflußmöglichkeit) ist angesichts (global) unüberschaubarer werdender Einfluß- und Interdependenzstrukturen unabdingbar. Die Machttheorie Niklas Luhmanns bietet dazu einen wesentlichen Ausgangspunkt. Um einen Überblick auf die Theorie der Macht bei Luhmann zu gewinnen, bedarf es zahlreicher Definitionen und Erläuterungen von Begriffen. Ebenso wie die allgemeine Systemtheorie Luhmanns (1984) bedeutet auch die Theorie der Macht einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der bisherigen Terminologie und des vorherrschenden Verständnisses in der Soziologie. Die luhmannsche Theorie versteht sich als eine Weiterführung des machttheoretischen Ansatzes von Talcott Parsons und lädt somit zu vergleichenden Exkursen mit dessen Ideen ein. Luhmann erläutert dem Begriff der Macht allgemein aus einer sozio-kulturellen und evolutionstheoretischen Perspektive, um dann –deduktiv – auf Spezifika und Einzelerscheinungen, wie die Einschränkung von politischer Macht durch intersystemische Wechselbeziehungen und durch die Generierung von (Organisations)Systemen mit machtabsorbierenden Eigenschaften überzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung und Überblick
- Macht als Kommunikationsmedium
- Handlungsbegriff im Verhältnis zu Macht
- Funktion von Medien-Codes
- Macht und physische Gewalt
- Technisierung des Sozialen
- Dreidimensionaltät von generalisiertem Einfluß
- Risiken der Macht
- Gesellschaftliche Relevanz von Macht
- Macht und organisationsspezifische Systeme
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der systemtheoretischen Analyse von Macht im Kontext der Globalisierung. Sie untersucht, inwieweit die politische Steuerungsfähigkeit angesichts globaler Vernetzung und struktureller Veränderungen bewahrt werden kann. Die Arbeit greift dabei auf die Machttheorie von Niklas Luhmann zurück, die einen Paradigmenwechsel im Verständnis von Macht darstellt und im Vergleich zu Talcott Parsons’ Ansätzen neue Perspektiven eröffnet.
- Die Rolle der Kommunikationsmedien in der Machtstruktur
- Die Unterscheidung zwischen Macht und Zwang
- Die Bedeutung von symbolisch verallgemeinerter Kommunikation
- Der Einfluss von Organisationen und Systemstrukturen auf die Macht
- Die Herausforderungen der Globalisierung für die politische Steuerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Macht in der globalisierten Welt heraus und führt in die systemtheoretische Perspektive von Luhmann ein.
- Darstellung und Überblick: Dieser Abschnitt erläutert die Kernelemente von Luhmanns Machttheorie. Dabei werden die Bedeutung von Kommunikation, Medien-Codes, die Unterscheidung von Macht und Zwang sowie die Interaktion zwischen Machthabern und Machtunterworfenen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Machttheorie, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Kommunikation, Medien-Codes, Globalisierung, politische Steuerung, Organisation, Zwang, symbolisch verallgemeinerte Kommunikation und Talcott Parsons.
- Arbeit zitieren
- Thomas Schröder (Autor:in), 2001, Theorie der Macht bei Niklas Luhmann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9605