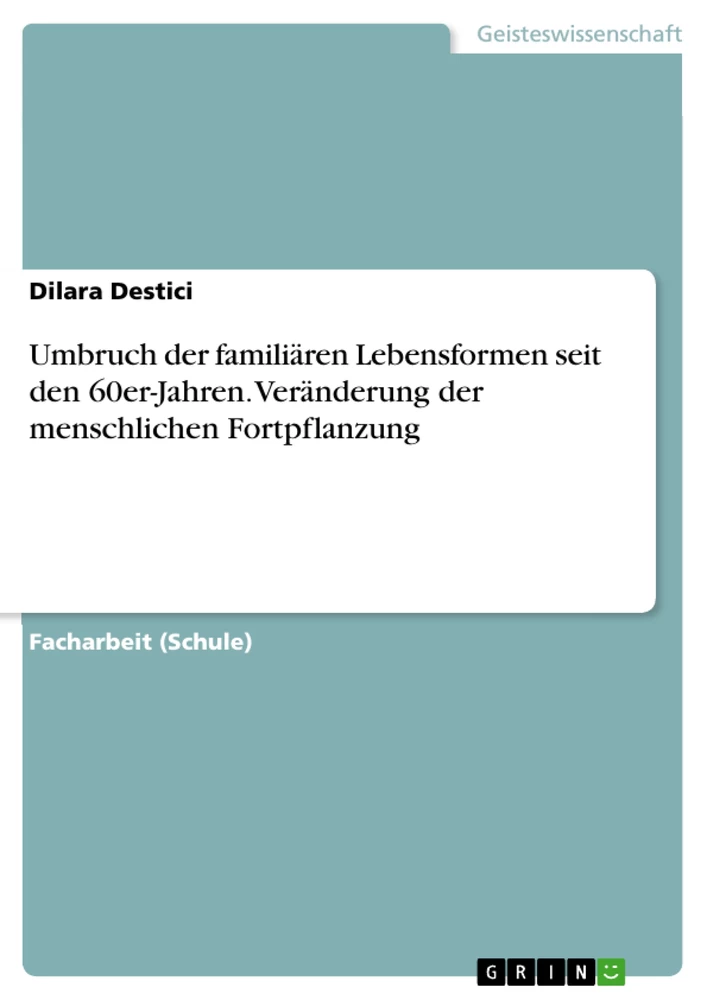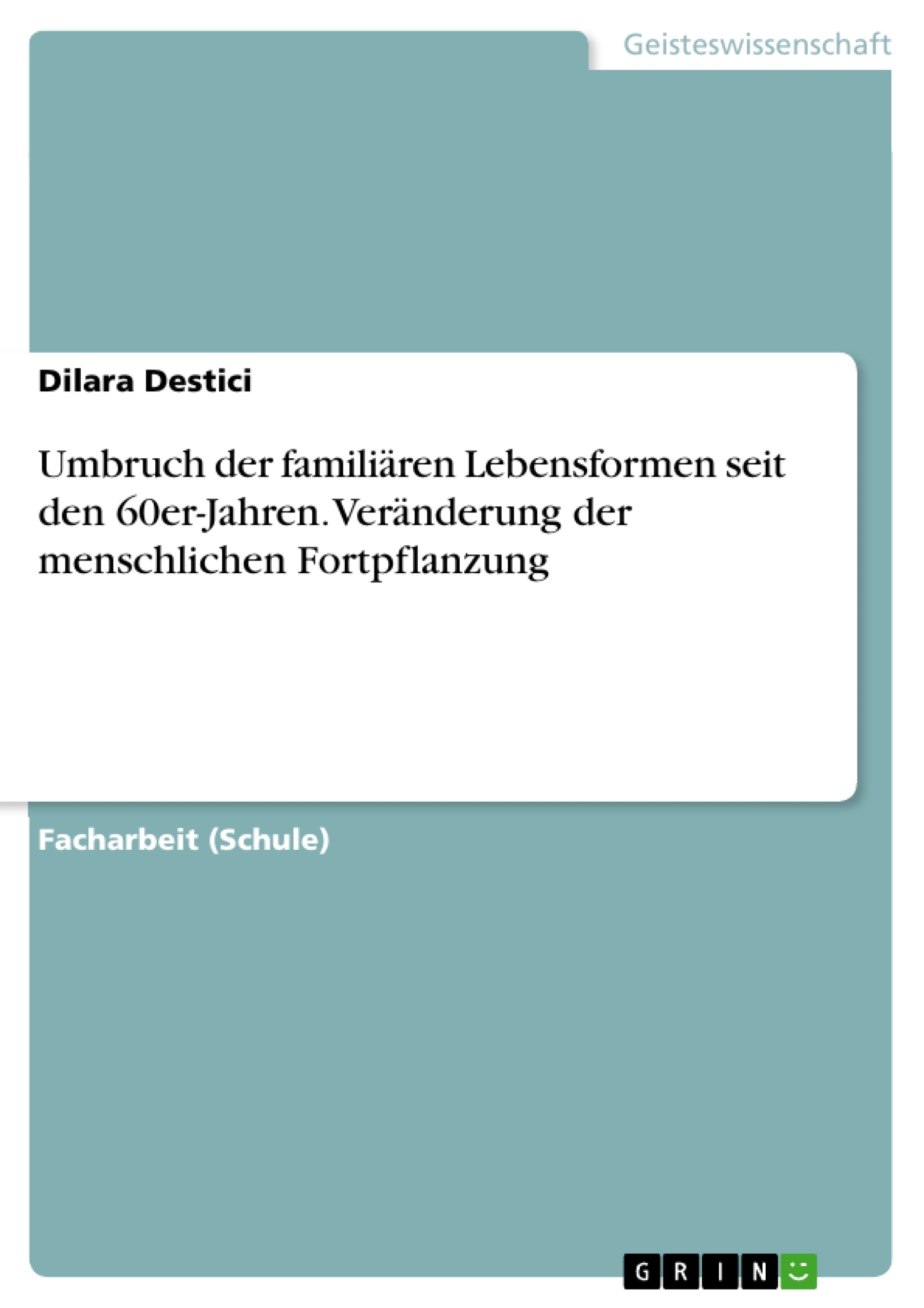Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Umbruch der familiären Lebensformen seit den 1960er-Jahren. Dabei wird speziell auf die darauf zurückführende Veränderung der menschlichen Fortpflanzung und deren Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft eingegangen. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik folgt hierfür eine Darstellung der unterschiedlichen Entwicklungen in der BRD und DDR. Anschließend wird das traditionelle Familienbild und dessen Wichtigkeit für die Gesellschaft erläutert.
Im vierten Kapitel wird die Entstehung neuer Lebensformen behandelt. Hier wird zunächst auf die Vielfältigkeit der Menschen und die verschiedenen Lebensformen eingegangen. Anschließend wird ein besonderes Augenmerk auf die Patchworkfamilie, kinderlose Ehepaare, Alleinerziehende und unverheiratete Ehepaare gelegt. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der psychologischen Prägung des Kindes durch veränderte Lebensformen. Hier wird insbesondere das Leben ohne Mutter bzw. Vater und die soziale Ausgrenzung durch Unterschiede erörtert.
Die "traditionelle" Familie, auch genannt Kleinfamilie, bestehend aus einem Ehepaar und ihren leiblichen Kindern, ist auch heute noch die am häufigsten praktizierte Lebensform. Sie sorgt für sozialen Zusammenhalt und trägt das vollkommene Familienbild in die Öffentlichkeit. Der Grund für die weite Verbreitung dieser Lebensform liegt u.a. in der Gesetzgebung, welche Familien, welche sich im Rahmen der Ehe befinden, finanzielle Unterstützung gewährleistet und rechtlichen Schutz bietet. Anzumerken ist, dass sozialpolitisch die Ehe in der Bundesrepublik den höchsten Stellenwert hatte und mit allen Mitteln gefördert wurde, während es der DDR wichtiger war, die Familie und ebenso auch Alleinerziehende zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Unterschiede in der Entwicklung: Vergleich BRD und die ehemalige DDR
- 3. Die "traditionelle" Familie und dessen Wichtigkeit für die Gesellschaft
- 3.1 Ursprung vom Verständnis einer "traditionelle" Familie
- 4. Die Entstehung neuer Lebensformen
- 4.1 Die Vielfältigkeit des Menschen
- 4.2 Verschiedene Lebensformen
- 4.3 Patchworkfamilie
- 4.4 Kinderlose Ehepaare
- 4.4.1 Bedeutung eines Kindes
- 4.4.2 Geburtenrückgang
- 4.4.3 Adoption
- 4.5 Alleinerziehende
- 4.6 Unverheiratete Paare
- 4.6.1 Der Wert einer Ehe
- 4.7 Vorurteile gegenüber neuen Lebensformen
- 5. Psychologische Prägung des Kindes durch die veränderte Lebensform
- 5.1 Leben ohne eine Mutter-/Vaterrolle
- 5.2 Soziale Ausgrenzung durch Unterschiede
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Entwicklung neuer familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren, deren Einfluss auf die menschliche Fortpflanzung und die gesellschaftliche Reaktion darauf. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen BRD und ehemaliger DDR und der Analyse der Auswirkungen verschiedener Lebensmodelle auf die Gesellschaft.
- Entwicklung familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren
- Vergleich der Entwicklung in BRD und ehemaliger DDR
- Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzung (Geburtenrückgang etc.)
- Gesellschaftliche Akzeptanz und Vorurteile gegenüber neuen Lebensformen
- Psychologische Auswirkungen auf Kinder in verschiedenen Familienkonstellationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: die Entwicklung neuer Lebensformen seit den 1960er Jahren, deren Einfluss auf die Fortpflanzung und die gesellschaftliche Reaktion. Sie hebt den Unterschied in der Entwicklung zwischen BRD und DDR hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit untersucht bekannte Lebensformen und deren mögliche Folgen, wobei die Unterschiede zwischen der Entwicklung in der BRD und der ehemaligen DDR besonders betont werden.
2. Unterschiede in der Entwicklung: Vergleich BRD und die ehemalige DDR: Dieses Kapitel vergleicht die Entwicklung familiärer Lebensformen in der BRD und der ehemaligen DDR nach 1990. Trotz anfänglicher Gemeinsamkeiten, wie der ehebasierten Familie als Kern der Gesellschaft, entwickelten sich Unterschiede im Verhältnis von Staat und Familie. In der BRD wurde die Privatsphäre der Familie betont, während in der DDR staatliche Einflüsse auf Erziehung und Familienleben stärker waren. Trotz dieser Unterschiede trugen beide Entwicklungen zur Vielfalt der heutigen Lebensformen bei.
3. Die "traditionelle" Familie und dessen Wichtigkeit für die Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der "traditionellen" Kleinfamilie (Ehepaar mit leiblichen Kindern) als bis heute am häufigsten vorkommende Lebensform. Es untersucht die Gründe für ihre Verbreitung, insbesondere den gesetzlichen und gesellschaftlichen Schutz und die finanzielle Unterstützung von Ehen. Der soziale Zusammenhalt und das Idealbild der Familie in der Öffentlichkeit werden thematisiert, wobei auch Unterschiede in der Förderung von Familien zwischen BRD und DDR hervorgehoben werden. Die biologische Funktion der Reproduktion und der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf die Verbreitung dieser Familienform werden analysiert.
4. Die Entstehung neuer Lebensformen: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung und Vielfalt neuer Lebensformen. Es untersucht verschiedene Modelle wie Patchworkfamilien, kinderlose Ehepaare, Alleinerziehende und unverheiratete Paare. Es beleuchtet die Gründe für diese Entwicklungen, die Bedeutung von Kindern, den Geburtenrückgang, Adoption und die gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber diesen neuen Familienstrukturen. Jeder Aspekt wird detailliert erläutert und in den größeren Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen eingeordnet. Insbesondere werden die unterschiedlichen Motivationen und Herausforderungen dieser Lebensformen beleuchtet und kritisch betrachtet.
5. Psychologische Prägung des Kindes durch die veränderte Lebensform: Dieses Kapitel untersucht die psychologischen Auswirkungen verschiedener Lebensformen auf Kinder, insbesondere den Vergleich von Kindern in gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Haushalten. Der Fokus liegt auf der Frage, ob das Fehlen einer Mutter- oder Vaterrolle einen Nachteil für die kindliche Entwicklung darstellt und wie soziale Ausgrenzung aufgrund von Unterschieden in den Familienstrukturen wirkt. Das Kapitel analysiert potenzielle Herausforderungen und positive Aspekte verschiedener Familienkonstellationen für die kindliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Facharbeit: Entwicklung neuer familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die Entwicklung neuer familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren, ihren Einfluss auf die menschliche Fortpflanzung und die gesellschaftliche Reaktion darauf. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und der Analyse der Auswirkungen verschiedener Lebensmodelle auf die Gesellschaft.
Welche Lebensformen werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit behandelt die "traditionelle" Kleinfamilie (Ehepaar mit leiblichen Kindern) und verschiedene neue Lebensformen wie Patchworkfamilien, kinderlose Ehepaare, Alleinerziehende und unverheiratete Paare. Sie analysiert die Gründe für die Entstehung dieser neuen Lebensformen und deren gesellschaftliche Akzeptanz bzw. Ablehnung.
Wie wird der Unterschied zwischen BRD und DDR in der Arbeit behandelt?
Die Facharbeit vergleicht die Entwicklung familiärer Lebensformen in der BRD und der ehemaligen DDR nach 1990. Es werden die Unterschiede im Verhältnis von Staat und Familie in beiden Gesellschaftssystemen beleuchtet und deren Einfluss auf die Entwicklung verschiedener Lebensformen analysiert. Trotz anfänglicher Gemeinsamkeiten, wie der ehebasierten Familie als Kern der Gesellschaft, werden die unterschiedlichen Entwicklungspfade und deren Auswirkungen herausgearbeitet.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die Entwicklung familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren, den Vergleich der Entwicklung in BRD und ehemaliger DDR, die Auswirkungen auf die menschliche Fortpflanzung (Geburtenrückgang etc.), die gesellschaftliche Akzeptanz und Vorurteile gegenüber neuen Lebensformen sowie die psychologischen Auswirkungen auf Kinder in verschiedenen Familienkonstellationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einführung), Kapitel 2 (Vergleich BRD/DDR), Kapitel 3 ("Traditionelle" Familie), Kapitel 4 (Neue Lebensformen), Kapitel 5 (Psychologische Auswirkungen auf Kinder) und Kapitel 6 (Fazit). Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf. Die Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel finden sich im Inhaltsverzeichnis der Facharbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit (Kapitel 6) fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen zur Entwicklung und Vielfalt familiärer Lebensformen. Es bewertet die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Gesellschaft und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Entwicklung neuer familiärer Lebensformen seit den 1960er Jahren zu liefern und deren gesellschaftliche Bedeutung zu analysieren. Sie möchte die Unterschiede in der Entwicklung zwischen BRD und DDR aufzeigen und die Auswirkungen verschiedener Lebensmodelle auf die Gesellschaft, insbesondere auf die kindliche Entwicklung, kritisch beleuchten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Entwicklung familiärer Strukturen, soziologische und demografische Veränderungen und die gesellschaftliche Akzeptanz von Diversität interessieren. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich mit den Themen Familie, Gesellschaft und demografischer Wandel auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Dilara Destici (Autor), 2020, Umbruch der familiären Lebensformen seit den 60er-Jahren. Veränderung der menschlichen Fortpflanzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958670