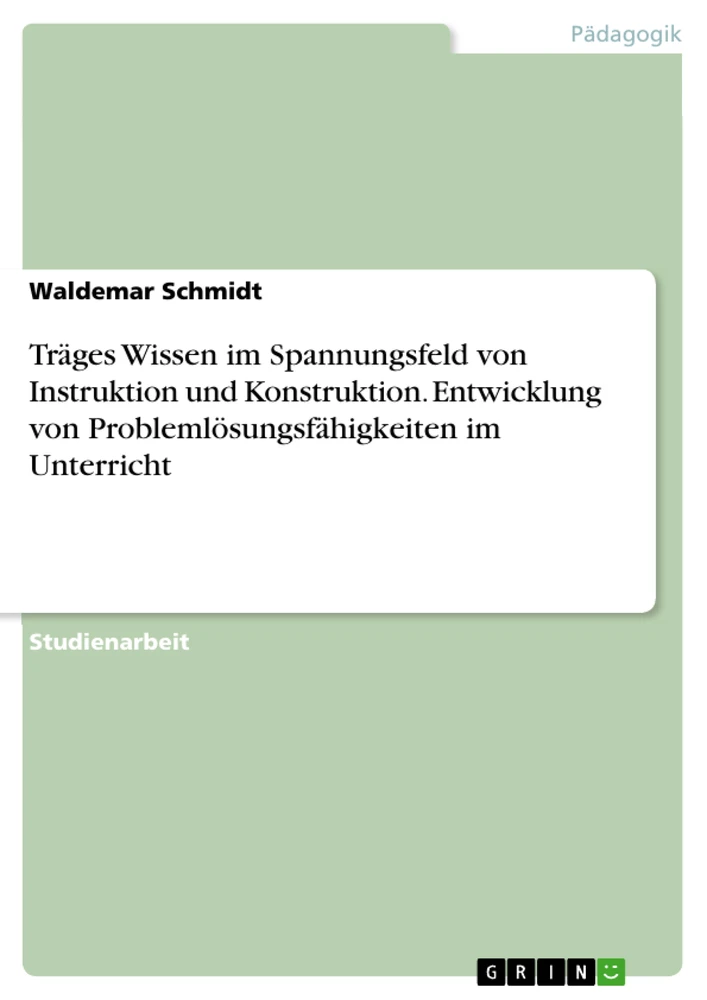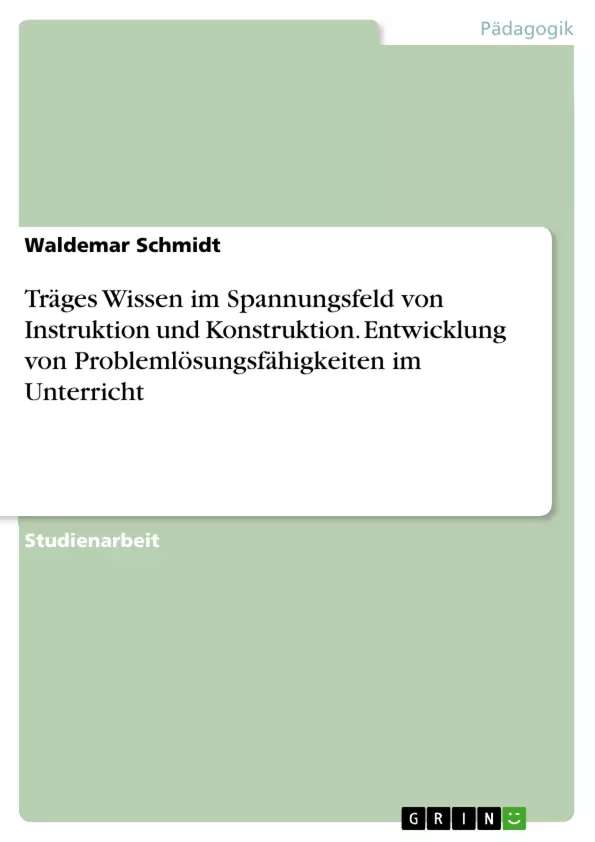Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des trägen Wissens. Konkret wird die Frage beantwortet, welche empirisch fundierten Aspekte situierter Lernumgebungen dem Transfer und der Anwendbarkeit von erworbenem Wissen zuträglich sein und damit den Aufbau trägen Wissens mindern können. Für die Klärung dieser Fragestellung werden zunächst die theoretischen Grundlagen zum trägen Wissen und der aktuelle Forschungsstand zur Förderung des Wissenstransfers dargelegt.
Dazu werden Aspekte situierter Lernumgebungen auf ihre empirische Evidenz überprüft. Die fünf herausgestellten Kategorien, Authentizität und Praxisnähe, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation und Reflexion und sozialer Kontext bieten eine solide Grundlage für die anschließende Analyse und Bewertung des beigefügten Unterrichtsentwurfs und können, darüber hinaus, für zukünftige Unterrichtsplanung verwendet werden.
Das Hamburger Schulgesetz verdeutlicht mit einer gewissen Verbindlichkeit, dass nicht nur Wissensvermittlung zu den Aufgaben von Schulen gehört, sondern dass auch weitere Aufgabenfelder einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Schülern soll ermöglicht werden, sich als mündige Bürger in der Gesellschaft zu etablieren, um aktiv am gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Leben teilhaben zu können. Die starke Kritik am Bildungssystem vonseiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zeigt jedoch, dass diese Ziele noch nicht erreicht sind.
Obwohl das berufliche Schulwesen in Deutschland, im internationalen Vergleich, gut aufgestellt und wettbewerbsfähig ist, lassen sich die Defizite, die in den Medien oft überspitzt dargestellt werden, nicht leugnen. Geringe Motivation, fehlendes Interesse, der Mangel von Problemlösefähigkeit und Handlungskompetenz oder träges Wissen sind die zentralen Herausforderungen des heutigen Bildungswesens. Neben dem medialen Diskurs bescheinigen auch empirische Bildungsstudien deutschen SuS den Mangel an der Kompetenz ihr Wissen auf konkrete Problemsituationen zu übertragen.
In Anbetracht dieser Problemlage gilt es folglich, zunächst die Frage nach den möglichen Einflussfaktoren zu ergründen und im nächsten Schritt Alternativen zu herkömmlichen Herangehensweisen im Unterricht zu konzipieren und durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand und theoretische Basis
- 2.1 Träges Wissen
- 2.2 Lerntheoretische Einordnung des situierten Lernens
- 2.3 Empirische Befunde und Faktoren zum situierten Lernen
- 2.3.1 Authentizität und Praxisnähe
- 2.3.2 Komplexität
- 2.3.3 Multiple Perspektiven
- 2.3.4 Artikulation und Reflexion
- 2.3.5 Lernen im sozialen Kontext
- 3 Begründung des Unterrichtentwurfs
- 3.1 Intention, Didaktische Reduktion und Ziele
- 3.2 Begründung der Phasierung und des Durchführungskonzepts
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Frage, welche Aspekte situierter Lernumgebungen den Transfer und die Anwendbarkeit von erworbenem Wissen fördern und somit träges Wissen reduzieren können. Sie analysiert empirisch fundierte Aspekte situierter Lernumgebungen und bewertet diese im Kontext eines beigefügten Unterrichtsentwurfs. Das Ziel ist die Entwicklung von alternativen Unterrichtsansätzen, um die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln zu überwinden.
- Träges Wissen und seine Ursachen
- Situiertes Lernen und seine lerntheoretische Einordnung
- Empirische Befunde zu Aspekten situierten Lernens (Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation/Reflexion, sozialer Kontext)
- Analyse eines Unterrichtsentwurfs im Lichte der theoretischen Grundlagen
- Konzeption und Durchführung alternativer Unterrichtsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen des heutigen Bildungswesens, insbesondere den Mangel an Handlungskompetenz und trägem Wissen bei Schülern. Sie verweist auf Kritik am deutschen Bildungssystem und die Diskrepanz zwischen erworbenem Wissen und dessen Anwendung in realen Situationen. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie empirisch fundierte Aspekte situierter Lernumgebungen den Wissenstransfer verbessern können und legt die Grundlage für die Analyse eines Unterrichtsentwurfs, der im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert dargestellt wird. Der Kontext des Hamburger Schulgesetzes und der Anspruch an mündige Bürger werden ebenfalls angesprochen.
2 Forschungsstand und theoretische Basis: Dieses Kapitel erörtert die theoretischen Grundlagen situierter Lernumgebungen im Kontext von trägem Wissen. Es definiert den Begriff „träges Wissen“ historisch und lerntheoretisch, beginnend mit Whitehead's Konzept des „inert knowledge“. Drei verschiedene Erklärungsansätze für das Entstehen von trägem Wissen werden vorgestellt: Probleme mit Zugriffsprozessen auf Wissen, defizitäre Wissensstrukturen und die Vorstellung von Wissen als kontextunabhängiges Konstrukt. Das Kapitel analysiert den aktuellen Forschungsstand zu ausgewählten Aspekten situierter Lernumgebungen, wie Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation und Reflexion sowie den sozialen Kontext des Lernens. Diese Analyse dient als Grundlage für die spätere Bewertung des Unterrichtsentwurfs.
3 Begründung des Unterrichtentwurfs: Dieses Kapitel präsentiert die didaktische Konzeption und Begründung des im Anhang befindlichen Unterrichtsentwurfs. Es beschreibt die Intentionen, die didaktische Reduktion und die Lernziele. Die Phasierung und das Durchführungskonzept des Unterrichts werden detailliert erläutert und mit den im vorherigen Kapitel dargestellten theoretischen Grundlagen und empirischen Befunden zum situierten Lernen verknüpft. Die didaktischen Entscheidungen werden begründet und ihre Relevanz für die Förderung des Wissenstransfers und die Verminderung von trägem Wissen dargelegt. Der Fokus liegt auf der kohärenten Umsetzung der theoretischen Konzepte in eine praktische Unterrichtsgestaltung.
Schlüsselwörter
Träges Wissen, situiertes Lernen, Wissenstransfer, Handlungskompetenz, Unterrichtsgestaltung, Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation, Reflexion, sozialer Kontext, Instruktionsdesign, kognitive Flexibilität, metakognitives Wissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Ausarbeitung: Situiertes Lernen und Träges Wissen
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht, wie Aspekte situierter Lernumgebungen den Transfer und die Anwendbarkeit von Wissen fördern und somit „träges Wissen“ reduzieren können. Sie analysiert empirisch fundierte Aspekte situierter Lernumgebungen und bewertet diese anhand eines beigefügten Unterrichtsentwurfs. Ziel ist die Entwicklung alternativer Unterrichtsansätze zur Überwindung der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln.
Welche Themen werden in der Ausarbeitung behandelt?
Die zentralen Themen sind: Träges Wissen und seine Ursachen, situiertes Lernen und seine lerntheoretische Einordnung, empirische Befunde zu Aspekten situierten Lernens (Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation/Reflexion, sozialer Kontext), Analyse eines Unterrichtsentwurfs im Lichte der theoretischen Grundlagen und die Konzeption und Durchführung alternativer Unterrichtsmethoden.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Forschungsstand und der theoretischen Basis, ein Kapitel zur Begründung des Unterrichtsentwurfs und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen des Bildungswesens und die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. Das zweite Kapitel erörtert die theoretischen Grundlagen situierten Lernens im Kontext von trägem Wissen. Das dritte Kapitel präsentiert und begründet den Unterrichtsentwurf. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was versteht die Ausarbeitung unter „trägem Wissen“?
Die Ausarbeitung definiert „träges Wissen“ historisch und lerntheoretisch, ausgehend von Whiteheads Konzept des „inert knowledge“. Es werden verschiedene Erklärungsansätze für das Entstehen von trägem Wissen vorgestellt: Probleme mit Zugriffsprozessen auf Wissen, defizitäre Wissensstrukturen und die Vorstellung von Wissen als kontextunabhängiges Konstrukt.
Welche Aspekte situierten Lernens werden untersucht?
Die Ausarbeitung analysiert folgende Aspekte situierten Lernens: Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation und Reflexion sowie den sozialen Kontext des Lernens. Diese Analyse dient der Bewertung des Unterrichtsentwurfs.
Wie wird der Unterrichtsentwurf begründet?
Das Kapitel zur Begründung des Unterrichtsentwurfs beschreibt die Intentionen, die didaktische Reduktion und die Lernziele. Die Phasierung und das Durchführungskonzept werden detailliert erläutert und mit den theoretischen Grundlagen und empirischen Befunden verknüpft. Die didaktischen Entscheidungen werden begründet und ihre Relevanz für den Wissenstransfer und die Verminderung von trägem Wissen dargelegt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Ausarbeitung?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Träges Wissen, situiertes Lernen, Wissenstransfer, Handlungskompetenz, Unterrichtsgestaltung, Authentizität, Komplexität, multiple Perspektiven, Artikulation, Reflexion, sozialer Kontext, Instruktionsdesign, kognitive Flexibilität, metakognitives Wissen.
Wo finde ich den Unterrichtsentwurf?
Der Unterrichtsentwurf befindet sich im Anhang der Ausarbeitung.
Welchen Kontext hat die Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf den Kontext des Hamburger Schulgesetzes und den Anspruch an mündige Bürger.
- Citation du texte
- Waldemar Schmidt (Auteur), 2015, Träges Wissen im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion. Entwicklung von Problemlösungsfähigkeiten im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958639