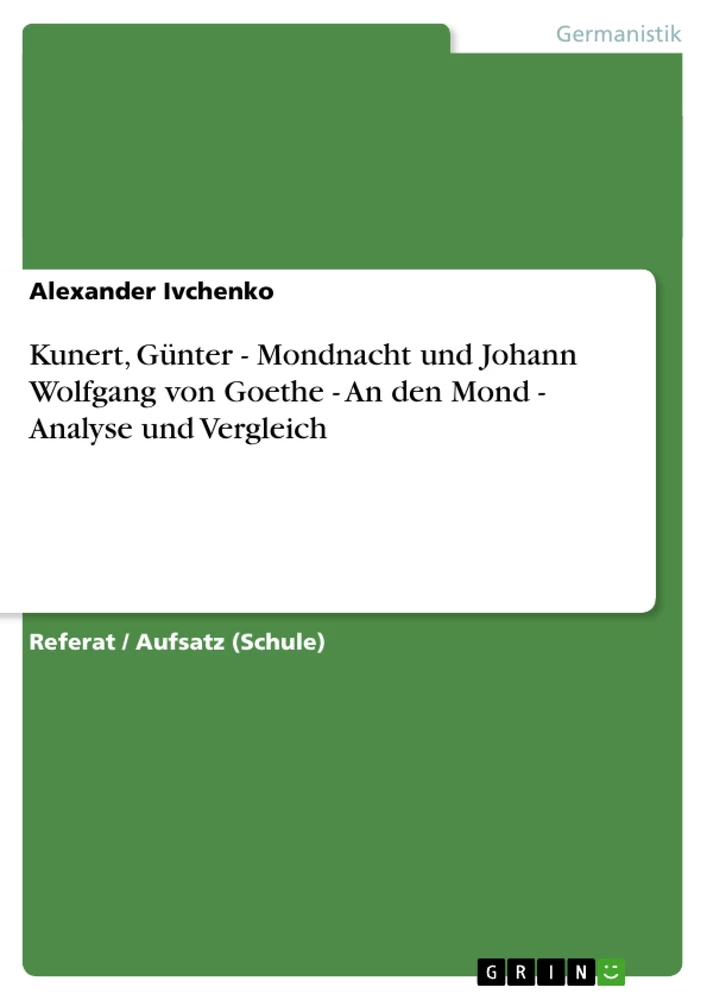Was bedeutet es, in einer Welt der ideologischen Zwänge nach Freiheit zu suchen? Diese Frage durchdringt Günter Kunerts "Mondnacht", eine eindringliche Auseinandersetzung mit der DDR, die den Leser in ein Labyrinth aus Chiffren und verborgenen Bedeutungen entführt. Kunert zeichnet ein düsteres Bild eines Staates, der seine Bürger entmündigt und an dunkle Kapitel der deutschen Geschichte erinnert. Im Kontrast dazu entfaltet Johann Wolfgang Goethes "An den Mond" eine Welt der inneren Einkehr und der romantischen Naturverbundenheit. Hier sucht das lyrische Ich Trost und Klarheit in der stillen Schönheit des Mondlichts, wobei die Natur zum Spiegelbild der eigenen Gefühlswelt wird. Doch während Goethe in der Harmonie der Natur eine Antwort auf die Zerrissenheit der Seele findet, konfrontiert Kunert den Leser mit der unerbittlichen Realität einer Gesellschaft, die keine Erlösung verspricht. Diese Gegenüberstellung zweier Epochen und Lebenswelten enthüllt die unterschiedlichen Wege, auf denen Dichter versuchen, die menschliche Erfahrung zu erfassen und zu deuten. "Mondnacht" ist ein Schlüssel zum Verständnis der DDR-Vergangenheit, während "An den Mond" eine zeitlose Reflexion über Liebe, Freundschaft und die heilende Kraft der Natur bietet. Gemeinsam werfen diese Werke ein Licht auf die individuellen und kollektiven Kämpfe um Freiheit, Identität und Sinnfindung – eine Reise durch die deutsche Seele, die von politischer Repression bis hin zur transzendenten Schönheit der Natur reicht. Entdecken Sie, wie diese beiden Gedichte, so unterschiedlich in Form und Inhalt, dennoch eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen des Menschseins darstellen und den Leser dazu anregen, über die eigene Rolle in der Welt nachzudenken. Tauchen Sie ein in die kontrastreichen Welten von Kunert und Goethe, und erleben Sie, wie Poesie zur Stimme der Unterdrückten und zum Spiegelbild der suchenden Seele werden kann. Eine unvergessliche Lektüre, die lange nachhallt und zum Nachdenken anregt.
Mondnacht
In dem Gedicht ,,Mondnacht" von Günter Kunert setzt sich der Autor mit der DDR und ihrem politischen System auseinander, die nicht seinen Vorstellungen von Sozialismus entspricht. Der Autor beschreibt die DDR und stellt dabei die Verbindung zum Dritten Reich her. Dann geht er wieder auf die Situation in der DDR ein.
Es liegt weder Reim noch ein Reimschema vor und auch keine konstante Metrik.
Die fehlende Interpunktion und die Enjambements (typische Zeichen für moderne Lyrik) erschweren das Lesen des Gedichtes, was den Leser zum Nachdenken und dadurch zum tiefern Verständnis führen sollen. Die einzelnen Verse sind mit Hilfe der Chiffren verkürzt worden. Durch die Chiffren entsteht beim Lesen der Eindruck, die einzelnen Verse haben keine Verbindung zwischen einander, erst beim wiederholten Lesen erkennt man die Zusammenhänge. Außerdem erzeugen die Chiffren einen gefühlsdistanzierten und rationalen Eindruck. Durch den Gebrauch von Präteritum und Präsens entstehen im Gedicht zwei unterschiedliche Zeitebenen, einmal die aktuelle Situation, die der Autor beschreibt und dann die Vergangenheit also der Bezug zum Dritten Reich. Der Höhepunkt des Gedichtes ist der letzte Vers, in dem der Autor auch mit einem Satz die Kernaussage des Textes wiedergibt. Sehr auffällig ist ebenfalls, daß das typische lyrische Ich hier nicht vorhanden ist, der Autor benutzt statt dessen Wir, das deppersonalisiert das Gedicht, da mit Wir jeder gemeint werden kann und bei einem lyrischen Ich nur eine ganz konkrete Person gemeint ist. Durch den häufigen Gebrauch von Symbolen, Bildern und Metaphern erschwert sich für den Leser der inhaltliche Zugang zum Gedicht, was zur Folge hat, daß der Leser sich intensiver mit dem Gedicht beschäftigen muß, um die verborgene Botschaft zu erkennen. Im ersten und zweiten Vers gebraucht der Autor Metaphern, um die DDR kurz zu charakterisieren. Er bezeichnet sie als leblosen Klotz, d.h. etwas, wo normales Leben oder die Entwicklung des Sozialismus nicht möglich ist. Durch den Tempuswechsel im Vers drei, stellt der Autor den Bezug zur Vergangenheit her. Mit einer Reihe von Metaphern und Bildern macht er deutlich, daß es sich ums Dritte Reich handelt, so meint er z.B. mit bitteren Märchen die Propaganda im Dritten Reich, in Versen sechs bis neun beschreibt er die Vernichtung der KZ-Gefangenen, durch den Vergleich Menschen wie Wölfe, wobei hier ,,wie" durch ,,anstelle" ersetzt wird. Im Vers zehn spricht der Autor vom Nachkriegsdeutschland, das er mit Hilfe der Metapher ,,geborstenes Geröll" beschreibt, da Deutschland nach Kriegsende komplett zerstört war.
Weiterhin personifiziert er das Wort Schatten, mit dem er die Deutschen meint, die nach dem Krieg ihre Individualität als Volk verloren haben und deswegen nur Schatten sind. Diese Schatten bewegen sich taumelnd, was ein Zeichen der Unsicherheit und Schwäche ist. Mit dem vierzehnten und fünfzehnten Vers bezieht er sich noch mal auf die Zeit vom Dritten Reich, die für das Nachkriegsdeutschland eine schwere Last wurde. In Versen sechzehn bis siebzehn, beschreibt er kurz die entstandene DDR, indem er sagt, daß man zwar dorthin gelangt ist, also zum scheinbaren Sozialismus, jedoch das Leben hier unmöglich sei. Im letzten Vers verurteilt er dann das System. Mit ,,Gleichnissen" meint er das Propagandasystem und ,,ohne Erbarmen" das totalitäre Regime, das dabei entstanden ist.
An den Mond
In dem Gedicht ,,An den Mond" von Johann Wolfgang Goethe, beschreibt das lyrische Ich die Natur, die seine Gefühle wiederspiegelt.
Das lyrische Ich spaziert bei Mondschein in der Natur, die es auch beschreibt und dann später seine eigenen Gefühle und Verwirrungen daran anknüpft. Am Anfang wendet sich das lyrische Ich an den Mond, in dem es den Freund und Erlöser sieht, ab der vierten Strophe jedoch tritt der Fluß als Spiegel der Gefühle in den Vordergrund. In der dritten Strophe wird erstmals klar, daß das lyrische Ich in der Natur Erlösung sucht, später in der vierten Strophe erkennt man, daß das lyrisch Ich unter anderem an den Folgen einer Liebesbeziehung leidet. In den letzten beiden Vierzeilern spricht das lyrische Ich von einer Männerfreundschaft, die Geborgenheit vermittelt und sich mit der Grundstimmung der Wehmut vereinbaren läßt. Das Gedicht bestehet aus neun einfachen Liederstrophen mit alternierendem Metrum. Der Autor gebraucht durchgehend Kreuzreim mit vier- und dreihebige Trochäen. Alle Verse sind männlich. Durch den Kreuzreim und konstanten Wechsel der Trochäen erhalten zwar alle Vierzeiler ein festes Gefüge, was für die klassische -harmonische und geschlossene- Lyrikform typisch ist und dem Leser die Aufnahme erleichtert, bringen jedoch auch die Bewegung, die beim Spaziergang entsteht zum Vorschein. Weiterhin ist der unregelmäßige Wechsel des Tempus auffällig, der Autor wechselt zwischen Präsens und Präteritum, dadurch wird der Wechsel zwischen dem aktuellen Problem und den Erinnerungen des lyrischen Ich deutlich zum Ausdruck gebracht. Außer der äußeren Bewegung, die an wechselnden Bildern zu erkennen ist, findet man auch eine innere Bewegung welche man am inhaltlichen Wechsel in den einzelnen Strophen erkennt, die innere Bewegung steigert sich von der ersten Strophe bis zu der letzten, in der es zu Loslösung der Gedanken vom gegenwärtigen Erlebnis und dem Verschmelzen des lyrischen Ich mit der Natur kommt.
Wie in vielen anderen Gedichten von Goethe (z.B.: Mailied) spielt die Natur in Verbindung mit Gefühlen und Emotionen eine große Rolle, da sie die Emotionen und Gefühle des lyrischen Ich wiederspiegelt. Um die Natur in aller ihrer Pracht darzustellen, gebraucht Goethe viele poetische Stilmittel, so z.B.: die Personifikation (Str1.V3, Str6 V3 usw.) , mit deren Hilfe er der Natur, insbesondere dem Mond und dem Fluß, menschliche Eigenschaften verleiht und sie damit zu gleichberechtigten Gesprächspartnern, ja sogar zu vertrauten Freunden macht. In Strophe drei benutzt der Autor in den Versen zwei und drei Antithesen, damit verdeutlicht er die innere Zerrissenheit des lyrischen Ich und stellt gleichzeitig eine Verbindung zu seiner Vergangenheit her. In der vierten Strophe gebraucht Goethe zur Beschreibung des Flusses eine Alliteration, dabei steht das Verb fließen im Imperativ, dadurch wird dem Leser die intensiven emotionalen Vorgänge des lyrischen Ich und der Wunsch sich von der peinigenden Zweispaltigkeit der Gefühle zu befreien, deutlich gemacht. In der sechsten Strophe benutzt Goethe eine Alliteration und ein Synonym (ohne Rast und Ruh), hier wird besonders deutlich, daß die Natur den seelischen Zustand wiederspiegelt, da auch das lyrische Ich nicht zur Ruhe kommen kann. Durch die im dritten Vers gebrauchte Antithese und darauf angeknüpfte Metapher werden die Emotionen des lyrischen Ich und die Rolle des Flusses als Freund und Erlöser deutlich. Durch die strophenumfassende Metapher im siebten Vierzeiler, in dem dem Fluß menschliche Eigenschaften zugewiesen werden, spiegelt er das leidende lyrische Ich, das sich auch zwischen zwei Extremen befindet, nämlich zwischen Aggressivität (beim Fluß: Wenn du in der Winternacht wütend überschwillst) und depressiver und melancholischer Stimmung. Durch diese Metapher stellt der Autor gleichzeitig eine Parallele zur dritten Strophe (zwischen Freud und Schmerz) her und beschreibt die aktuelle Situation in der sich das lyrische Ich befindet. In den letzten beiden Strophen spricht Goethe von einer Männerfreundschaft und von einem Freund dem man seine Sorgen und Gefühle, die Goethe durch die Metapher Labyrinth der Brust, womit er das menschliche Herz meint und damit das Zentrum der Gefühle, offenbaren kann. Die Position des Freundes nimmt in ,,An den Mond" die Natur an und damit kommt es in der letzten Strophe zur Verschmelzung des lyrischen Ich mit der Natur.
Vergleich
Häufig gestellte Fragen
- Was sind die Hauptthemen des Gedichts "Mondnacht" von Günter Kunert?
- Das Gedicht "Mondnacht" von Günter Kunert setzt sich mit der DDR und ihrem politischen System auseinander. Der Autor kritisiert die DDR, weil sie nicht seinen Vorstellungen von Sozialismus entspricht und stellt eine Verbindung zum Dritten Reich her.
- Welche formalen Merkmale weist "Mondnacht" auf?
- Das Gedicht hat weder Reim noch ein Reimschema und keine konstante Metrik. Die fehlende Interpunktion und die Enjambements sind typische Zeichen moderner Lyrik, die das Lesen erschweren und zum Nachdenken anregen sollen. Chiffren verkürzen die Verse und erzeugen einen gefühlsdistanzierten Eindruck. Der Gebrauch von Präteritum und Präsens erzeugt zwei unterschiedliche Zeitebenen.
- Welche sprachlichen Mittel werden in "Mondnacht" verwendet?
- Der Autor gebraucht Metaphern, Symbole und Bilder, um die DDR zu charakterisieren und eine Verbindung zum Dritten Reich herzustellen. Der Autor verwendet das Personalpronomen "Wir" anstatt eines lyrischen Ichs, um das Gedicht zu depersonalisieren.
- Was ist die Kernaussage des Gedichts "Mondnacht"?
- Die Kernaussage des Gedichts wird im letzten Vers deutlich, in dem das System der DDR verurteilt wird.
- Was sind die Hauptthemen des Gedichts "An den Mond" von Johann Wolfgang Goethe?
- In dem Gedicht "An den Mond" von Johann Wolfgang Goethe beschreibt das lyrische Ich die Natur und knüpft seine eigenen Gefühle und Verwirrungen daran an. Es thematisiert Naturerlebnisse, Liebeskummer und Männerfreundschaft.
- Welche formalen Merkmale weist "An den Mond" auf?
- Das Gedicht bestehet aus neun einfachen Liederstrophen mit alternierendem Metrum. Es verwendet durchgehend Kreuzreim mit vier- und dreihebigen Trochäen. Der Tempus wechselt zwischen Präsens und Präteritum.
- Welche sprachlichen Mittel werden in "An den Mond" verwendet?
- Goethe gebraucht Personifikationen, Antithesen, Alliterationen und Metaphern, um die Natur darzustellen und die Gefühle des lyrischen Ichs widerzuspiegeln. Die Natur wird zum gleichberechtigten Gesprächspartner und Freund.
- Welche Rolle spielt die Natur in "An den Mond"?
- Die Natur spielt eine große Rolle, da sie die Emotionen und Gefühle des lyrischen Ichs widerspiegelt. Sie wird durch Personifikationen und Metaphern lebendig dargestellt.
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen "An den Mond" und "Mondnacht"?
- "An den Mond" ist ein klassisches Gedicht, während "Mondnacht" ein modernes Gedicht ist. Sie unterscheiden sich stark im Stil und in der Thematik. In "An den Mond" versucht das lyrische Ich, sich über seine Liebesgefühle klarzuwerden, während "Mondnacht" die DDR und ihr politisches System kritisiert. Gemeinsam haben sie, dass sich die Autoren durch sie mit ihren inneren Konflikten auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Alexander Ivchenko (Auteur), 1999, Kunert, Günter - Mondnacht und Johann Wolfgang von Goethe - An den Mond - Analyse und Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95722