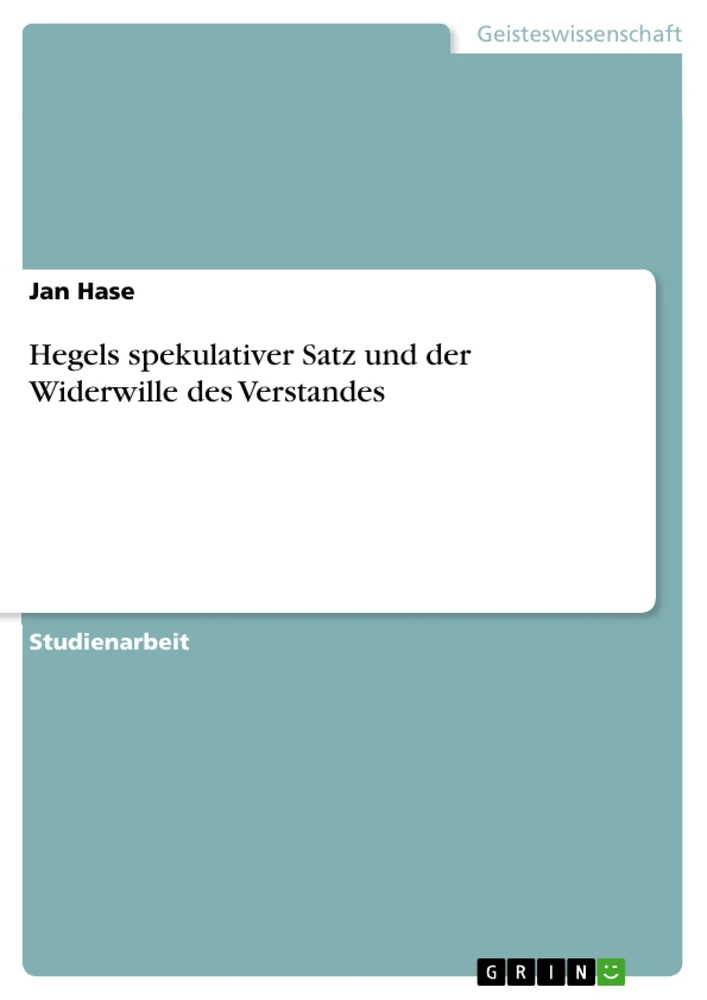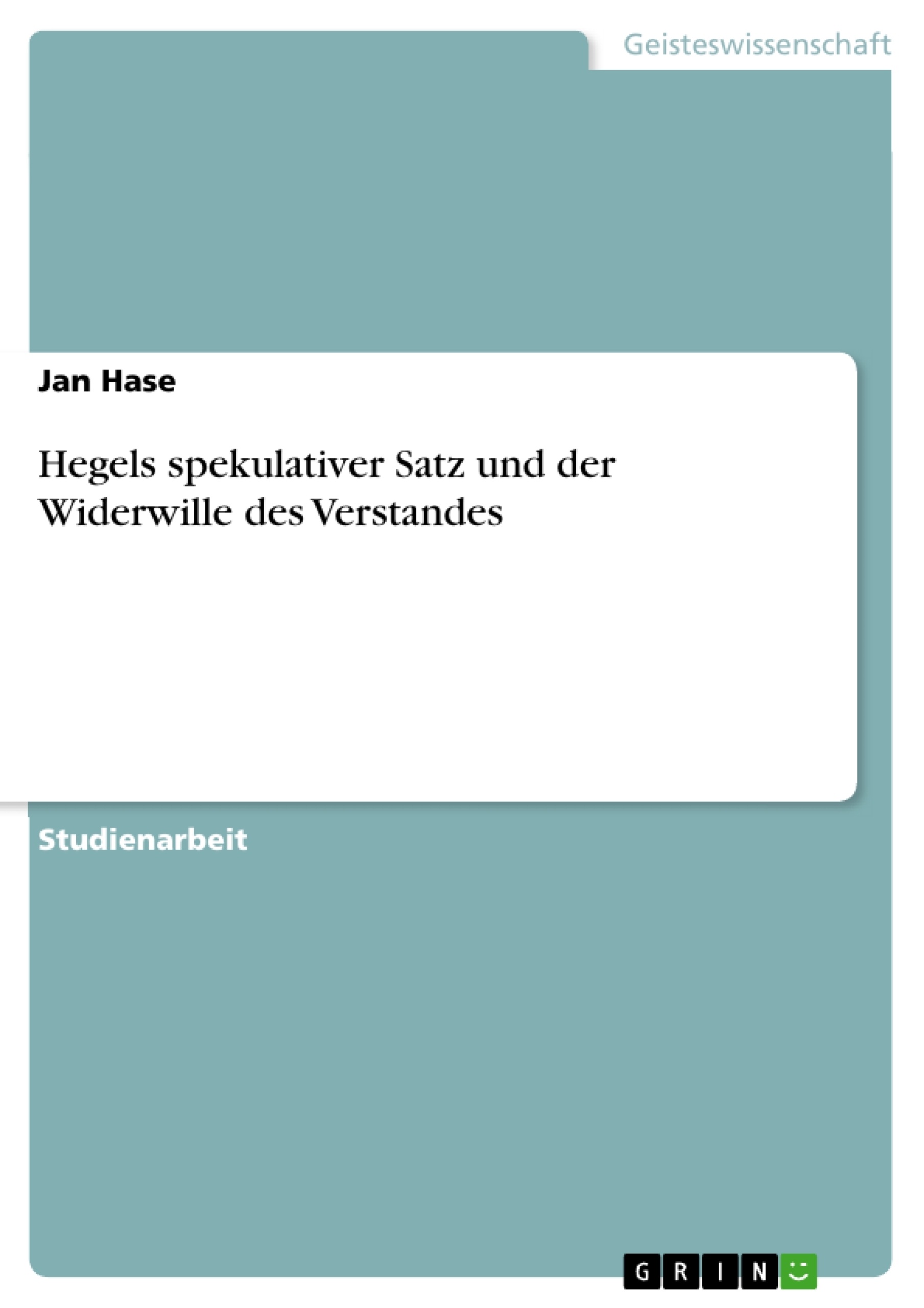Der Satz „Sein und Nichts ist eins und dasselbe“ stößt auf einen „Widerwillen“. Auf einen Widerwillen, der zu einer ablehnenden Haltung, gar zu Hass, werden kann. Denn der gesunde Menschenverstand muss den spekulativen Begriff hassen und damit auch die Satzform, in die er sich zu kleiden versucht.
Nun ist es das übergeordnete Anliegen dieser Arbeit zu ergründen, was überhaupt in Hegels Logik geschieht und welche Rolle die Sprache dabei spielt. Das ist nicht leicht zu beantworten. Eine Annäherung an eine Antwort, so jedenfalls die Hoffnung, ist möglich, wenn das Problem der Darstellung in den Blick genommen wird. Die gesamte Wissenschaft der Logik ist letztlich ein virtuoser Text, der sich augenscheinlich zumeist Sätzen in Subjekt-Prädikat-Struktur bedient und damit nichts Geringeres versucht, als das Absolute in einzelnen, aber zusammenhängenden Sätzen darzustellen. Dieser Text ist übersäht mit Wörtern der deutschen Sprache, die größtenteils noch immer allgemein geläufig sind und doch hat man beim Lesen oft nicht das Gefühl, der Herr im eigenen Haus der Sprache zu sein. Ein genauer Einblick in die zweite Anmerkung kann vielleicht zu Hinweisen dazu führen, warum dem so ist und was geschieht, wenn sich der Verstand gegen das Spekulative zunächst widerwillig sträubt, um zuletzt seine Grenzen zu überschreiten, d. h., sich auf es einzulassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein widerwilliger Satz
- Ein mangelhafter Satz
- Ein unglückliches Wort
- Ein spekulativer Schluss
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Hegels "Wissenschaft der Logik" und untersucht die Rolle des spekulativen Satzes "Sein und Nichts ist eins und dasselbe" im Kontext der Philosophiegeschichte. Sie beleuchtet die besondere Form des spekulativen Denkens, die im Konflikt mit dem "gesunden Menschenverstand" steht.
- Die Natur des spekulativen Satzes und sein Verhältnis zum "gesunden Menschenverstand"
- Hegels Darstellung der Einheit von Sein und Nichts in der "Wissenschaft der Logik"
- Die Rolle der Sprache und Darstellung in Hegels spekulativer Philosophie
- Die Grenzen des Verstandes und die Möglichkeit, diese zu überschreiten
- Die Bedeutung der Anmerkungen in Hegels Werk für das Verständnis des spekulativen Denkens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar, indem sie den "Widerwillen" des "gesunden Menschenverstands" gegen den spekulativen Satz "Sein und Nichts ist eins und dasselbe" beschreibt. Die Analyse beginnt mit einer genauen Betrachtung des Satzes selbst und seiner philosophischen Bedeutung.
Kapitel 2 beleuchtet den "Widerwillen" des Verstandes gegenüber dem spekulativen Begriff und die damit verbundenen Herausforderungen für die philosophische Analyse. Es wird die Rolle der Sprache und Darstellung in Hegels Philosophie sowie die Bedeutung der Anmerkungen in seinem Werk diskutiert.
Kapitel 3 setzt sich mit der Frage auseinander, wie sich der spekulativer Satz in Hegels "Wissenschaft der Logik" manifestiert und welche Rolle er für die gesamte Logik spielt.
Schlüsselwörter
Spekulativer Satz, Sein und Nichts, "gesunder Menschenverstand", Wissenschaft der Logik, Hegel, Sprache, Darstellung, Anmerkungen, Philosophiegeschichte, Grenzen des Verstandes
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hegels „spekulativer Satz“?
Ein zentrales Beispiel ist der Satz „Sein und Nichts ist eins und dasselbe“. Er drückt eine Identität aus, die der gewöhnliche Verstand als widersprüchlich ablehnt.
Warum empfindet der Verstand einen „Widerwillen“ gegen Hegels Logik?
Der „gesunde Menschenverstand“ denkt in festen Kategorien und Gegensätzen. Hegels spekulative Methode löst diese Grenzen auf, was als bedrohlich oder unsinnig empfunden werden kann.
Welche Rolle spielt die Sprache in der „Wissenschaft der Logik“?
Hegel nutzt die deutsche Sprache virtuos, um das Absolute darzustellen. Dabei müssen Wörter oft über ihre alltägliche Bedeutung hinaus im spekulativen Sinne verstanden werden.
Was geschieht beim „Überschreiten der Grenzen des Verstandes“?
Das Denken lässt sich auf das Spekulative ein und erkennt, dass Gegensätze wie Sein und Nichts in einer höheren Einheit (dem Werden) aufgehoben sind.
Warum sind die Anmerkungen in Hegels Werk so wichtig?
In den Anmerkungen setzt sich Hegel oft mit dem Widerstand des Verstandes und der Philosophiegeschichte auseinander, um den spekulativen Gehalt seiner Thesen zu erläutern.
Was ist das Ziel der Arbeit über Hegels spekulativen Satz?
Die Arbeit will ergründen, wie Hegels Logik funktioniert und warum der Verstand sich zunächst sträubt, bevor er die spekulative Wahrheit erfassen kann.
- Citar trabajo
- Jan Hase (Autor), 2016, Hegels spekulativer Satz und der Widerwille des Verstandes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/956157