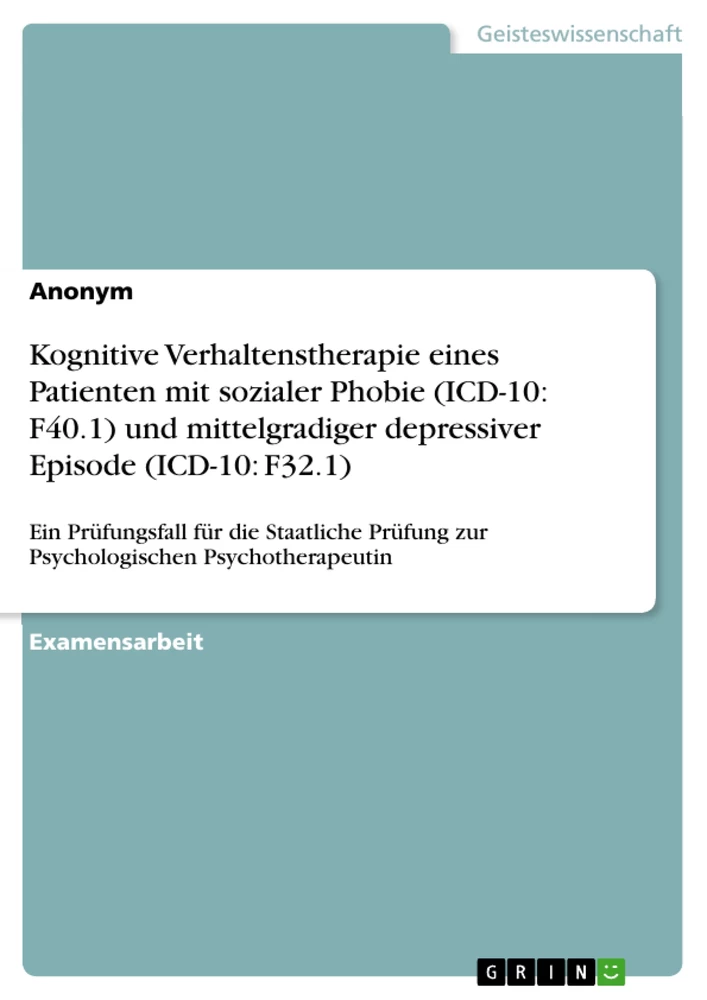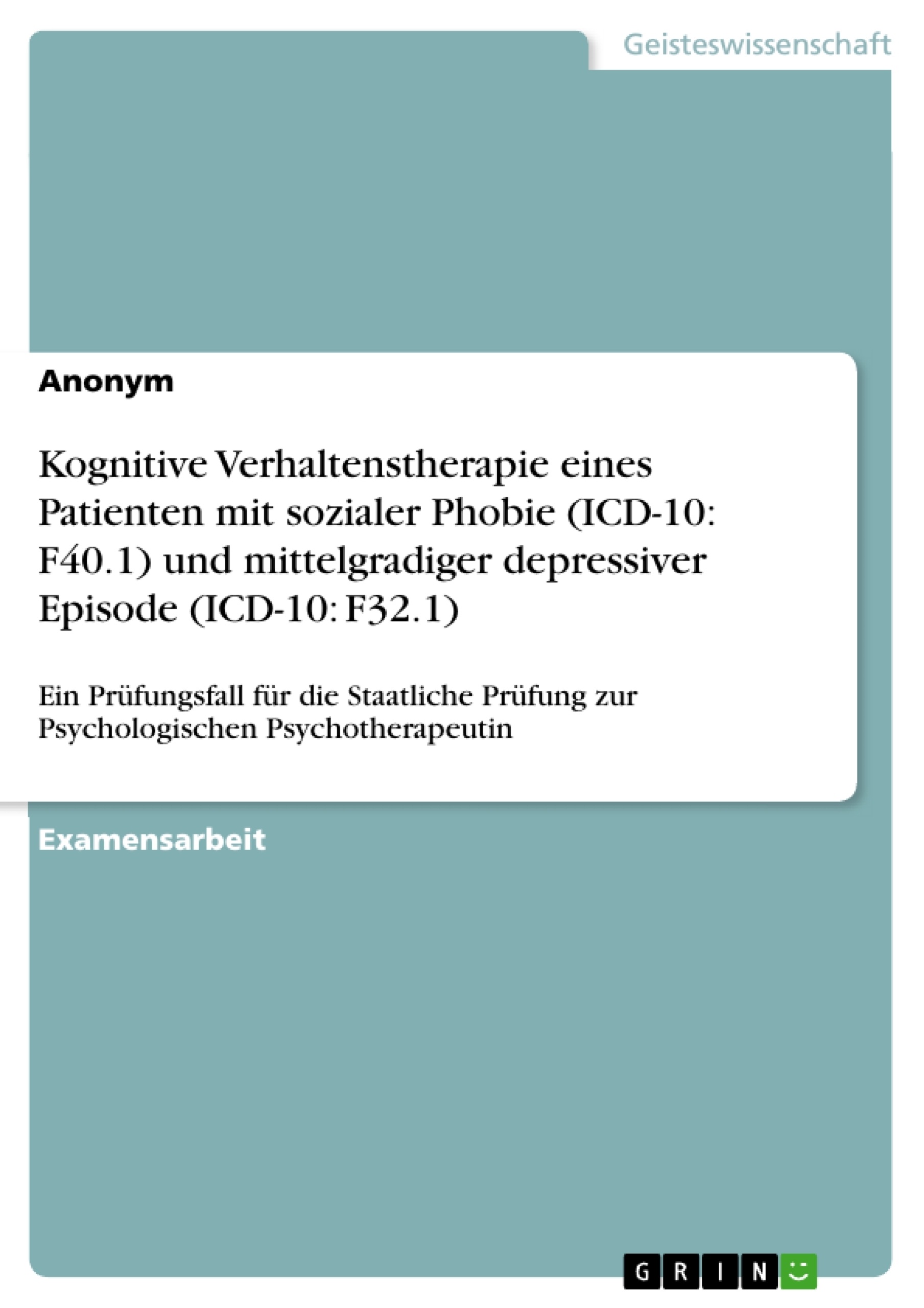Zur Aufnahme erschien ein 20-jähriger Patient. Er saß zusammengesunken auf dem Stuhl, hatte den Blick auf den Boden gerichtet und langen Haare verdeckten sein Gesicht. Es fiel ihm sichtlich schwer, sich zu artikulieren und er sprach nach langer Antwortlatenz mit sehr leiser Stimme wenige Worte, versuchte, nur mit Gesten zu antworten. Er berichtete, er habe Angst, mit fremden Menschen zu sprechen. Diese Angst bestehe schon immer. Außerdem erlebe er einen Verlust von Freude, leide an gedrückter Stimmung, Konzentrations- und Einschlafproblemen sowie an vermindertem Antrieb. Er habe die elfte Klasse aufgrund der sozialen Ängste wiederholen müssen, habe vermehrt schlechte Noten erhalten und sei schlussendlich nicht mehr in die Schule gegangen. Seitdem hätten sich die Ängste verstärkt. Der Patient sei seit einigen Monaten krankgeschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt
- 2. Aktuelle Anamnese
- 3. Biographische & soziale Anamnese
- 4. Psychopathologischer Befund
- 5. Diagnostik
- 6. Therapieziele
- 7. Therapieverlauf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Fallstudie besteht darin, die kognitive Verhaltenstherapie eines Patienten mit sozialer Phobie und mittelgradiger depressiver Episode zu dokumentieren und zu analysieren. Die Fallstudie beleuchtet den Therapieverlauf, die angewandten Methoden und die erzielten Ergebnisse. Die kritische Reflexion des Falles dient dem Zweck des Lernens und der Weiterentwicklung therapeutischer Kompetenzen.
- Soziale Phobie und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben
- Zusammenhang zwischen sozialer Phobie und depressiven Symptomen
- Einfluss frühkindlicher Traumatisierung und familiärer Belastung auf die psychische Gesundheit
- Anwendung kognitiver Verhaltenstherapie bei komplexen psychischen Störungen
- Bedeutung der therapeutischen Beziehung und Psychoedukation im Therapieprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Aktuelle Anamnese: Der Bericht beginnt mit der Darstellung eines 20-jährigen Patienten mit ausgeprägten sozialen Ängsten, depressiver Stimmung, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie Antriebslosigkeit. Seine Schulbildung ist aufgrund seiner Ängste beeinträchtigt, und er ist seit Monaten krankgeschrieben. Die Beschreibung seines Zustandes bei der ersten Begegnung mit dem Therapeuten betont seine körperliche und emotionale Anspannung sowie seine Schwierigkeiten, verbal zu kommunizieren. Diese Einleitung legt den Fokus auf die akuten Symptome und den dringenden Hilfebedarf des Patienten.
Biographische & soziale Anamnese: Dieses Kapitel schildert die belastende Vorgeschichte des Patienten. Eine Risikoschwangerschaft der Mutter mit anschließenden Komplikationen, ein schwieriger Start ins Leben mit Klinikaufenthalten, eine kranke Mutter mit wechselhaften Verhaltensweisen und die Notwendigkeit, sich frühzeitig um die Eltern zu kümmern, werden als prägende Faktoren beschrieben. Die frühe Trennung der Eltern und die Konflikte im familiären Umfeld werden als zusätzliche Belastung hervorgehoben. Die Kapitel betont den Einfluss frühkindlicher Traumatisierung und familiärer Dysfunktionen auf die Entwicklung der psychischen Erkrankung.
Psychopathologischer Befund: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert das Erscheinungsbild und Verhalten des Patienten während der Untersuchung. Seine körperliche Anspannung, der Blickkontaktvermeidung, seine leise und undeutliche Sprache sowie seine Konzentrationsstörungen werden festgehalten. Es wird betont, dass trotz der ausgeprägten Ängste in sozialen Situationen, keine psychotischen Symptome vorliegen. Die affektive Abflachung und das Vermeidungsverhalten werden als zentrale Symptome beschrieben. Das Fehlen von Suizidalität wird hervorgehoben.
Diagnostik: Die Diagnostik erfolgte mittels des KPD-38 und des BDI-II. Die Ergebnisse zeigen deutlich erhöhte Werte auf verschiedenen Skalen, die den Leidensdruck des Patienten bestätigen. Die Diagnosen Soziale Phobie (F40.1), mittelgradige depressive Episode (F32.1), Kranker Familienangehöriger (Z63.7) und Probleme mit Bezug auf die Ausbildung (Z55.4) werden gestellt. Die positive Veränderung der Ergebnisse nach der stationären Behandlung wird ebenfalls dokumentiert.
Therapieziele: Die Therapieziele umfassen den Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Erarbeitung eines Krankheitsmodells, Psychoedukation, die Verbesserung der Emotionswahrnehmung, die Entwicklung funktionaler Strategien zur Bewältigung der Depression und die Aktivierung von Ressourcen. Diese Ziele bilden einen strukturierten Rahmen für den Therapieprozess.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Depression, Kognitive Verhaltenstherapie, Psychoedukation, Frühkindliche Traumatisierung, Familiäre Belastung, Ressourcenaktivierung, Vermeidungsverhalten, Therapieverlauf, Diagnostik.
Häufig gestellte Fragen zur Fallstudie: Kognitive Verhaltenstherapie bei sozialer Phobie und Depression
Was ist der Gegenstand dieser Fallstudie?
Die Fallstudie dokumentiert und analysiert die kognitive Verhaltenstherapie eines 20-jährigen Patienten mit sozialer Phobie und einer mittelgradigen depressiven Episode. Sie beleuchtet den Therapieverlauf, die angewandten Methoden und die erzielten Ergebnisse. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss frühkindlicher Traumatisierung und familiärer Belastung auf die psychische Erkrankung.
Welche Kapitel umfasst die Fallstudie?
Die Fallstudie gliedert sich in die Kapitel: Inhalt, Aktuelle Anamnese, Biographische & soziale Anamnese, Psychopathologischer Befund, Diagnostik, Therapieziele und Therapieverlauf.
Welche Symptome zeigt der Patient zu Beginn der Therapie?
Der Patient leidet unter ausgeprägten sozialen Ängsten, depressiver Stimmung, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie Antriebslosigkeit. Er ist krankgeschrieben und seine Schulbildung ist beeinträchtigt. Körperliche und emotionale Anspannung sowie Schwierigkeiten in der verbalen Kommunikation sind auffällig.
Welche Informationen enthält die biographische und soziale Anamnese?
Die biographische und soziale Anamnese beschreibt eine belastende Vorgeschichte mit Risikoschwangerschaft der Mutter, Komplikationen nach der Geburt, Klinikaufenthalten, einer kranken Mutter mit wechselhaftem Verhalten, frühzeitiger Fürsorgepflicht für die Eltern, Trennung der Eltern und familiären Konflikten. Diese Faktoren werden als prägend für die Entwicklung der psychischen Erkrankung betrachtet.
Wie wird der psychopathologische Befund beschrieben?
Der psychopathologische Befund beschreibt körperliche Anspannung, Blickkontaktvermeidung, leise und undeutliche Sprache, Konzentrationsstörungen und affektive Abflachung. Trotz der ausgeprägten sozialen Ängste sind keine psychotischen Symptome vorhanden. Das Vermeidungsverhalten wird als zentrales Symptom beschrieben. Suizidalität liegt nicht vor.
Welche diagnostischen Verfahren wurden angewendet und welche Diagnosen wurden gestellt?
Es wurden der KPD-38 und der BDI-II eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten deutlich erhöhte Werte, was den Leidensdruck des Patienten bestätigt. Die Diagnosen lauten: Soziale Phobie (F40.1), mittelgradige depressive Episode (F32.1), Kranker Familienangehöriger (Z63.7) und Probleme mit Bezug auf die Ausbildung (Z55.4).
Welche Therapieziele wurden formuliert?
Die Therapieziele umfassen den Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Erarbeitung eines Krankheitsmodells, Psychoedukation, die Verbesserung der Emotionswahrnehmung, die Entwicklung funktionaler Strategien zur Bewältigung der Depression und die Aktivierung von Ressourcen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Fallstudie?
Schlüsselwörter sind: Soziale Phobie, Depression, Kognitive Verhaltenstherapie, Psychoedukation, Frühkindliche Traumatisierung, Familiäre Belastung, Ressourcenaktivierung, Vermeidungsverhalten, Therapieverlauf, Diagnostik.
Welche Therapieform wird angewendet?
Die Fallstudie konzentriert sich auf die kognitive Verhaltenstherapie (KVT).
Welche Rolle spielt die frühkindliche Traumatisierung in dieser Fallstudie?
Die frühkindliche Traumatisierung und die familiären Belastungen werden als wichtige Faktoren für die Entstehung der sozialen Phobie und der Depression des Patienten betrachtet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Kognitive Verhaltenstherapie eines Patienten mit sozialer Phobie (ICD-10: F40.1) und mittelgradiger depressiver Episode (ICD-10: F32.1), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/955790