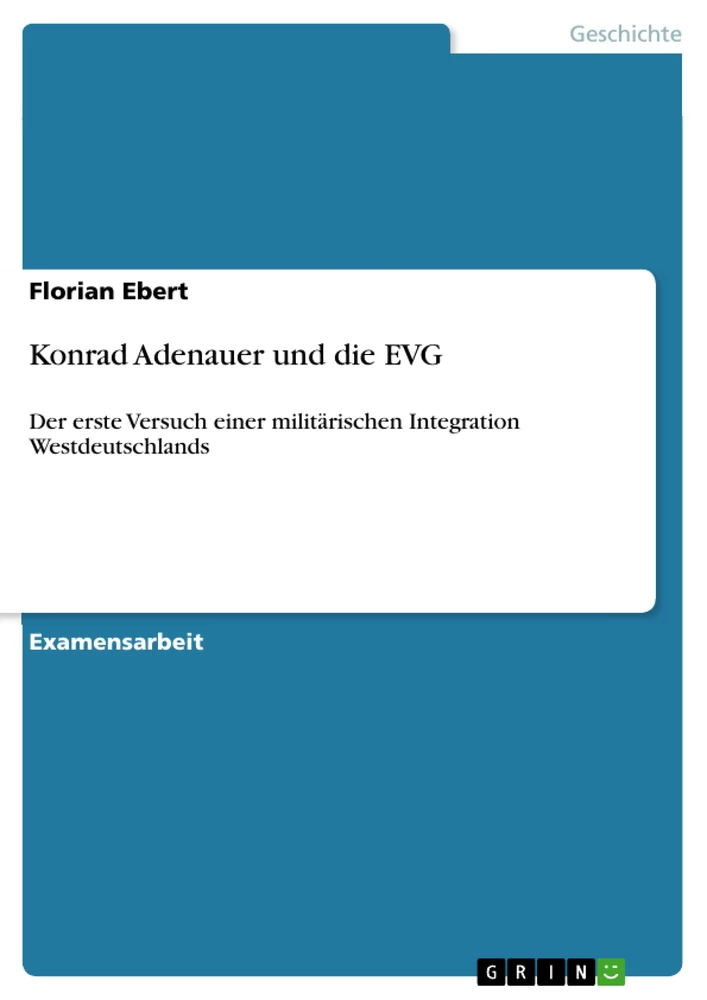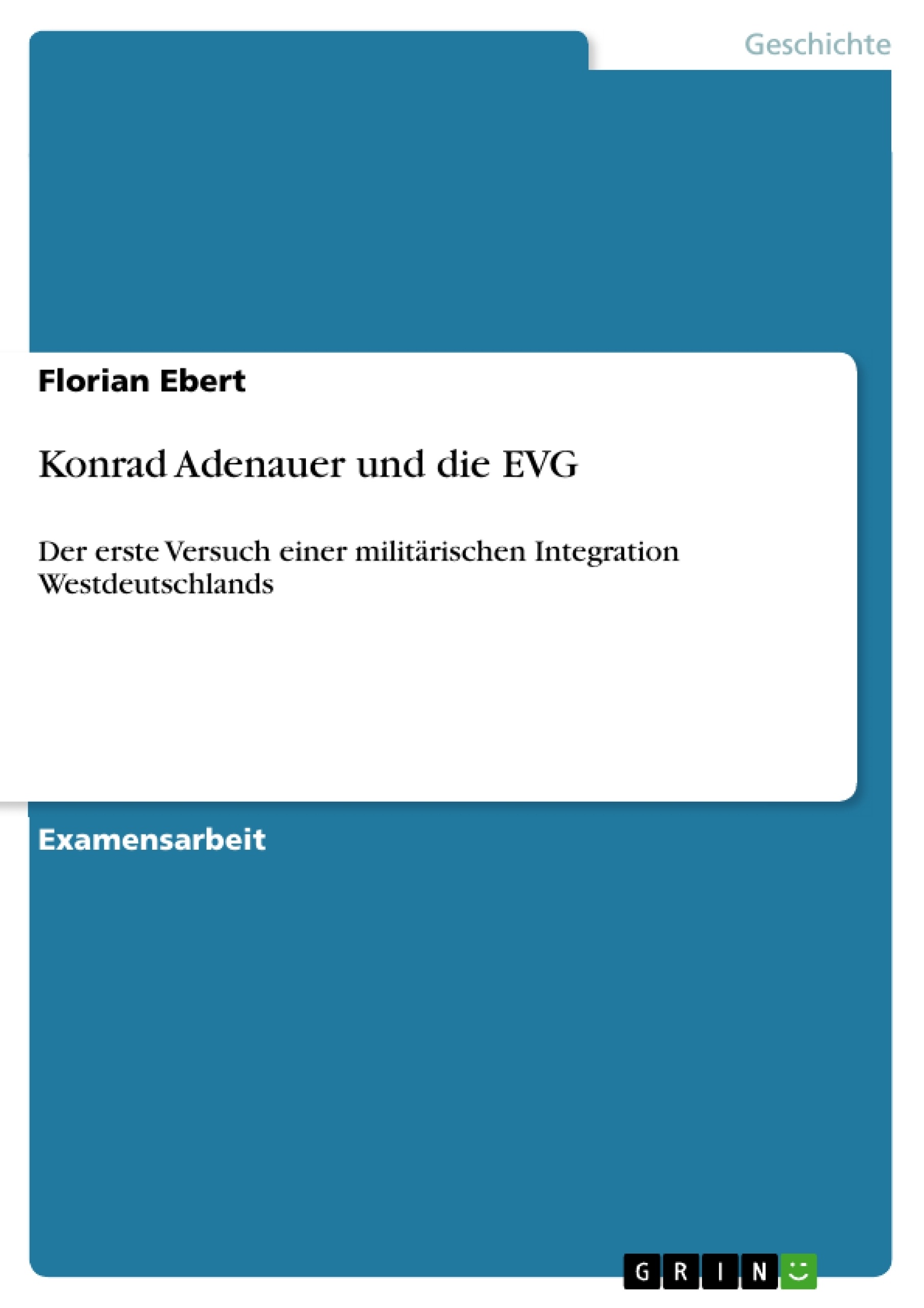Sollten einmal deutsche Verbände aufgestellt werden, so dürften diese keine deutsche Truppe sein, sondern eine „europäische Truppe, in der Deutsche sind, [denn] eine europäische Truppe würde gleichzeitig bedeuten den Anfang eines wirklichen Europas, einer europäischen Macht.“ So Konrad Adenauer, der Präsident des Parlamentarischen Rates, Anfang Januar 1949 in einer Ansprache vor CDU-Spitzen in Königswinter. Kaum anderthalb Jahre später sollte der französische Ministerpräsident René Pleven den Plan zur Schaffung europäischer Streitkräfte vorlegen. Europäische Streitkräfte, an denen die Bundesrepublik Deutschland zu beteiligen war .
Obwohl Adenauer immer jegliche militärischen Einflüsse auf die Politik abgelehnt hatte, war er der festen Überzeugung, dass es für die Bundesrepublik absolut notwendig sei, zu einer bewaffneten Macht zu kommen. Ein außenpolitischer Aufstieg des neuen Staates konnte nur unter der Voraussetzung gelingen, dass die Westalliierten, allen voran die USA, erkannten, dass ein starkes Westdeutschland in ihrem Interesse lag. Die alliierten Sieger hatten die besiegten Deutschen die gegebenen Machtverhältnisse deutlich spüren lassen. Es war Adenauer stets vor Augen geführt worden, wie machtlos die noch junge Bundesrepublik war; von den Absichten und Entscheidungen der Westmächte vollkommen abhängig. So sah Adenauer es als dringend notwendig an, die Bundesrepublik zu stärken, denn: „ wenn man keine Kraft besitzt, kann man keine Politik machen. Ohne Kraft wird unser Wort nicht beachtet.“ Und mit Kraft meinte er wohl letztlich auch militärische Stärke.
Warum sollte man nun, da mit Frankreich der ärgste Widersacher einer Aufrüstung Westdeutschlands quasi zugestimmt hatte, die Bundesrepublik Deutschland nicht im Rahmen einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft aufrüsten und so einen außenpolitischen Aufstieg erreichen? Weiß man um das historisch bedingte schwierige Verhältnis zwischen Frankreich und der Deutschland, wird deutlich, dass der französische Ministerpräsident niemals ungezwungen und von sich aus Adenauer die Chance für die Bewaffnung der Bundesrepublik Deutschland geliefert hätte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Aufrüstung Westdeutschlands
- 2.1. Überlegungen der Westalliierten
- 2.2. Überlegungen Adenauers
- 3. Das erste Angebot einer militärischen Beteiligung
- 3.1. Das Speidelmemorandum
- 3.2. Bedrohungsanalyse und notwendige Konsequenzen
- 3.3. Erste Ideen einer Europa-Armee
- 3.3.1. Churchills Idee einer Europa-Armee
- 3.3.2. Adenauers Vorstellungen und Bestrebungen
- 3.4. Die Memoranden Adenauers vom August 1950
- 3.5. New Yorker Außenministerkonferenz und NATO-Ratstagung
- 3.6. Adenauers Reaktion auf die New Yorker Konferenzen
- 3.7. Zwischenfazit I
- 4. Der Pleven-Plan
- 4.1. Konzept
- 4.2. Der Pleven-Plan aus der Sicht Adenauers
- 4.3. Zwischenlösung: Spofford-Kompromiss
- 4.4. Petersberg oder Paris?- Die Brüsseler Beschlüsse
- 4.5. Petersberg-Gespräche
- 5. Die Pleven-Plan-Verhandlungen
- 5.1. Adenauers Ausgangslage
- 5.2. Verhandlungen bis Juni 1951
- 5.3. Ausweg aus festgefahrenen Verhandlungen: EVG
- 5.3.1. Amerikanisches und britisches Einlenken
- 5.3.2. Umdenken bei Adenauer
- 5.4. Verhandlungen bis zum Zwischenbericht
- 5.5. Zwischenbericht
- 5.6. Adenauer schwenkt auf EVG-Kurs
- 5.7. Sicherheitsvertrag und Zwischenlösung
- 5.8. Überlegungen über den politischen Rahmen der EVG
- 5.9. Zwischenfazit II
- 6. Das Drängen Adenauers auf Gleichberechtigung
- 6.1. Junktim zwischen EVG- und Generalvertrag
- 6.2. Schwierige Verhandlungspunkte
- 6.2.1. Verknüpfung von EVG und NATO
- 6.2.2. Rüstungskontrolle
- 6.2.3. Problem der Finanzierung
- 7. Störfeuer
- 7.1. Saarfrage als Hemmfaktor
- 7.2. Stalin-Note
- 8. Die Unterzeichnung der Verträge
- 8.1. Schwierigkeiten kurz vor der Unterzeichnung
- 8.2. EVG-Vertrag samt Zusatzverträgen
- 9. Ratifizierung in der Bundesrepublik
- 9.1. Innenpolitische Wertung
- 9.2. Ratifizierungsvorhaben
- 9.3. Verlauf der Ratifizierung
- 9.3.1. Klage vor dem Bundesverfassungsgericht
- 9.3.2. Gutachten für den Bundespräsidenten
- 9.3.3. Zweite Lesung und Feststellungsklage
- 9.3.4. Dritte Lesung der Verträge und Ratifizierung
- 10. Die Europäische Politische Gemeinschaft
- 11. Der Todeskampf der EVG
- 11.1. Warten auf die Ratifizierung durch Frankreich
- 11.2. Berliner Außenministerkonferenz
- 11.3. Regierungswechsel in Frankreich
- 11.4. Brüsseler Außenministerkonferenz
- 12. Das Scheitern der EVG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Versuch einer militärischen Integration Westdeutschlands in die westliche Sicherheitsarchitektur nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Fokus steht die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und ihre Rolle in der Debatte um die Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland.
- Die Herausforderungen der Aufrüstung Westdeutschlands im Kontext der europäischen Sicherheitspolitik
- Die Rolle Konrad Adenauers in der Debatte um die militärische Integration Westdeutschlands
- Die Entstehung und Entwicklung des Pleven-Plans
- Die Verhandlungsdynamik und die politischen Kompromisse, die zur Gründung der EVG führten
- Die Gründe für das Scheitern der EVG und ihre Folgen für die europäische Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Aufrüstung Westdeutschlands ein und stellt die zentrale Rolle Konrad Adenauers in diesem Prozess dar. Das zweite Kapitel analysiert die Überlegungen der Westalliierten und Adenauers zur Aufrüstung Westdeutschlands. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem ersten Angebot einer militärischen Beteiligung Westdeutschlands an einem europäischen Verteidigungspakt, dem Speidelmemorandum, und den darauf folgenden Entwicklungen. Im vierten Kapitel wird der Pleven-Plan, ein Konzept zur Gründung einer europäischen Streitmacht, vorgestellt und aus der Sicht Adenauers analysiert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Verhandlungen zur Umsetzung des Pleven-Plans und dem Übergang zur EVG. Das sechste Kapitel untersucht Adenauers Bemühungen um die Gleichberechtigung der Bundesrepublik innerhalb der EVG. Das siebte Kapitel beleuchtet die Störfaktoren, die die Verhandlungen über die EVG erschwerten. Das achte Kapitel behandelt die Unterzeichnung der Verträge zur EVG. Das neunte Kapitel befasst sich mit der Ratifizierung der Verträge in der Bundesrepublik Deutschland. Das zehnte Kapitel beschreibt die Europäische Politische Gemeinschaft, ein paralleles Projekt zur EVG. Das elfte Kapitel schildert den Todeskampf der EVG, die durch den Widerstand Frankreichs letztendlich scheiterte.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt Themen wie die Aufrüstung Westdeutschlands, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Konrad Adenauer, der Pleven-Plan, die Verhandlungsdynamik der Nachkriegszeit, die europäische Sicherheitspolitik und das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland.
- Citation du texte
- Florian Ebert (Auteur), 2007, Konrad Adenauer und die EVG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94675