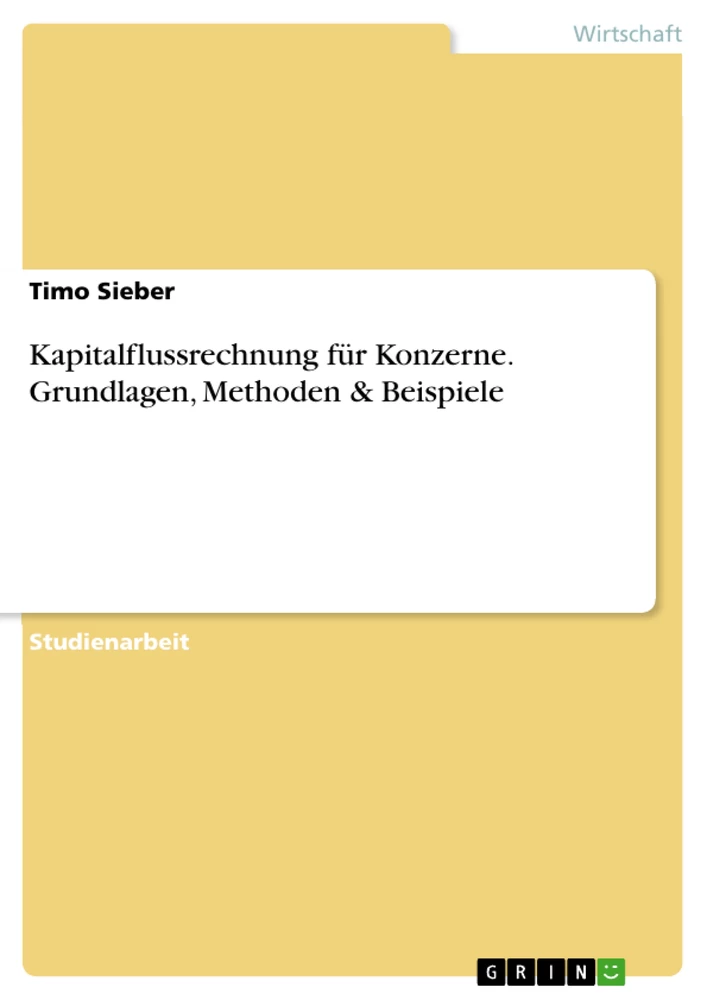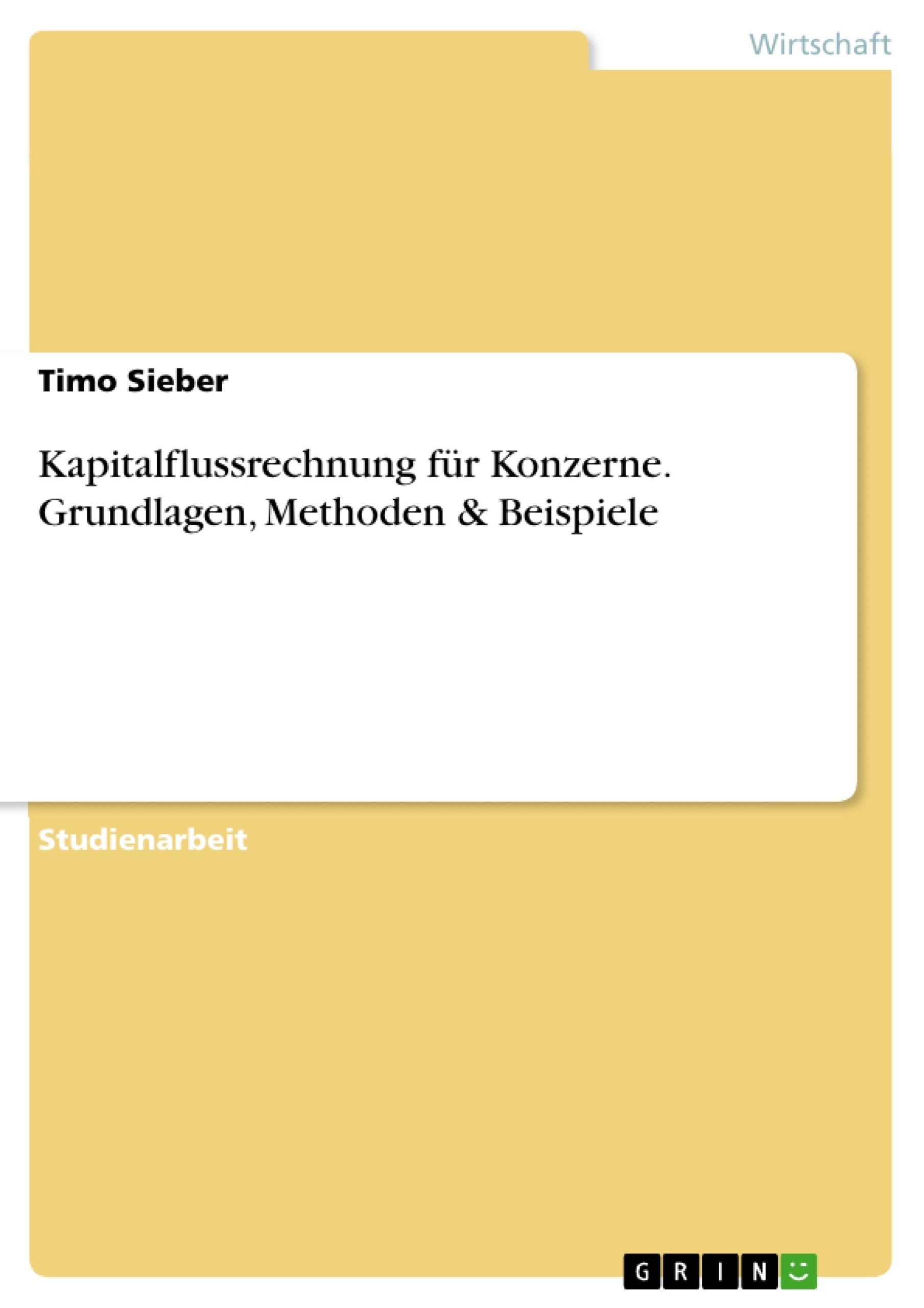Die vorliegende Seminararbeit beginnt zunächst mit theoretischen Informationen, zum Beispiel zum Thema Konzernrechnungslegung im Allgemeinen, und zeigt die Notwendigkeit zur Aufstellung sowie die einzelnen Bestandteile einer Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS auf. In Folge dessen wird gezielt auf die Kapitalflussrechnung eingegangen, beginnend mit Definitionen und Rechtsvorschriften bis hin zu konkreten Aufstellungsmöglichkeiten. Im Zuge dessen wird auch auf die verschiedenen Cashflow-arten und deren Ermittlung eingegangen. Ein anschließendes Rechenbeispiel in Kapitel vier soll dem Leser einen Einblick in die unternehmerische Praxis bieten. Abgerundet wird die Seminararbeit mit einem Fazit. Am Ende der Arbeit soll der Leser einen guten Einblick und Einstieg in die Konzernrechnungslegung und spezieller in die Konzernkapitalflussrechnung als Teil davon bekommen haben.
Spricht man von Konzernen, so fallen einem sofort zahlreiche Beispiele wie BASF, Daimler, Google oder Apple ein. Doch ist hier laut Definition tatsächlich auch immer von einem Konzern die Rede, oder wird in der Umgangssprache jedes größere Unternehmen direkt zum Konzern "befördert"? Ein ähnliches Bild ergibt sich wohl für die Finanzberichte von Unternehmen. Ist in der Gesamtbevölkerung von ihnen Rede, werden viele nur an die Bilanz und gegebenenfalls an die Gewinn- und Verlustrechnung denken. Die Wenigsten werden den Finanzbericht mit einer Kapitalflussrechnung assoziieren. Diese Arbeit möchte daher Aufklärung schaffen, indem sie das Konstrukt "Konzern" definiert, einige Grundlagen der Konzernrechnungslegung zeigt und sich schließlich der (Konzern-)Kapitalflussrechnung widmet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Konzernrechnungslegung im Allgemeinen
- 2.1 Notwendigkeit einer Konzernrechnungslegung
- 2.2 Bestandteile der Konzernrechnungslegung nach HGB
- 2.3 Bestandteile der Konzernrechnungslegung nach IFRS
- 2.4 Einschlägige Rechtsvorschriften
- 3 Kapitalflussrechnung
- 3.1 Definition und Pflicht zur Aufstellung
- 3.2 Grundlegender Aufbau
- 3.3 Erstellung von Konzernkapitalflussrechnungen
- 3.3.1 Bruttoprinzip
- 3.3.2 Direkte und indirekte Ermittlung des Cashflows aus laufender Tätigkeit
- 3.3.3 Direkte Ermittlung des Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- 3.3.4 Konsolidierung der Einzel-Kapitalflussrechnungen der einbezogenen Unternehmen
- 3.3.5 Derivative Ermittlung der konsolidierten Kapitalflussrechnung aus Konzernbilanz und Konzern-Erfolgsrechnung
- 3.3.6 Anhangsangaben
- 3.3.7 Ausgewählte gesetzliche Unterschiede
- 4 Praxisbeispiel
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Konzernkapitalflussrechnung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Erstellung und des Aufbaus einer solchen Rechnung zu vermitteln, sowohl nach HGB als auch nach IFRS. Dabei werden die relevanten Rechtsvorschriften berücksichtigt und ein Praxisbeispiel analysiert.
- Notwendigkeit und Aufbau der Konzernrechnungslegung
- Definition und Erstellung der Kapitalflussrechnung
- Unterschiede zwischen direkter und indirekter Methode zur Ermittlung des Cashflows
- Relevanz der Konzernkapitalflussrechnung für das Management
- Gesetzliche Unterschiede bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Konzernkapitalflussrechnung ein und definiert die Problemstellung der Arbeit. Es skizziert die Ziele und den Aufbau der folgenden Kapitel.
2 Konzernrechnungslegung im Allgemeinen: Dieses Kapitel behandelt die Notwendigkeit einer Konzernrechnungslegung, ihre Bestandteile nach HGB und IFRS sowie die einschlägigen Rechtsvorschriften. Es legt die Grundlage für das Verständnis der Konzernkapitalflussrechnung, indem es den Kontext der Konzernrechnungslegung im Ganzen erläutert und die Unterschiede zwischen den nationalen (HGB) und internationalen (IFRS) Rechnungslegungsstandards aufzeigt.
3 Kapitalflussrechnung: Dieser zentrale Abschnitt definiert die Kapitalflussrechnung, beschreibt ihren grundlegenden Aufbau und erläutert detailliert die verschiedenen Methoden ihrer Erstellung, insbesondere das Bruttoprinzip, die direkte und indirekte Methode zur Cashflow-Ermittlung aus operativer Tätigkeit, sowie die Behandlung von Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Die Konsolidierung der Einzelrechnungen und die Ableitung aus Konzernbilanz und -erfolgsrechnung werden ebenso behandelt wie die notwendigen Anhangsangaben und ausgewählte gesetzliche Unterschiede.
4 Praxisbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Beispiel zur Erstellung einer Konzernkapitalflussrechnung, veranschaulicht die in Kapitel 3 beschriebenen Methoden und verdeutlicht die praktische Anwendung des theoretischen Wissens. Es dient als Vertiefung und zur Anwendung der zuvor erlernten Konzepte.
Schlüsselwörter
Konzernkapitalflussrechnung, Konzernrechnungslegung, HGB, IFRS, Cashflow, Direkte Methode, Indirekte Methode, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit, operative Tätigkeit, Konsolidierung, Anhangsangaben, Rechtsvorschriften.
Häufig gestellte Fragen zur Konzernkapitalflussrechnung
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Konzernkapitalflussrechnung. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Erstellung und dem Aufbau einer Konzernkapitalflussrechnung nach HGB und IFRS, unter Berücksichtigung relevanter Rechtsvorschriften und anhand eines Praxisbeispiels.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: die Notwendigkeit und den Aufbau der Konzernrechnungslegung, die Definition und Erstellung der Kapitalflussrechnung (inklusive direkter und indirekter Methode), die Unterschiede zwischen HGB und IFRS, die Relevanz der Konzernkapitalflussrechnung für das Management und gesetzliche Unterschiede bei der Erstellung der Kapitalflussrechnung. Ein Praxisbeispiel veranschaulicht die Anwendung der theoretischen Konzepte.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Konzernrechnungslegung im Allgemeinen, ein zentrales Kapitel zur Kapitalflussrechnung (inklusive detaillierter Erläuterung der Methoden), ein Kapitel mit einem Praxisbeispiel und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlicher beschrieben.
Wie wird die Kapitalflussrechnung erstellt?
Die Hausarbeit erläutert detailliert die verschiedenen Methoden zur Erstellung der Kapitalflussrechnung. Es werden das Bruttoprinzip, die direkte und indirekte Methode zur Ermittlung des Cashflows aus operativer Tätigkeit sowie die Behandlung von Investitions- und Finanzierungstätigkeiten behandelt. Die Konsolidierung der Einzelrechnungen und die Ableitung aus Konzernbilanz und -erfolgsrechnung werden ebenfalls ausführlich beschrieben.
Welche Unterschiede bestehen zwischen HGB und IFRS in Bezug auf die Konzernkapitalflussrechnung?
Die Hausarbeit hebt die Unterschiede zwischen den nationalen (HGB) und internationalen (IFRS) Rechnungslegungsstandards bezüglich der Konzernkapitalflussrechnung hervor. Diese Unterschiede werden sowohl im Kapitel zur Konzernrechnungslegung im Allgemeinen als auch im Kapitel zur Kapitalflussrechnung explizit angesprochen und im Kontext der jeweiligen Methoden und gesetzlichen Anforderungen erläutert. Konkrete Beispiele werden im Praxisbeispiel verdeutlicht.
Welche Bedeutung hat die Konzernkapitalflussrechnung für das Management?
Die Relevanz der Konzernkapitalflussrechnung für das Management wird in der Hausarbeit thematisiert. Obwohl nicht explizit als eigenes Kapitel ausgewiesen, wird die Bedeutung des Cashflows und die daraus resultierenden Managemententscheidungen implizit durch die detaillierte Beschreibung der Erstellung und Interpretation der Kapitalflussrechnung vermittelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Konzernkapitalflussrechnung, Konzernrechnungslegung, HGB, IFRS, Cashflow, Direkte Methode, Indirekte Methode, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit, operative Tätigkeit, Konsolidierung, Anhangsangaben, Rechtsvorschriften.
- Quote paper
- Timo Sieber (Author), 2020, Kapitalflussrechnung für Konzerne. Grundlagen, Methoden & Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945796