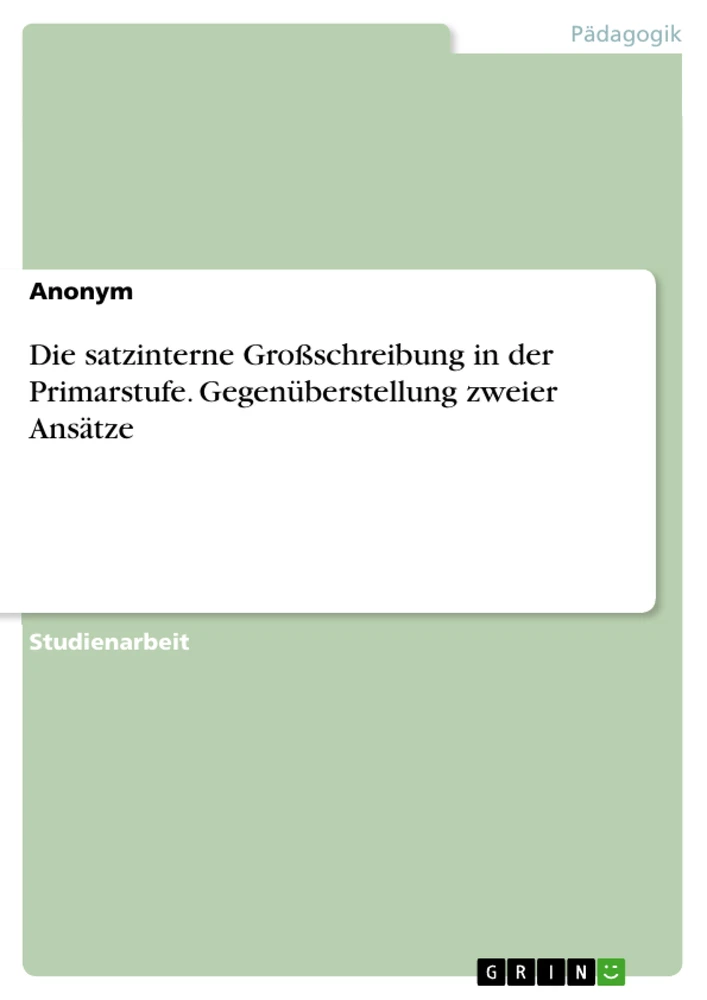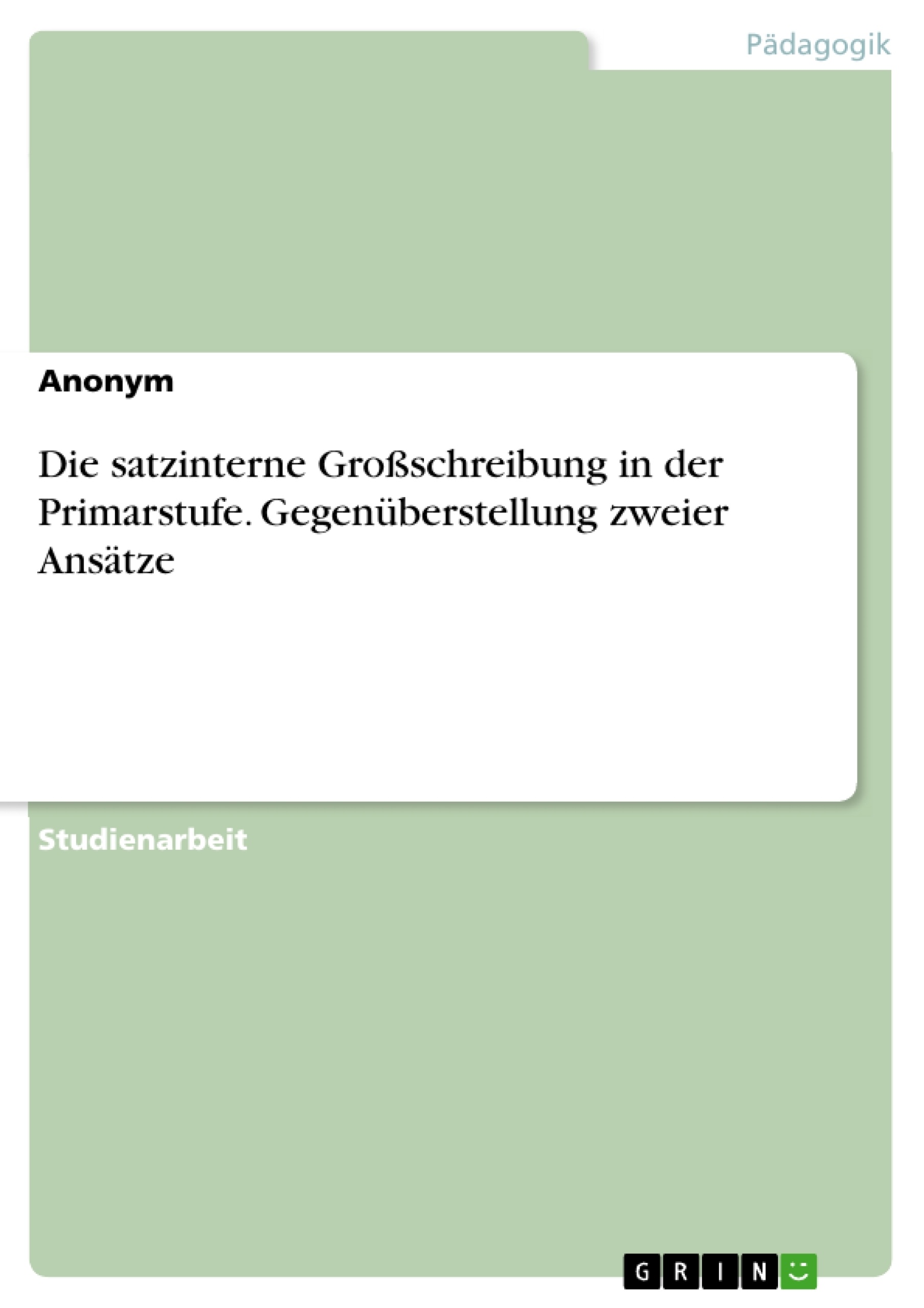In dieser Seminararbeit wird der Frage nachgegangen, ob der syntaxbezogene Ansatz eine erfolgsversprechende Alternative darstellt, die zu weniger Fehlern im Bereich der Groß- und Kleinschreibung führt.
Die Beherrschung der Schriftsprache nimmt einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein und ist bedeutend für eine erfolgreiche Teilhabe am schulischen sowie beruflichen Leben. Zu den fehleranfälligsten Bereichen der deutschen Orthographie zählt die Groß- und Kleinschreibung. Sie macht in Schülertexten etwa 30 Prozent der Gesamtfehler aus. Es stellt sich die Frage, warum die Groß-und Kleinschreibung derartig fehleranfällig ist.
Auf den ersten Blick scheint die Komplexität dieses Lerngegenstandes und die Unmenge von Regeln und Ausnahmen ausschlaggebend zu sein. Entgegen dieser Annahme verweist die Graphematik auf die ausgeprägte Regelmäßigkeit der satzinternen Großschreibung. Demzufolge lässt sich die satzinterne Großschreibung an syntaktischen Eigenschaften der Wortart Nomen erklären und nicht an lexikalischen. Dennoch wird die satzinterne Großschreibung den SchülerInnen der Primarstufe überwiegend traditionell gelehrt, entsprechend des Wortartbasierten Ansatzes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die satzinterne Großschreibung
- Der Wortartbezogene Ansatz
- Beschreibung
- Probleme
- Der syntaxbezogene Ansatz
- Beschreibung
- Konzept nach Röber-Siekmeyer
- Probleme
- Eine empirische Untersuchung des syntaxbezogenen Ansatzes
- Vorstellung der Untersuchung
- Ergebnisse
- Fähigkeit der Anwendung
- Fähigkeit der Kontrolle
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Seminararbeit befasst sich mit der satzinternen Großschreibung in der Primarstufe und analysiert die Vor- und Nachteile zweier gegensätzlicher Ansätze: den wortartbezogenen und den syntaxbezogenen Ansatz. Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit beider Ansätze zu untersuchen und herauszufinden, ob der syntaxbezogene Ansatz eine bessere Methode zur Vermittlung der satzinternen Großschreibung darstellt. Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung werden präsentiert, um die Effektivität der beiden Ansätze im Hinblick auf die Vermeidung von Fehlern zu evaluieren.
- Die satzinterne Großschreibung als orthographische Herausforderung
- Der wortartbezogene Ansatz: Prinzipien, Stärken und Schwächen
- Der syntaxbezogene Ansatz: Beschreibung, Konzept nach Röber-Siekmeyer und empirische Evaluation
- Vergleich der beiden Ansätze hinsichtlich der Fehlerhäufigkeit
- Implikationen für den Unterricht in der Primarstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Relevanz der satzinternen Großschreibung für die sprachliche Entwicklung und das schulische sowie berufliche Leben. Sie stellt das zentrale Problem der Arbeit vor: die Analyse der beiden gegensätzlichen Ansätze zur Vermittlung der Großschreibung in der Grundschule. Kapitel 2 gibt eine detaillierte Beschreibung des wortartbezogenen Ansatzes, der auf der lexikalischen und morphologischen Klassifizierung von Wörtern basiert. Es werden die traditionellen Regeln, die Schwierigkeiten und die Grenzen dieses Ansatzes beleuchtet. Kapitel 2.2 stellt den syntaxbezogenen Ansatz vor, der die Großschreibung an die Position des Wortes im Satz anknüpft. Es wird das Konzept nach Röber-Siekmeyer als eine Methode zur Vermittlung dieses Ansatzes vorgestellt, und es werden mögliche Probleme und Kritikpunkte beleuchtet. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, die die Wirksamkeit des syntaxbezogenen Ansatzes überprüft. Die Untersuchung analysiert die Fähigkeit der Schüler, die Regeln anzuwenden und die Groß- und Kleinschreibung zu kontrollieren. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet Schlussfolgerungen für den Unterricht.
Schlüsselwörter
Satzinterne Großschreibung, Primarstufe, Wortartbezogener Ansatz, Syntaxbezogener Ansatz, Konzept nach Röber-Siekmeyer, Empirische Untersuchung, Fehlerhäufigkeit, Rechtschreibung, Deutschunterricht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Die satzinterne Großschreibung in der Primarstufe. Gegenüberstellung zweier Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/945788