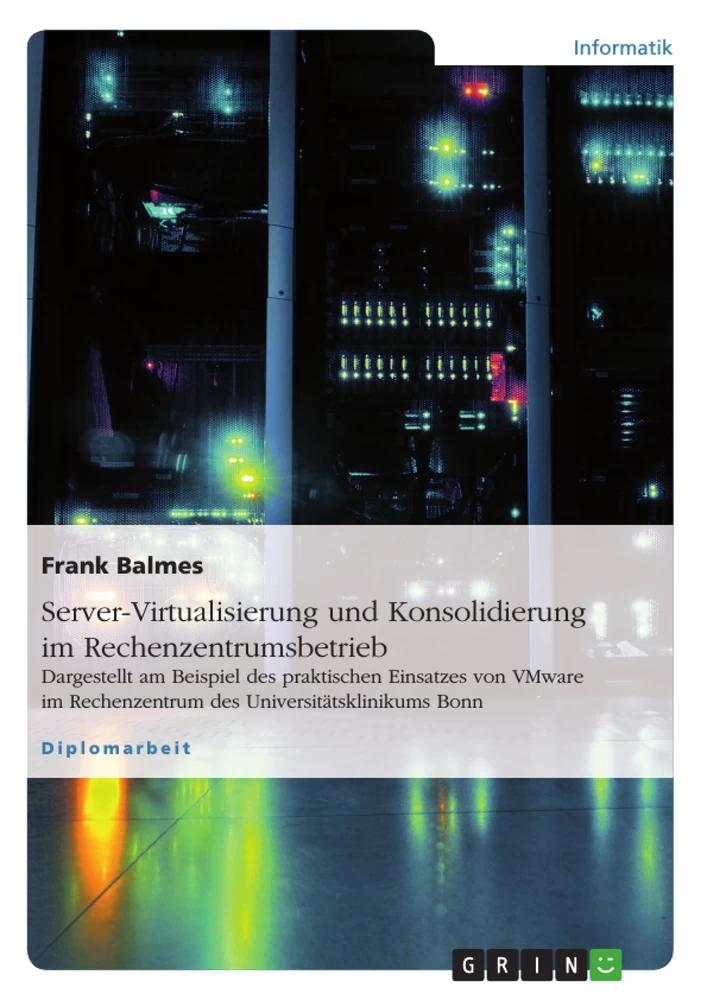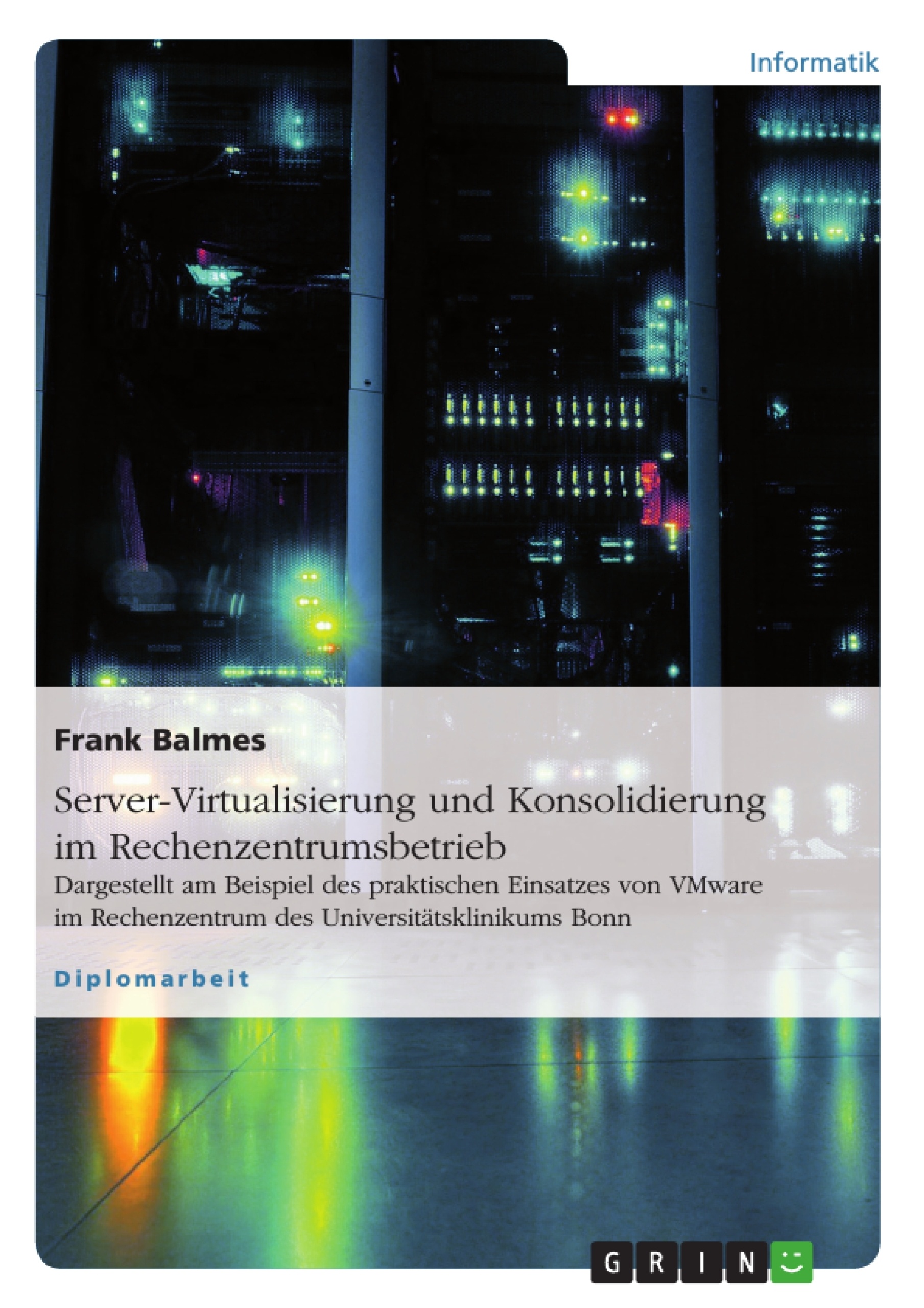Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Verwendung von Virtualisierungstechniken im Rahmen von Serverkonsolidierungen. Dabei werden die am Rechenzentrum des Universitätsklinikums Bonn im Produktionsbetrieb verwendeten Verfahren beschrieben und bewertet.
Bei der Verwendung von Hardware auf der Basis von x86-Architekturen ergeben sich für den Einsatz von Virtualisierungslösungen besondere Anforderungen an die Entwicklung von Virtualisierungssoftware. Zudem beschränkt sich die Verwendung von Virtualisierungslösungen im Produktionsumfeld nicht auf den Betrieb von Systemumgebungen, sondern erfordert auch weitere Funktionalitäten zur Unterstützung von Hochverfügbarkeit, Datensicherheit und Datenschutz.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kurzfassung
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Virtualisierung
- 2.1 Definition und Einsatzgebiete von Virtualisierung
- 2.2 Virtualisierungsarten
- 2.3 Virtualisierung auf der Basis von x86-Hardware
- 2.4 Virtualisierung im Rechenzentrumsbetrieb
- 3 Virtualisierungslösungen
- 3.1 VMware
- 3.2 Xen
- 3.3 Microsoft
- 4 Serverkonsolidierung
- 4.1 Ziele und Vorteile von Serverkonsolidierung
- 4.2 Implementierung einer Serverkonsolidierungsstrategie
- 5 Virtualisierungs-Infrastruktur im Universitätsklinikum Bonn
- 5.1 Derzeitiger Stand der Virtualisierung im UKB
- 5.2 Die VMware ESX Server-Infrastruktur im UKB
- 5.3 Einsatzszenarien für die Virtualisierung im UKB
- 5.4 Erfahrungen mit der Virtualisierungslösung im UKB
- 6 Anforderungen an die IT-Sicherheit
- 6.1 Datensicherheit und Datenschutz
- 6.2 Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit
- 7 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- 8 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Verwendung von Virtualisierungstechniken im Rahmen von Serverkonsolidierungen. Sie beleuchtet die im Rechenzentrum des Universitätsklinikums Bonn eingesetzten Verfahren und evaluiert deren Wirksamkeit und Eignung im Produktivbetrieb. Der Fokus liegt dabei auf den Besonderheiten von Virtualisierungslösungen auf der Basis von x86-Hardware, deren Anwendung in der Praxis sowie die Integration von Funktionalitäten zur Unterstützung von Hochverfügbarkeit, Datensicherheit und Datenschutz.
- Grundlagen der Virtualisierung
- Spezielle Herausforderungen von Virtualisierung auf x86-Hardware
- Analyse und Bewertung gängiger Virtualisierungslösungen (VMware, Xen, Microsoft)
- Fallstudie: Die Implementierung und der Einsatz von VMware im Universitätsklinikum Bonn
- Relevanz von IT-Sicherheitsaspekten im Kontext von Virtualisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Thematik der Servervirtualisierung im Kontext des Rechenzentrumsbetriebs vor und erläutert die Bedeutung des Themas im Hinblick auf die Optimierung von Ressourcen und die Steigerung der Effizienz.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Virtualisierung und erläutert die verschiedenen Arten von Virtualisierungslösungen. Darüber hinaus werden die spezifischen Herausforderungen der Virtualisierung auf x86-Hardware beleuchtet.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Virtualisierungslösungen von VMware, Xen und Microsoft vorgestellt und miteinander verglichen.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel behandelt die Serverkonsolidierung als wichtige Anwendung der Virtualisierung. Es beschreibt die Ziele und Vorteile dieser Strategie sowie die Vorgehensweise bei der Implementierung.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beleuchtet die Virtualisierungsinfrastruktur des Universitätsklinikums Bonn. Es beschreibt den aktuellen Stand der Virtualisierung im UKB, die verwendete VMware ESX Server-Infrastruktur und die Einsatzszenarien für Virtualisierung.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anforderungen an die IT-Sicherheit im Kontext von Virtualisierung. Es diskutiert die Themen Datensicherheit, Datenschutz sowie Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen dieser Diplomarbeit sind Servervirtualisierung, Serverkonsolidierung, x86-Hardware, Virtualisierungssoftware, VMware, Xen, Microsoft, IT-Sicherheit, Datensicherheit, Datenschutz, Hochverfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Server-Virtualisierung?
Dabei werden mehrere virtuelle Server auf einer einzigen physischen Hardware-Ressource betrieben, was die Auslastung optimiert und Kosten senkt.
Welche Vorteile bietet die Serverkonsolidierung?
Ziele sind die Reduzierung der Hardware-Anzahl, geringerer Energieverbrauch, einfachere Verwaltung und eine höhere Flexibilität bei der Bereitstellung von Systemen.
Warum ist Virtualisierung auf x86-Hardware speziell?
Die x86-Architektur war ursprünglich nicht für Virtualisierung ausgelegt, was komplexe Softwarelösungen (Hypervisoren) erforderte, um Hardware-Ressourcen effizient zu teilen.
Welche Virtualisierungslösungen sind marktführend?
Zu den wichtigsten Lösungen gehören VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V und die Open-Source-Lösung Xen.
Wie wird IT-Sicherheit in virtuellen Umgebungen gewährleistet?
Durch Funktionen zur Hochverfügbarkeit, regelmäßige Backups auf VM-Ebene und strikte Trennung der virtuellen Instanzen zur Wahrung von Datenschutz und Datensicherheit.
- Citation du texte
- Frank Balmes (Auteur), 2008, Server-Virtualisierung und Konsolidierung im Rechenzentrumsbetrieb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94412