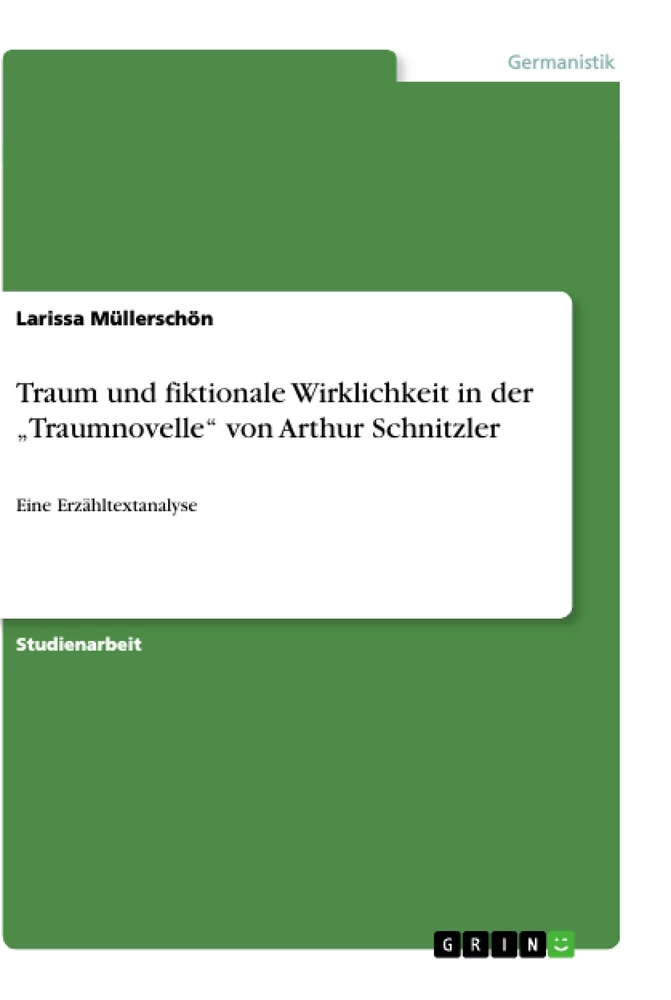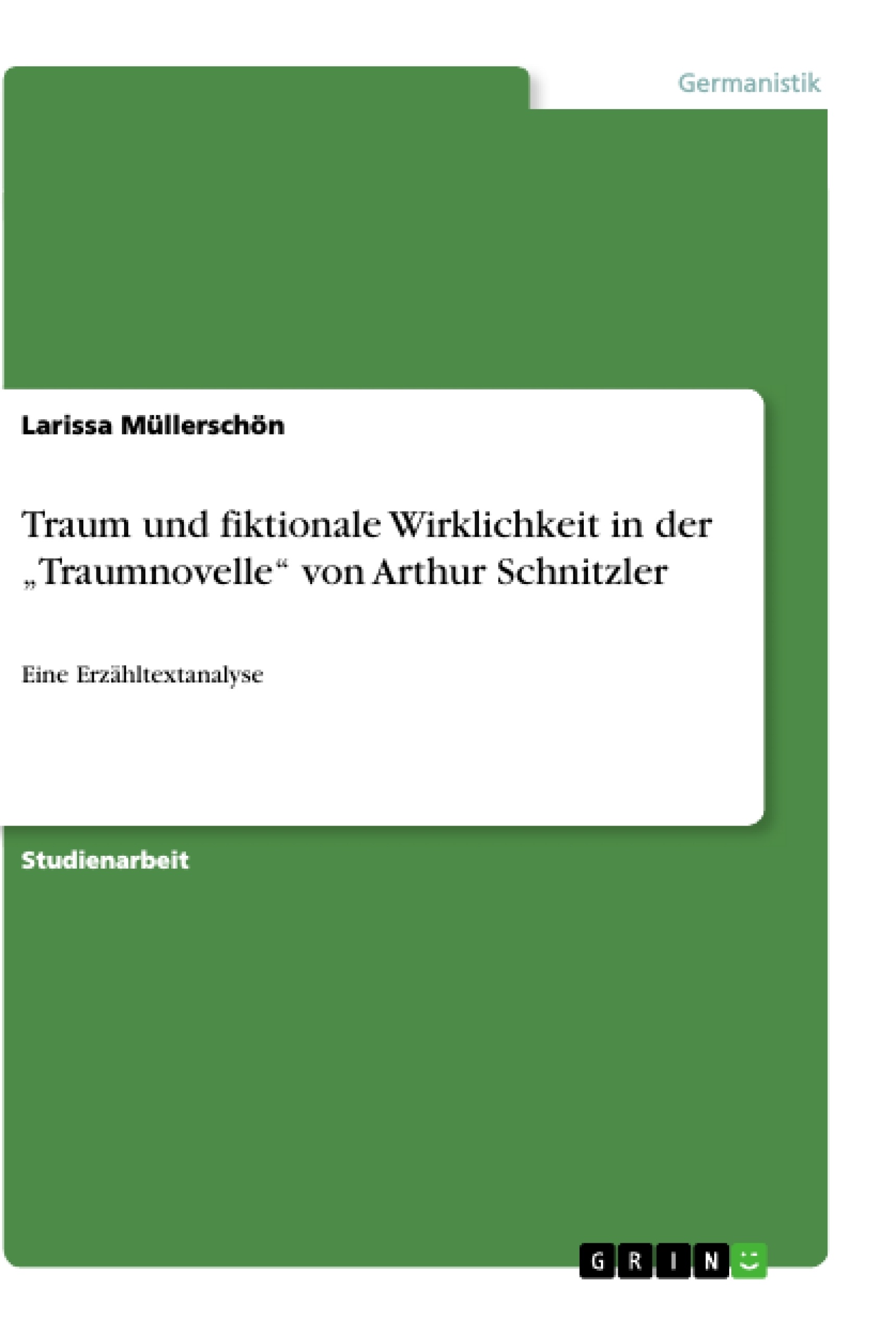Inwieweit in Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" die Grenzen zwischen Traum und innerfiktionaler Wirklichkeit ineinander über gehen und sogar verschmelzen, ist Thema dieser Arbeit und wird auf narratologischer Ebene nachgewiesen. Der erste Teil der Arbeit befasst sich einleitend mit der Thematik des Traums, der Innerlichkeit und deren Bedeutung für Schnitzler im Rahmen der Jahrhundertwende in Wien. Im Weiteren werden exemplarisch Passagen der Novelle mit Hilfe der Erzähltextanalyse Gérard Genettes nach Zeit, Modus und Stimme analysiert. Letztlich werden die Ergebnisse in Bezug auf die aufgestellte These ausgewertet.
Für den Leser lassen sich zeitweise Traum und innerfiktionale Wirklichkeit kaum voneinander trennen. Dies ist nicht nur dem Inhalt der 1926 veröffentlichten "Traumnovelle" Arthur Schnitzlers zu verdanken, sondern wohl auch der einzigartigen literarischen Gestaltung durch den Autor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arthur Schnitzler und das Traumhafte
- Narrative Analyse
- Zeit
- Ordnung des Erzählens
- Erzählzeit vs. Erzählte Zeit
- Dauer
- Frequenz
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Stimme
- Zeitpunkt des Erzählens
- Ort des Erzählens
- Stellung des Erzählers
- Subjekt und Adressat des Erzählens
- Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ mit dem Ziel, die ineinander übergehenden Grenzen zwischen Traum und innerfiktionaler Wirklichkeit aufzuzeigen. Im Fokus steht die Frage, wie Schnitzler diese Verschmelzung auf narratologischer Ebene gestaltet.
- Die Bedeutung des Traums und der Innerlichkeit in Schnitzlers Werk im Kontext der Jahrhundertwende in Wien.
- Der Einfluss von Sigmund Freuds „Traumdeutung“ auf Schnitzlers literarische Gestaltung.
- Die Analyse von Passagen der Novelle anhand der Erzähltextanalyse Gérard Genettes.
- Die Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die aufgestellte These.
- Die Darstellung der Beziehung zwischen Traum und Wirklichkeit in Schnitzlers „Traumnovelle“ und deren Auswirkungen auf die Leserinterpretation.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der „Traumnovelle“ ein und erläutert den besonderen Einfluss des Traums und der Innerlichkeit in Schnitzlers Werk. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage nach der Verschmelzung von Traum und innerfiktionaler Wirklichkeit in der Novelle und skizziert den methodischen Ansatz.
Arthur Schnitzler und das Traumhafte
Dieses Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Arthur Schnitzler und Sigmund Freud sowie den Einfluss der psychoanalytischen Traumdeutung auf Schnitzlers Werk. Es wird die Bedeutung des Traums und der Innerlichkeit für die literarische Gestaltung der Wiener Moderne erläutert.
Narrative Analyse
Zeit
Der Abschnitt „Zeit“ untersucht die Ordnung des Erzählens in Schnitzlers „Traumnovelle“. Es werden Analepsen und Prolepsen identifiziert und die erzählte Zeit im Verhältnis zur Erzählzeit betrachtet. Die Analyse umfasst zudem die Dauer der Handlung und die verschiedenen Erzählgeschwindigkeiten.
Modus
Der Abschnitt „Modus“ beschäftigt sich mit der Distanz zwischen Erzähler und Leser sowie der Fokalisierung in der „Traumnovelle“. Es werden die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung und der Perspektiven der Figuren untersucht.
Stimme
Der Abschnitt „Stimme“ analysiert die verschiedenen Aspekte der Erzählerstimme in Schnitzlers „Traumnovelle“. Es werden der Zeitpunkt und Ort des Erzählens, die Stellung des Erzählers sowie die Beziehung zwischen Subjekt und Adressat des Erzählens beleuchtet.
- Quote paper
- Larissa Müllerschön (Author), 2019, Traum und fiktionale Wirklichkeit in der „Traumnovelle“ von Arthur Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/943568