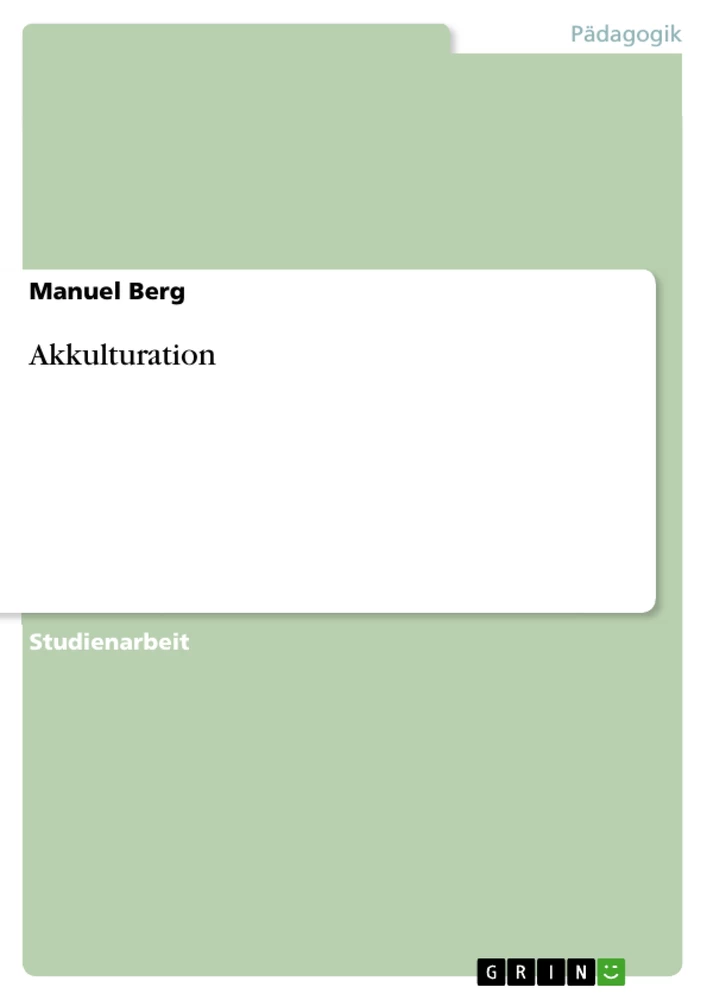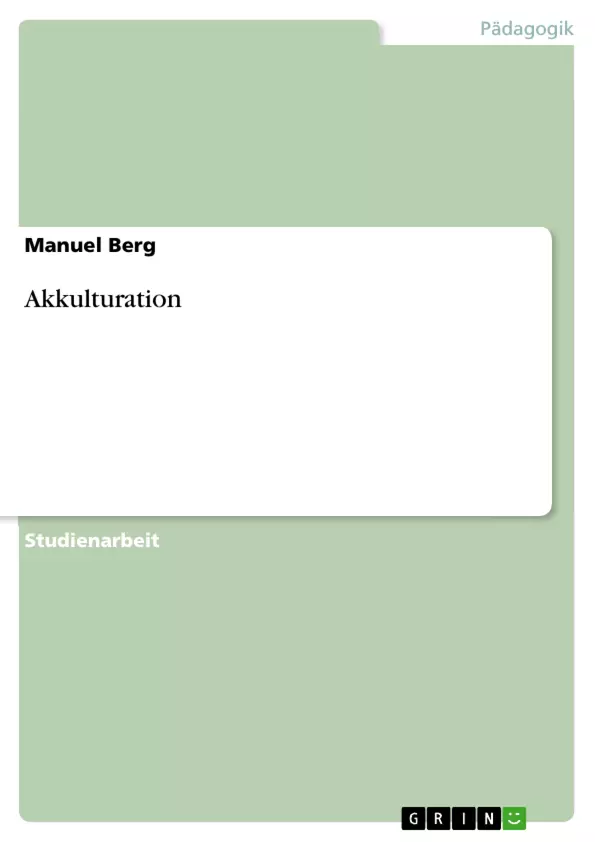Wenn wir den Begriff Akkulturation hören, dann denken wir vielleicht zu aller erst an eine Verknüpfung des Begriffs mit anderen Begriffen aus der Pädagogik, wie der Assimilation oder der Akkomodation. Wir denken vielleicht an andere Länder, andere Menschen. An Wanderungen und an andere Kulturen. Denken an unsere eigene Kultur, und was sie eigentlich ausmacht, und von anderen unterscheidet. Nun, allgemein gehalten findet Akkulturation dann statt, wenn ein Mensch in ein anderes Land zieht, und versucht, dort „Fuß zu fassen“. Nur, wie findet dieser Vorgang statt? Wie muss man sich einen „Kultur-Schock“ vorstellen? Welche Rolle spielen dabei die Identität und die Rollenübernahme? Was fühlt ein Mensch, der sich plötzlich in einem „fremden“ Land – sei es freiwillig oder unfreiwillig – wiederfindet? Wie steht die einheimische Bevölkerung zu den „Fremden“? Werden diese problemlos akzeptiert? Welche Verhalten können Ausländer entwickeln, um im Aufnahmeland aufgenommen zu werden? Wie steht es um Immigranten, also Menschen, die ihr Heimatland verließen, und sich wieder dazu entschließen, zurückzukehren. Welche Stellung haben diese Menschen in Deutschland? Wie sehen sie sich selbst, und wie werden sie von den Einheimischen gesehen? Welche Gründe bewegen Menschen dazu, ihr Land zu verlassen, und woanders einen Neubeginn zu wagen? Wie verarbeiten Jugendliche den Prozess der Akkulturation? Welche Probleme stellen sich ihnen und wie können sie diese bewältigen? Von welchen Faktoren hängt eine erfolgreiche Eingliederung in die Aufnahmekultur ab? Wodurch lässt sich die außergewöhnliche Abneigung der Deutschen gegenüber den Türkinnen begründen? Ich werde versuchen, dies an einem Beispielfall aufzuzeigen. Im letzten Teil dieser Arbeit möchte ich noch auf jugendliche Einwanderer aus Polen näher eingehen, sowie an zwei Beispielen deren Situation widerspiegeln, die sie hier in Deutschland erfahren haben.
Ich bin der Ansicht, dass die Deutsche Bevölkerung durch ihre Abwehrhaltung gegenüber den Migranten die Situation für beide Seiten zusätzlich verschärft. Denn durch rassistische Äußerungen und Handlungen durch die Deutsche Bevölkerung fühlen sich die Migranten nicht willkommen und gehen ihrerseits auch in Abwehrhaltung. Somit findet keine wirkliche Annäherung statt. Hier finde ich die Theorie der Abwehrreaktion sehr interessant.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition der Akkulturation
- Hintergrundinformationen zur Akkulturation
- Die Entwicklung des „Selbst“
- Bedingungen für die Aufnahme von Kontakten
- Die Übernahme von Rollen
- Der Akkulturationsprozess aus interaktionistischer Sicht
- Akkulturation von Migranten als Interaktionsprozess
- Randbedingungen in Deutschland
- Theoretische Perspektiven auf Akkulturation am Beispiel Deutschland
- Kulturelle Identität am Beispiel deutscher Aussiedler
- Konzept der kulturellen Identität
- Die Relation zwischen Minorität und Majorität
- Von Stabilität zu sozialem Wandel: das Verhaltensrepertoire der Minderheiten
- Soziale Einstellung der Deutschen gegenüber ausländischen Männern und Frauen
- Den Akkulturationsprozess behindernde Einflüsse am Beispiel Jugendlicher Migranten aus Polen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem komplexen Prozess der Akkulturation. Sie analysiert die psychischen und sozialen Veränderungen, die ein Mensch durchmacht, wenn er in eine neue Kultur eintritt. Die Arbeit geht auf die vielfältigen Aspekte des Akkulturationsprozesses ein, von der Identität und Rollenübernahme bis hin zu den Randbedingungen in der Aufnahmegesellschaft.
- Definition und Bedeutung von Akkulturation
- Der Einfluss von Kultur und Identität auf die Akkulturation
- Herausforderungen und Chancen im Akkulturationsprozess
- Die Rolle der Interaktion und der Aufnahmegesellschaft
- Beispiele und Fallstudien aus der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff der Akkulturation vor und stellt die zentralen Fragen der Hausarbeit dar. Kapitel 2 liefert eine präzise Definition von Akkulturation und erklärt, wie der Begriff im Kontext der Migrationsforschung verstanden wird. In Kapitel 3 werden wichtige Hintergrundinformationen zur Akkulturation gegeben, wobei der Fokus auf der Bedeutung von Kultur und Identität liegt. Kapitel 4 untersucht die Entwicklung des „Selbst“ im Akkulturationsprozess und zeigt auf, wie die Identität eines Menschen im Laufe des Prozesses verändert wird. Kapitel 5 behandelt die Bedingungen für die Aufnahme von Kontakten in der neuen Kultur. Kapitel 6 beleuchtet die Rolle der Übernahme neuer Rollen im Akkulturationsprozess. Kapitel 7 beleuchtet den Prozess aus interaktionistischer Sicht und zeigt, wie Interaktion zwischen Migranten und Einheimischen den Prozess beeinflusst. Kapitel 8 betrachtet die Akkulturation von Migranten als Interaktionsprozess und analysiert die Dynamik zwischen Herkunftskultur und Aufnahmegesellschaft.
Schlüsselwörter
Akkulturation, Migration, Kultur, Identität, Interaktion, Integration, Aufnahmegesellschaft, Randbedingungen, Ausländer, Migranten, Identität, Rollenübernahme, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Akkulturation“?
Akkulturation bezeichnet den Prozess der Anpassung und Veränderung von Individuen oder Gruppen, wenn sie dauerhaft mit einer neuen Kultur in Kontakt treten.
Was ist ein „Kultur-Schock“?
Ein psychischer Zustand der Orientierungslosigkeit und Belastung, der auftreten kann, wenn Menschen mit völlig fremden kulturellen Werten und Normen konfrontiert werden.
Welche Rolle spielt die Identität im Akkulturationsprozess?
Die kulturelle Identität muss oft neu verhandelt werden; dabei entstehen Spannungsfelder zwischen der Herkunftskultur und der Aufnahmegesellschaft.
Wie beeinflusst die Aufnahmegesellschaft die Integration?
Abwehrhaltungen oder rassistische Äußerungen der einheimischen Bevölkerung können den Akkulturationsprozess erheblich erschweren und zu Rückzugsbewegungen der Migranten führen.
Was ist das Besondere an der Akkulturation jugendlicher Migranten?
Jugendliche stehen oft vor der Herausforderung, zwischen den Erwartungen ihres Elternhauses und denen ihrer Peer-Group im Aufnahmeland zu vermitteln.
- Citation du texte
- Manuel Berg (Auteur), 2008, Akkulturation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93836