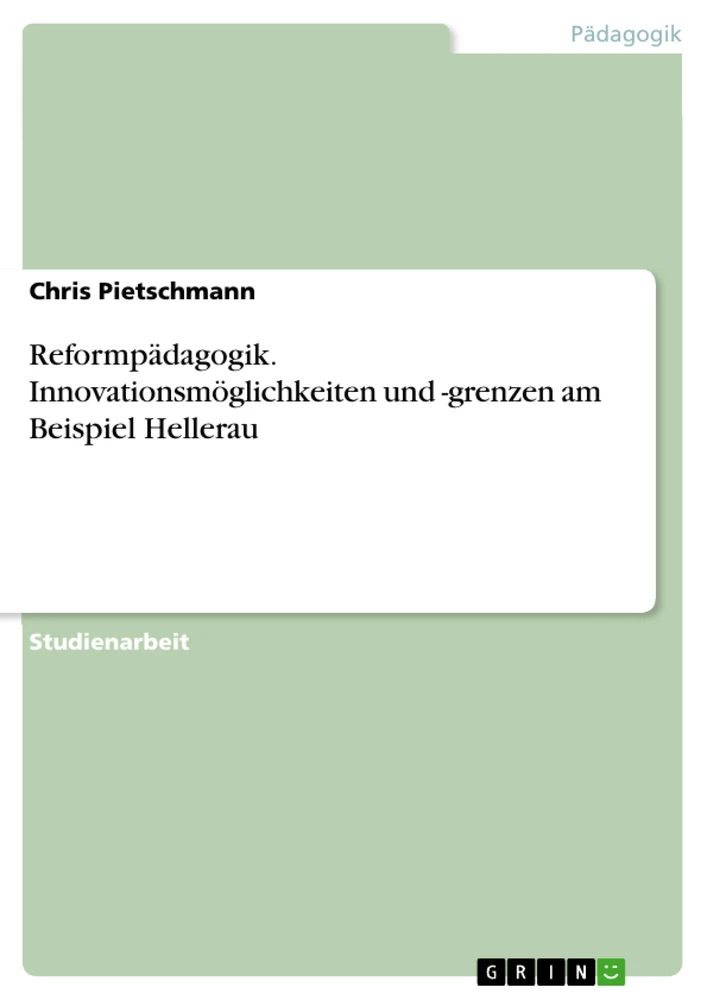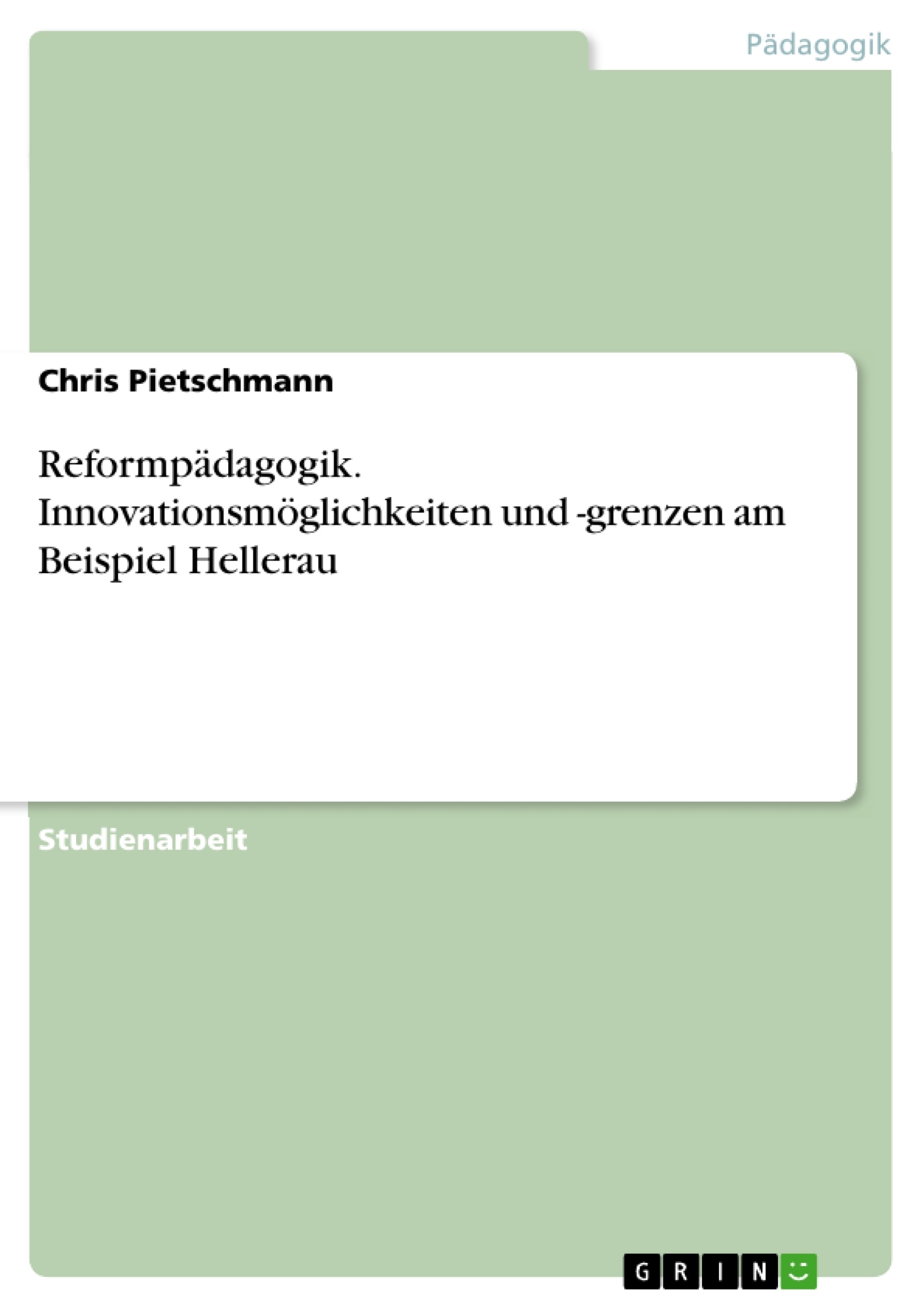Wie genau lässt sich Schule perfekt organisieren, kinderfreundlich und lehrreich gestalten und wie erzeugt man ein harmonisches Verhältnis zwischen Lehrern, Kindern und Eltern, sodass eine möglichst rundum zufriedenstellende Situation dabei herauskommt?
In der Arbeit soll die Frage nach Kriterien zur zeitgenössischen und zeitübergreifenden Bewertung über Erfolg und Misserfolg von reformpädagogischen Versuchsschulen beantwortet werden. Weiterhin sollen Innovationsmöglichkeiten, aber auch ihre Grenzen in reformpädagogischer Versuchsschulpraxis aufgezeigt und am Fallbeispiel der Versuchsschule in Hellerau näher erläutert werden.
Es gibt immer wieder aufkommende Probleme und nicht zufriedenstellende Situationen in Verbindung mit dem Schulalltag. Beispielsweise spielt die Politik eine große Rolle. Im 19. und 20. Jahrhundert ist die Schule vor allem durch politische, aber auch kirchliche Vorgaben gelenkt, wie kann man nun die Situation verbessern, um den Lernenden einen besseren Schulalltag mit mehr Konzentration auf die persönliche freie Entfaltung zu gewährleisten?
Mit dieser Frage beschäftigen sich die Reformpädagogen seit dem Aufkommen der Reformpädagogik. Im Juli 1919 gab es einen großen Umbruch im Schulsystem, denn mit dem Übergangsgesetz für Volksschulen eröffneten sich viele neue Möglichkeiten zur Reform des Schulwesens. Durch die Einführung von Versuchsschulen sollten die alten, ständisch geprägten Organisationsformen des Schulwesens überarbeitet werden und neue Formen erprobt werden. Dass dadurch nicht nur Zuspruch sondern auch Kritik hervorgerufen wurde, erzeugt unweigerlich Probleme in der Durchführung, die in dieser Arbeit beleuchtet werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Reformpädagoge Willy Steiger
- 3. Übergangsgesetz für das Volksschulwesen 1919
- 4. Projekt Versuchsschule
- 5. Fallbeispiel Hellerau
- 5.1. Erfolg oder Misserfolg?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, Kriterien für die zeitgenössische und zeitübergreifende Bewertung des Erfolgs und Misserfolgs reformpädagogischer Versuchsschulen zu entwickeln. Dabei werden auch die Innovationsmöglichkeiten und -grenzen dieser Schulform beleuchtet, wobei das Fallbeispiel der Versuchsschule Hellerau im Zentrum steht.
- Bewertungskriterien für den Erfolg und Misserfolg reformpädagogischer Versuchsschulen
- Innovationsmöglichkeiten und -grenzen der reformpädagogischen Versuchsschulpraxis
- Analyse des Fallbeispiels Hellerau als exemplarische Versuchsschule
- Einordnung der Versuchsschule Hellerau in den historischen Kontext der Reformpädagogik
- Die Rolle des Reformpädagogen Willy Steiger im Kontext der Versuchsschule Hellerau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der reformpädagogischen Versuchsschulen ein und beleuchtet die Problematik des Schulsystems im 19. und 20. Jahrhundert. Kapitel 2 widmet sich der Biografie des Reformpädagogen Willy Steiger und zeichnet den Weg bis zu seiner Tätigkeit als Lehrer in Hellerau nach. Kapitel 3 erläutert das Übergangsgesetz für das Volksschulwesen von 1919, das die Entstehung von Versuchsschulen ermöglichte. In Kapitel 4 wird die Versuchsschule als Konzept und ihre Arbeit untersucht, wobei die Grundsätze einer Versuchsschule beleuchtet werden. Kapitel 5 vertieft die Thematik anhand des Fallbeispiels Hellerau und diskutiert Kriterien zur Bewertung von Erfolg und Misserfolg. Der Fokus liegt auf der Rolle Willy Steigers und den Herausforderungen, die mit dem Projekt verbunden waren.
Schlüsselwörter
Reformpädagogik, Versuchsschule, Hellerau, Willy Steiger, Übergangsgesetz für das Volksschulwesen 1919, Erfolg, Misserfolg, Innovationsmöglichkeiten, Grenzen, Fallbeispiel, Bewertungskriterien, Schulsystem, Schulalltag, Lernende, persönliche freie Entfaltung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel reformpädagogischer Versuchsschulen?
Ziel ist es, weg von der alten, ständisch geprägten "Paukschule" zu kommen und kinderfreundlichere, lehrreiche Konzepte zu erproben, die die freie Entfaltung des Individuums in den Mittelpunkt stellen.
Welche Bedeutung hatte das Übergangsgesetz von 1919?
Das Gesetz ermöglichte nach dem Ersten Weltkrieg den Umbruch im Schulsystem, indem es rechtliche Freiräume für die Gründung von Versuchsschulen zur Erprobung neuer Organisationsformen schuf.
Wer war Willy Steiger im Kontext von Hellerau?
Willy Steiger war ein bedeutender Reformpädagoge und Lehrer an der Versuchsschule in Hellerau. Er setzte sich intensiv für neue Lehrformen und ein harmonisches Verhältnis zwischen Lehrern, Schülern und Eltern ein.
Was sind die Grenzen reformpädagogischer Innovationen?
Grenzen liegen oft in politischen und kirchlichen Vorgaben, mangelndem Zuspruch in der Gesellschaft sowie finanziellen und organisatorischen Hürden bei der praktischen Durchführung.
Warum wurde die Versuchsschule Hellerau als Fallbeispiel gewählt?
Hellerau gilt als exemplarisch für die Bemühungen der Reformpädagogik, da dort der Versuch unternommen wurde, Bildung, Wohnen und Arbeiten in einem ganzheitlichen, innovativen Umfeld zu vereinen.
Wie wird der Erfolg einer Versuchsschule bewertet?
Erfolg wird nicht nur an Noten gemessen, sondern an der Zufriedenheit der Beteiligten, der pädagogischen Nachhaltigkeit und der Fähigkeit, sich gegen traditionelle, einschränkende Strukturen zu behaupten.
- Quote paper
- Chris Pietschmann (Author), 2020, Reformpädagogik. Innovationsmöglichkeiten und -grenzen am Beispiel Hellerau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937711