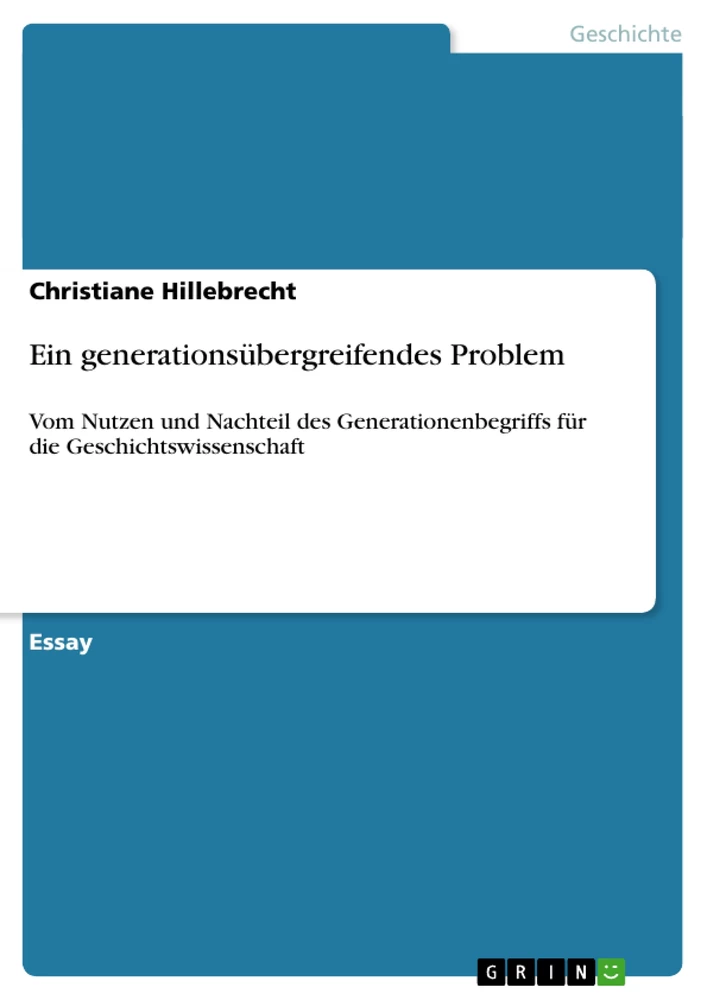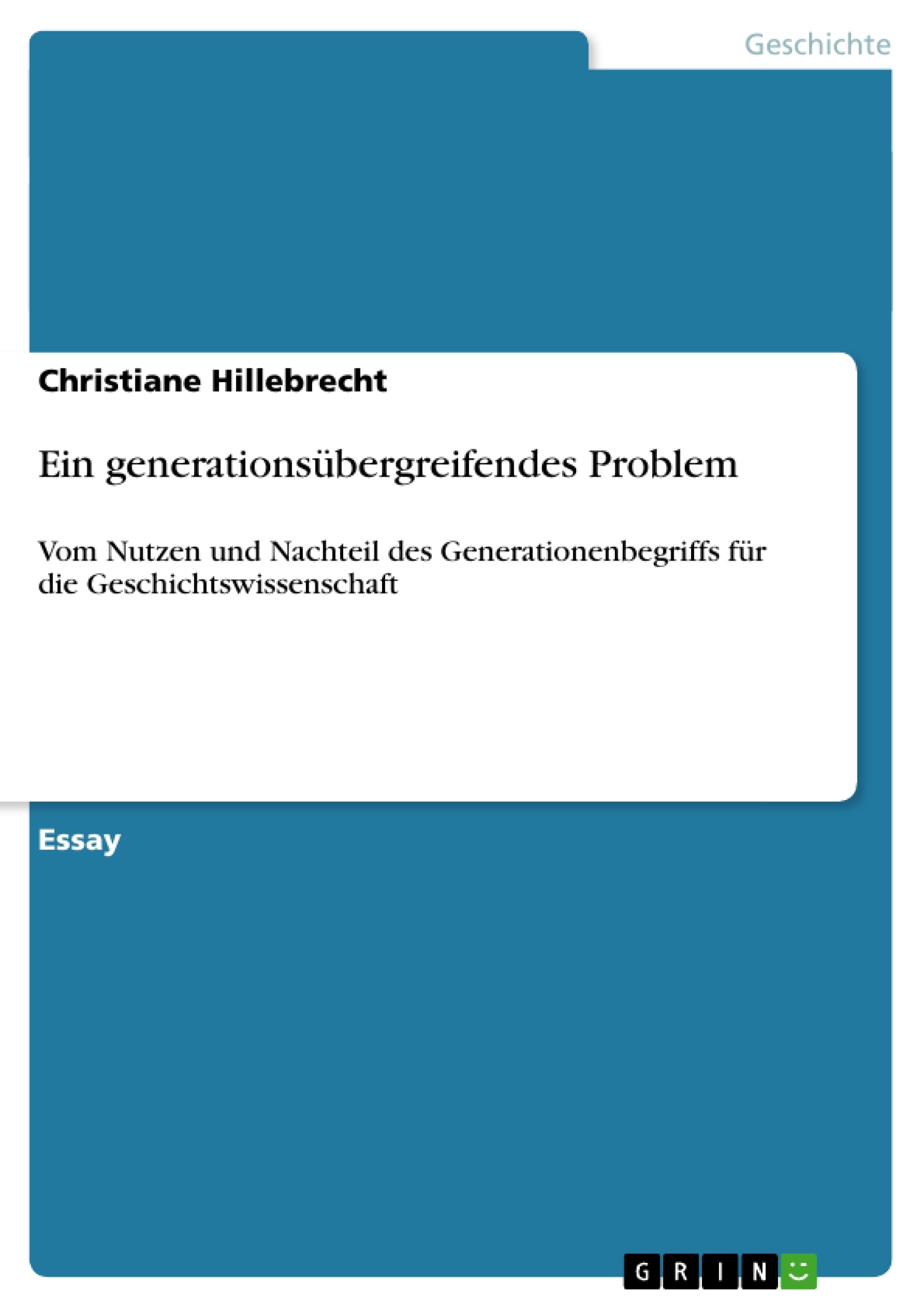Egal, wen man nach der Lesart des Begriffes Generation fragen würde, ob Wissenschaftler oder Laie. Jeder einzelne würde sicher eine andere, wenn vielleicht auch ähnliche Antwort zurückgeben und mit Sicherheit würden viele verschiedene Beispiele zur Untermauerung der Definition benutzt werden. Von der ,Nachkriegs-’ und der ,Flakhelfergeneration’, von der ,Generation Golf’ und gewiss von der ,68er-Generation’ wäre die Rede. Jeder weiß scheinbar etwas mit dem Ausdruck Generation anzufangen und viele meinen demnach auch ganz genau differenzieren zu können, was diesen Begriff ausmacht. Bei dessen Aktualität stellt sich die Frage, ob man diesen weiterhin als wissenschaftlich bezeichnen darf. Kann er in der Geschichtswissenschaft überhaupt noch objektiv gebraucht werden, ohne sich dabei aus dem Gebiet der Wissenschaften heraus zu begeben?
In diesem Essay wird sich mit der Frage beschäftigt und abwägt werden, ob und inwiefern der Generationenbegriff der Geschichtswissenschaft von Nutzen oder gar von Nachteil ist.
Inhaltsverzeichnis
- Ein generationsübergreifendes Problem
- Vom Nutzen und Nachteil des Generationenbegriffs für die Geschichtswissenschaft
- Grundsätzlich kann man meiner Meinung nach sagen, dass es das Ziel der Geschichtswissenschaft ist, Erkenntnis zu erlangen, mit der wiederum die Vergangenheit und gegebenenfalls auch die Gegenwart erklärt werden kann.
- Der Generationenbegriff ist in diesem Zusammenhang ein Hilfsmittel für die Geschichtswissenschaft, vergleichbar mit der Periodisierung in Epochen, um Geschichte,,greifbar“ zu machen.
- Des Weiteren ist meines Erachtens vorab klarzustellen, ob Generationen Naturphänomene sind oder Konstrukte.
- Stellt man zum Beispiel zwei politische Generationen des 20. Jahrhunderts gegenüber, die so genannte „33er-“ oder auch „Kriegsjugendgeneration“ und die so genannte „,68er-Generation“ könnte man, wie Götz Aly, das eben genannte Eltern-Kind-Verhältnis untersuchen.
- Das große Problem beim Gebrauch des Generationenbegriffes, welches Karl Mannheim erkannte und versuchte zu lösen, ist die Verallgemeinerung und somit die auftretende Subjektivität, wenn man von Generationen spricht.
- Ein weiteres Problem, das sich bei der Verwendung des Generationenbegriffs auftut und gegebenenfalls an dessen Objektivität zweifeln lässt, ist die dominierend männliche Färbung des Begriffs.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern der Generationenbegriff der Geschichtswissenschaft von Nutzen oder gar von Nachteil ist. Der Autor analysiert die Definition und den Einsatz des Begriffs in der historischen Forschung und stellt die Probleme heraus, die mit seiner Anwendung verbunden sind.
- Der Begriff Generation: Definition, Anwendungsbereiche und Probleme
- Die „Pulsschlag-Hypothese“ und die „Prägungshypothese“
- Die Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen für die Bildung von Generationseinheiten
- Die Frage der Subjektivität und Verallgemeinerung bei der Anwendung des Generationenbegriffs
- Der Genderaspekt und die männliche Färbung des Generationenbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik des Generationenbegriffs in der Geschichtswissenschaft aufzeigt. Er stellt die Frage, ob der Begriff noch objektiv verwendet werden kann oder ob er eher subjektive Interpretationen ermöglicht.
- Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Definitionen des Generationenbegriffs untersucht und die Probleme, die sich aus der unterschiedlichen Verwendung des Begriffs ergeben, beleuchtet. Der Autor greift dabei auch auf die Unterscheidung zwischen „Pulsschlag-Hypothese“ und „Prägungshypothese“ zurück.
- Kapitel drei widmet sich der Frage, inwiefern die Bildung von Generationseinheiten durch Ereignisse und Erfahrungen beeinflusst wird. Der Autor stellt fest, dass die Reaktion auf erlebte Ereignisse und die Abgrenzung von den Vorgängergenerationen eine wichtige Rolle für die Entstehung von Generationen spielen.
- Im vierten Kapitel werden die Probleme der Subjektivität und Verallgemeinerung im Zusammenhang mit dem Generationenbegriff diskutiert. Der Autor zeigt auf, dass es schwierig ist, von einer einheitlichen Generation zu sprechen, da die Mitglieder einer Generation verschiedene Erfahrungen machen und unterschiedliche Einstellungen haben können.
- Der Text endet mit einem Kapitel, das sich mit dem Genderaspekt des Generationenbegriffs auseinandersetzt. Der Autor kritisiert die männliche Färbung des Begriffs und fordert eine stärkere Berücksichtigung der Frauen in der historischen Forschung.
Schlüsselwörter
Generationenbegriff, Geschichtswissenschaft, Periodisierung, „Pulsschlag-Hypothese“, „Prägungshypothese“, Generationseinheit, Ereignisse, Erfahrungen, Subjektivität, Verallgemeinerung, Genderaspekt, Männlichkeit, Frauen in der Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Generationenbegriff wissenschaftlich objektiv?
Der Begriff wird kritisch hinterfragt, da er oft subjektiv und verallgemeinernd verwendet wird, was seine rein wissenschaftliche Nutzbarkeit einschränken kann.
Was ist der Unterschied zwischen Naturphänomen und Konstrukt?
Während das Alter biologisch ist, sind Generationen wie die „68er“ soziale Konstrukte, die durch gemeinsame historische Erfahrungen entstehen.
Was besagt die „Prägungshypothese“?
Sie geht davon aus, dass einschneidende Erlebnisse in der Jugend (Kriege, Krisen) eine Altersgruppe nachhaltig prägen und zu einer Generationseinheit zusammenschweißen.
Warum wird der Generationenbegriff als „männlich gefärbt“ kritisiert?
Historisch wurden Generationen oft über politische oder militärische Ereignisse definiert, an denen Frauen seltener direkt beteiligt waren, wodurch ihre Perspektive oft fehlte.
Welchen Nutzen hat die Periodisierung in Generationen für Historiker?
Sie dient als Hilfsmittel, um Geschichte „greifbar“ zu machen und komplexe gesellschaftliche Umbrüche zeitlich zu strukturieren.
- Arbeit zitieren
- Christiane Hillebrecht (Autor:in), 2008, Ein generationsübergreifendes Problem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93722