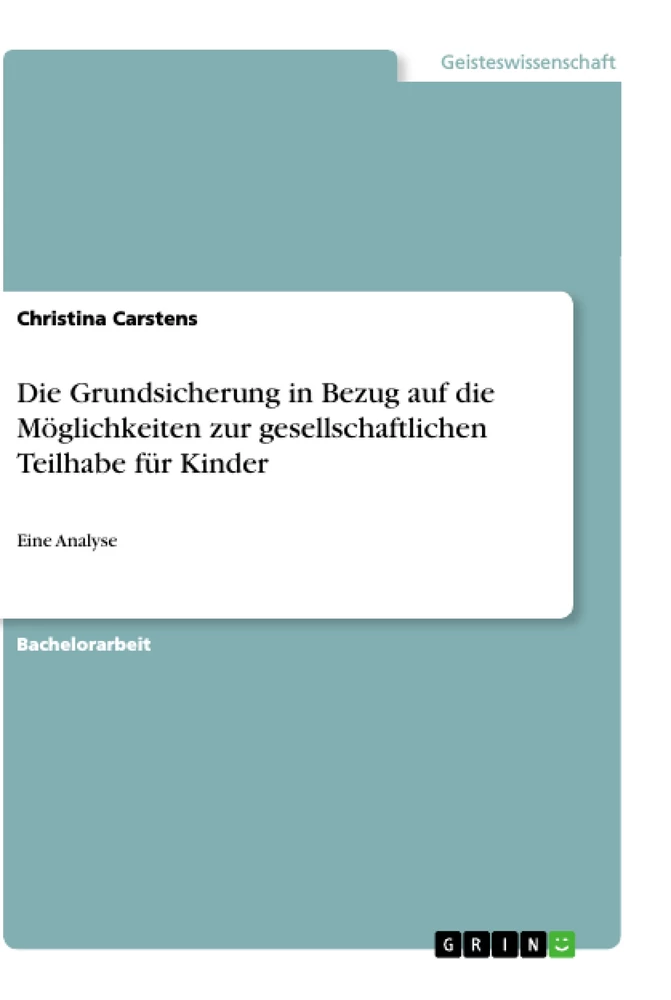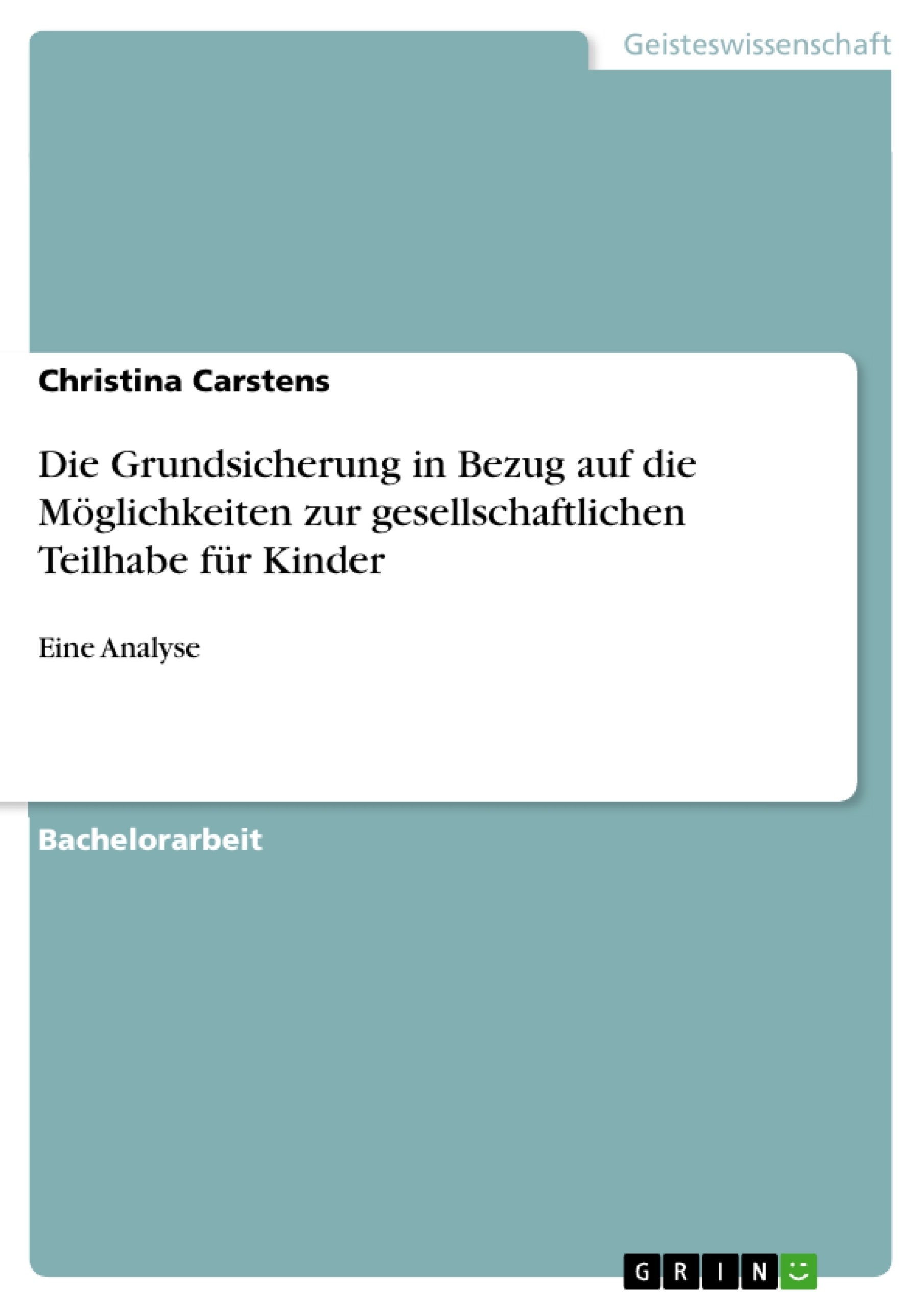Thema der Arbeit ist die Analyse der Grundsicherung mit Blick auf die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe für Kinder. Eine Hypothese ist, dass die Grundsicherung für Kinder nicht die Kinderarmut bewältigen wird. Bei der Kinderarmut treten mehrdimensionale Beeinträchtigungen auf, die ein operationalisiertes und multidimensionales Handeln erfordern. Anhand der Forschungsliteratur wird versucht, die Hypothese zu bestätigen. Es geht bei den Kindern, die in relativer Armut leben, darum, die Lebensbedingungen zu verbessern sowie den benachteiligten Kindern eine Teilhabe zu ermöglichen und ihnen Unterstützung zu geben. Zur Überprüfung der Hypothese erfolgt eine Orientierung an folgenden Fragen: Können die Folgen und der Mangel bei der relativen Kinderarmut ausgeglichen werden? Wie können die Kinder im Alltag und im Lebensumfeld unter gleichen Bedingungen aufwachsen? Wie kann das kindliche Wohl ein finanzielles Fundament erhalten, das allen Kindern die gleichen Chancen hinsichtlich Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Förderung zuteilwerden lässt? Wie kann eine Chancengleichheit geschaffen werden, die eine Förderung und Unterstützung auf mehreren Ebenen bietet? Kann eine Betreuung der Kinder und eine finanzielle Absicherung der Alleinerziehenden gewährleistet werden? Was kann der Staat in den Grundnahrungsmitteln unterstützend beitragen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen und Definitionen
- 2.1 Armutsforschung
- 2.2 Grundsicherung
- 2.3 Kindergrundsicherung
- 2.4 Bedarfsorientierte Kindergrundsicherung
- 2.5 Bürgerversicherung und bedingungsloses Grundeinkommen
- 3 Soll- und Ist-Zustand
- 3.1 Chancenungleichheiten
- 3.2 Definition von Armut bzw. Kinderarmut
- 3.3 Unterscheidung von Armut
- 3.4 Ursache von Kinderarmut
- 3.5 Armutsrisiko
- 3.6 Fallbeispiel
- 3.7 Folgen von Kinderarmut
- 3.8 Auswirkungen von Kindergärten
- 4 Ergebnisse der Grundsicherung
- 4.1 Kindergeld
- 4.2 Elterngeld
- 4.3 Ehegattensplitting
- 4.4 Familienbestandteile in der Grundsicherung nach SGB II
- 4.5 Förderung armer Kinder
- 4.6 Chancengleichheit armer Kinder in unserer Gesellschaft
- 4.7 Maßnahmen zur Verringerung von Kinderarmut
- 5 Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die Grundsicherung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern. Ziel ist es, die bestehenden Chancenungleichheiten aufzuzeigen und die Effektivität der aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut zu evaluieren.
- Definition und Abgrenzung von Armut und Kinderarmut
- Analyse der Grundsicherung und ihrer Komponenten (Kindergeld, Elterngeld etc.)
- Bewertung der Auswirkungen von Kinderarmut auf die Entwicklung von Kindern
- Untersuchung der Möglichkeiten zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe armer Kinder
- Diskussion von Maßnahmen zur Verringerung von Kinderarmut
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Methodik der Arbeit skizziert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Auswirkungen der Grundsicherung auf die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und benennt die Notwendigkeit einer detaillierten Analyse der bestehenden Systeme und Maßnahmen.
2 Theoretische Grundlagen und Definitionen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert zentrale Begriffe wie Armut, Kinderarmut und Grundsicherung und beleuchtet verschiedene Ansätze der Armutsforschung. Es werden verschiedene Modelle der Kindergrundsicherung diskutiert, inklusive bedarfsorientierter Ansätze, Bürgerversicherung und bedingungslosem Grundeinkommen. Die Kapitel schafft somit ein solides Fundament für die spätere Analyse der Ist-Situation.
3 Soll- und Ist-Zustand: Dieses Kapitel beschreibt den bestehenden Soll-Zustand, also die angestrebte Chancengleichheit für alle Kinder, und vergleicht ihn mit dem Ist-Zustand, der von erheblichen Chancenungleichheiten geprägt ist. Es analysiert die Ursachen von Kinderarmut, das Armutsrisiko und die Folgen von Kinderarmut für die betroffenen Kinder. Es werden statistische Daten herangezogen und ein Fallbeispiel illustriert die komplexen Auswirkungen. Der Einfluss von Kindergärten auf die Situation armer Kinder wird ebenfalls thematisiert.
4 Ergebnisse der Grundsicherung: Dieses Kapitel analysiert die Ergebnisse der bestehenden Grundsicherungssysteme in Bezug auf Kinder. Es untersucht die Effektivität von Maßnahmen wie Kindergeld, Elterngeld und Ehegattensplitting. Die Rolle der Familienbestandteile innerhalb der Grundsicherung nach SGB II wird beleuchtet, ebenso wie die Förderung armer Kinder und die Maßnahmen zur Verringerung von Kinderarmut. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern die aktuellen Maßnahmen zu Chancengleichheit für arme Kinder beitragen.
Schlüsselwörter
Grundsicherung, Kinderarmut, Chancengleichheit, gesellschaftliche Teilhabe, Armutsforschung, Kindergrundsicherung, SGB II, Kindergeld, Elterngeld, Familienpolitik, soziale Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Grundsicherung und Kinderarmut
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Grundsicherung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern. Sie untersucht bestehende Chancenungleichheiten und evaluiert die Effektivität aktueller Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Armut und Kinderarmut, analysiert die Komponenten der Grundsicherung (Kindergeld, Elterngeld etc.), bewertet die Auswirkungen von Kinderarmut auf die kindliche Entwicklung und untersucht Möglichkeiten zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe armer Kinder. Die Diskussion von Maßnahmen zur Verringerung von Kinderarmut bildet einen weiteren Schwerpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen und Definitionen, Soll- und Ist-Zustand, Ergebnisse der Grundsicherung und Diskussion und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein, Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar, Kapitel 3 beschreibt den Soll- und Ist-Zustand, Kapitel 4 analysiert die Ergebnisse der Grundsicherung und Kapitel 5 bietet eine abschließende Diskussion und ein Fazit.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Armutsforschung, definiert zentrale Begriffe wie Armut, Kinderarmut und Grundsicherung und beleuchtet verschiedene Ansätze der Armutsbekämpfung, inklusive Modelle der Kindergrundsicherung, Bürgerversicherung und bedingungsloses Grundeinkommen.
Wie wird der Soll- und Ist-Zustand dargestellt?
Kapitel 3 vergleicht den angestrebten Soll-Zustand (Chancengleichheit) mit dem Ist-Zustand, der von Chancenungleichheiten geprägt ist. Es analysiert die Ursachen von Kinderarmut, das Armutsrisiko, die Folgen von Kinderarmut und den Einfluss von Kindergärten. Statistische Daten und ein Fallbeispiel illustrieren die komplexen Auswirkungen.
Welche Ergebnisse der Grundsicherung werden analysiert?
Kapitel 4 analysiert die Effektivität von Maßnahmen wie Kindergeld, Elterngeld und Ehegattensplitting im Hinblick auf Kinder. Es untersucht die Rolle der Familienbestandteile im SGB II, die Förderung armer Kinder und Maßnahmen zur Verringerung von Kinderarmut. Der Fokus liegt auf dem Beitrag der Maßnahmen zur Chancengleichheit für arme Kinder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundsicherung, Kinderarmut, Chancengleichheit, gesellschaftliche Teilhabe, Armutsforschung, Kindergrundsicherung, SGB II, Kindergeld, Elterngeld, Familienpolitik, soziale Gerechtigkeit.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Grundsicherung auf die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern auswirkt und wie effektiv die Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut sind. Die detaillierte Analyse bestehender Systeme und Maßnahmen steht im Mittelpunkt.
Welche Methodik wird verwendet?
Die genaue Methodik wird in der Einleitung der Arbeit skizziert. Die Arbeit verwendet wahrscheinlich eine Kombination aus Literaturrecherche, Datenanalyse und möglicherweise qualitativen Methoden (z.B. Fallstudien).
- Citar trabajo
- Christina Carstens (Autor), 2020, Die Grundsicherung in Bezug auf die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe für Kinder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937226