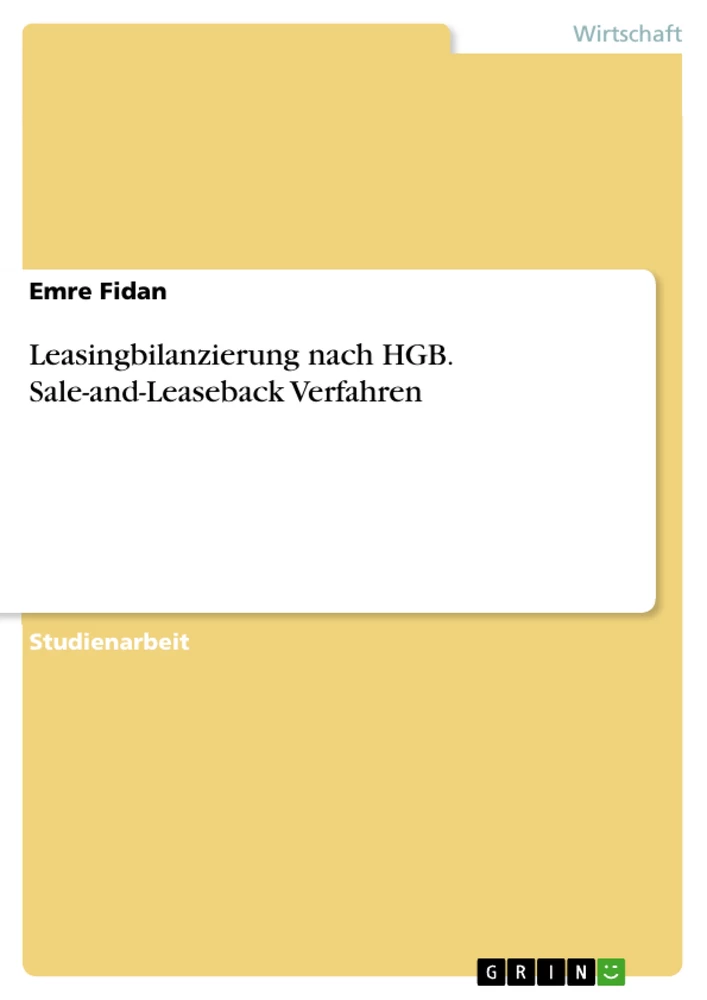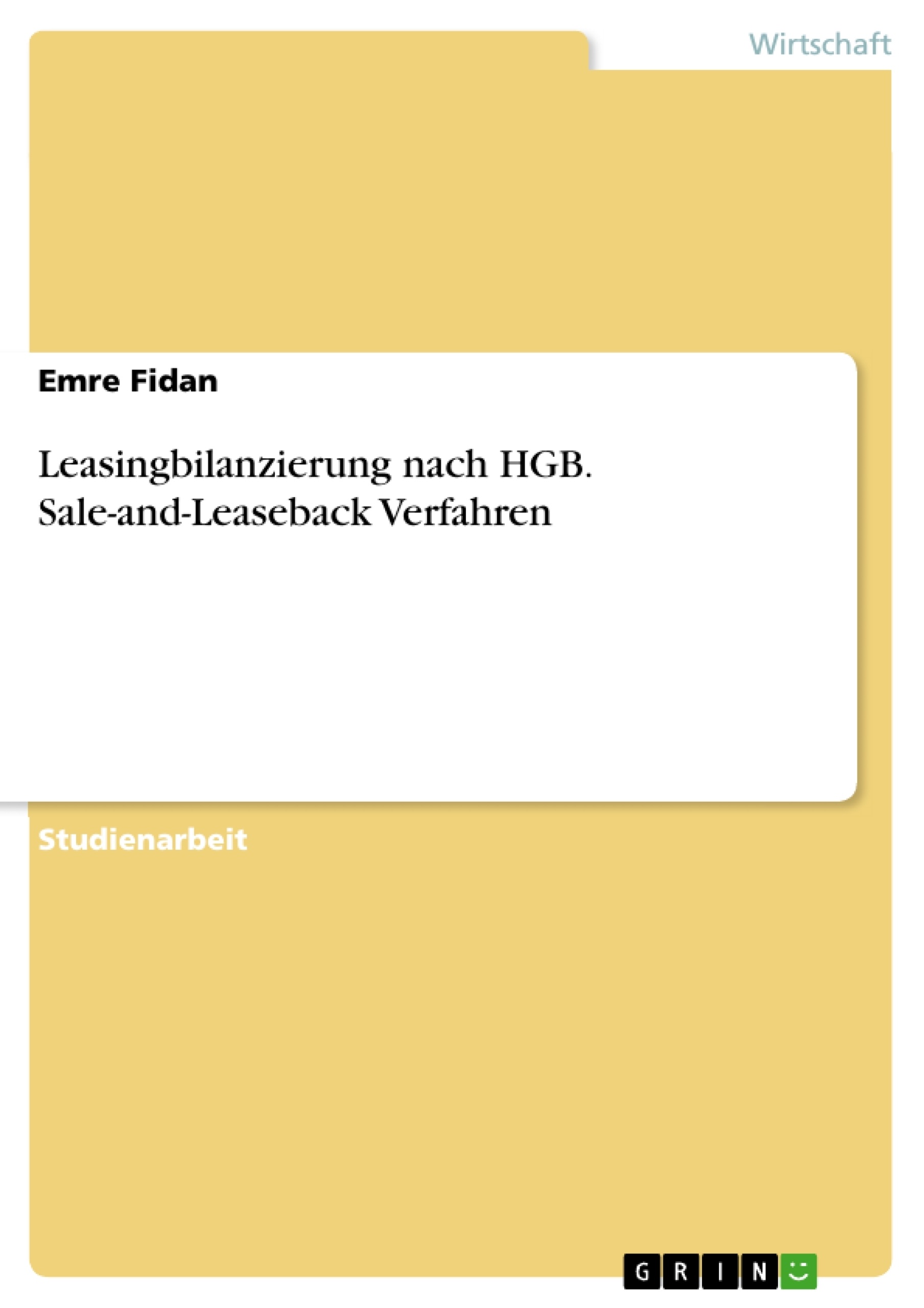Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach HGB aufzuzeigen. Zunächst erhält man im Kapitel zwei einen Überblick über die rechtliche Grundlage und eine Definition des Begriffs Leasing. Im Anschluss erfolgt eine Klassifzierung der Leasingverhältnisse, um die Zurechnung des Leasingguts, welche für die Bilanzierung maßgeblich ist, zu klären. Abschließend wird die Bilanzierung beim Leasinggeber bzw. Leasingnehmer im Detail betrachtet. Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit dem Sale-and-Leaseback Verfahren. Die Zusammenfassung in Kapitel drei beendet die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Bilanzierung nach deutschem Handelsrecht
- 2.1 Definition und die Rechtliche Grundlage
- 2.2 Klassifizierung von Leasingverhältnissen
- 2.2.1 Operating-Leasing
- 2.2.2 Spezialleasing
- 2.2.3 Finanzierungsleasing
- 2.2.3.1 Vollamortisationsverträge (Full-pay-out-Leasing)
- 2.2.3.2 Teilamortisationsverträge (Non-pay-out-Leasing)
- 2.2.4 Bilanzierung beim Leasinggeber
- 2.2.5 Bilanzierung beim Leasingnehmer
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, die Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) darzustellen. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Grundlagen, der Klassifizierung verschiedener Leasingformen und der korrekten Bilanzierung sowohl vom Standpunkt des Leasinggebers als auch des Leasingnehmers.
- Rechtliche Grundlagen der Leasingbilanzierung nach HGB
- Klassifizierung von Leasingverhältnissen (Operating-Leasing, Finanzierungsleasing etc.)
- Bilanzierung beim Leasinggeber
- Bilanzierung beim Leasingnehmer
- Anwendung des Prinzips der wirtschaftlichen Zugehörigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Leasingbilanzierung ein. Es wird die Bedeutung des Leasings im deutschen Markt hervorgehoben und die Problematik der Zuordnung des Leasingobjekts thematisiert. Der Gang der Untersuchung wird skizziert, wobei die Arbeit sich auf die Bilanzierung nach HGB konzentriert und Sale-and-Leaseback-Verfahren explizit ausschließt.
2. Bilanzierung nach deutschem Handelsrecht: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach deutschem Handelsrecht. Es beginnt mit einer Definition des Begriffs „Leasing“ und beleuchtet die relevanten rechtlichen Grundlagen, insbesondere im Hinblick auf das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gemäß § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB. Die Klassifizierung von Leasingverhältnissen in verschiedene Kategorien (Operating-Leasing, Finanzierungsleasing etc.) wird detailliert dargestellt, wobei die jeweilige Bilanzierung sowohl für den Leasinggeber als auch für den Leasingnehmer erläutert wird. Die Unterscheidung zwischen Vollamortisations- und Teilamortisationsverträgen innerhalb des Finanzierungsleasings wird ebenfalls behandelt. Die Kapitelteil betont die Bedeutung der korrekten Zuordnung des Leasinggutes für die Bilanzierung.
Schlüsselwörter
Leasingbilanzierung, HGB, Bilanzierung, Leasingverhältnisse, Finanzierungsleasing, Operating-Leasing, wirtschaftliche Zugehörigkeit, Leasinggeber, Leasingnehmer, BilMoG, Handelsrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach HGB
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Sie erläutert die rechtlichen Grundlagen, die verschiedenen Leasingformen und die korrekte Bilanzierung aus der Sicht des Leasinggebers und des Leasingnehmers.
Welche Leasingformen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten von Leasingverhältnissen, darunter Operating-Leasing, Finanzierungsleasing (inkl. Vollamortisationsverträge und Teilamortisationsverträge), und Spezialleasing. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung und der korrekten Bilanzierung jeder Form.
Welche Aspekte der Bilanzierung werden detailliert dargestellt?
Die Seminararbeit beschreibt detailliert die Bilanzierung sowohl vom Standpunkt des Leasinggebers als auch des Leasingnehmers. Sie legt besonderen Wert auf die Anwendung des Prinzips der wirtschaftlichen Zugehörigkeit gemäß § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB und die korrekte Zuordnung des Leasinggutes.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Bilanzierung nach deutschem Handelsrecht und eine Zusammenfassung. Das Hauptkapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen, die Klassifizierung von Leasingverhältnissen und die detaillierte Bilanzierung für beide Vertragsparteien. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die relevanten rechtlichen Grundlagen der Leasingbilanzierung nach dem HGB, insbesondere das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Sie konzentriert sich auf die Vorschriften des HGB und berücksichtigt das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) implizit durch die Anwendung aktueller Bilanzierungsregeln.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Seminararbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören: Leasingbilanzierung, HGB, Bilanzierung, Leasingverhältnisse, Finanzierungsleasing, Operating-Leasing, wirtschaftliche Zugehörigkeit, Leasinggeber, Leasingnehmer, BilMoG, Handelsrecht.
Wird Sale-and-Leaseback in der Arbeit behandelt?
Nein, die Arbeit konzentriert sich explizit auf die Bilanzierung von Leasingverhältnissen und schließt Sale-and-Leaseback-Verfahren aus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach HGB zu vermitteln und die korrekte Anwendung der Bilanzierungsvorschriften zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Emre Fidan (Author), 2020, Leasingbilanzierung nach HGB. Sale-and-Leaseback Verfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/936727