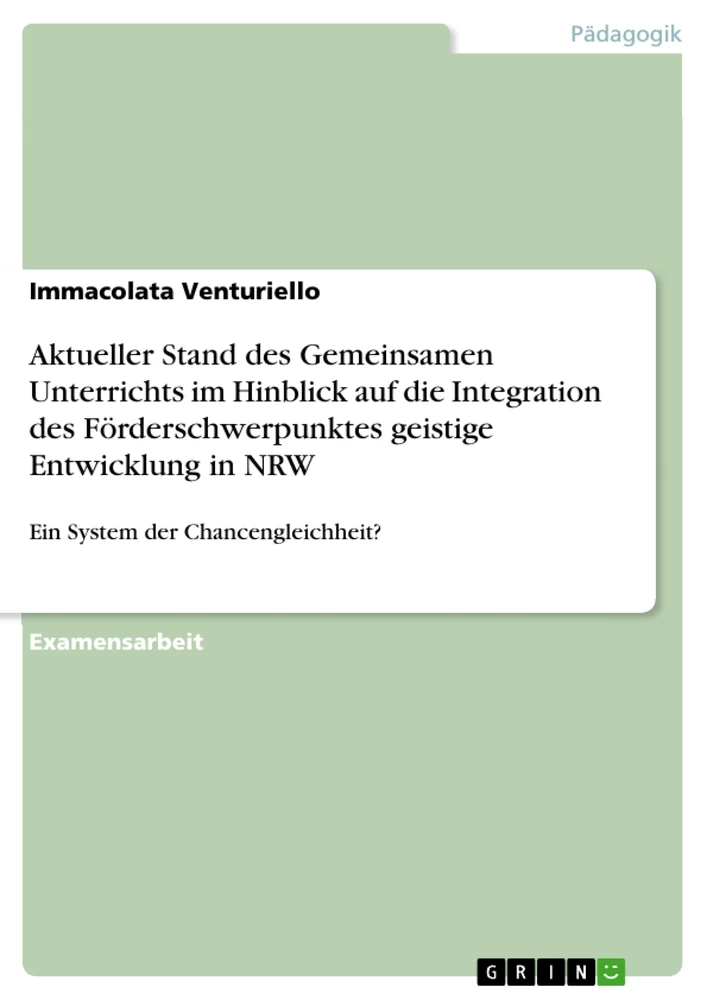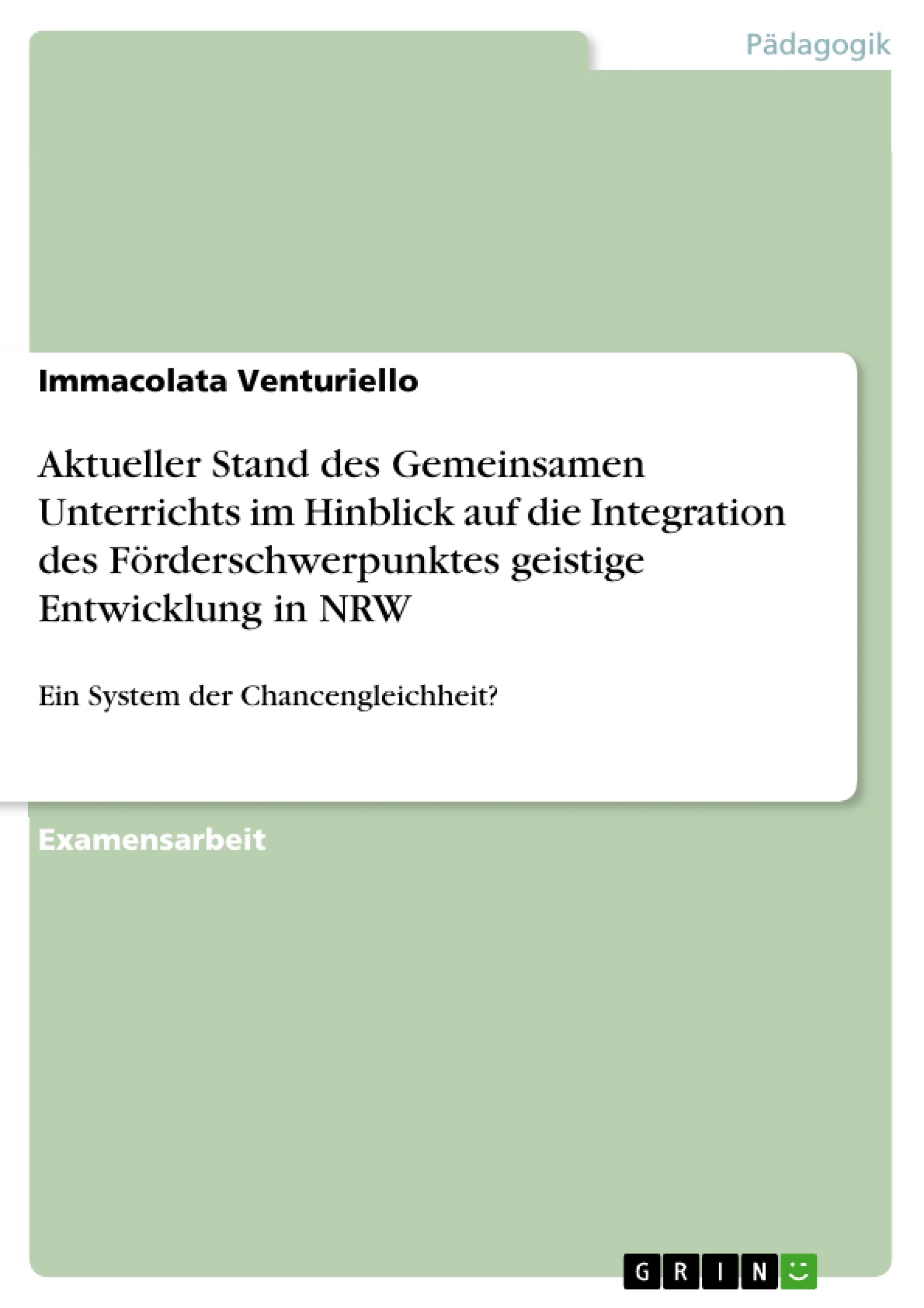Der Gemeinsame Unterricht, der Gegenstand dieser Arbeit sein soll, ist der bislang erfolgreichste und am meisten verbreitete Versuch des Schulsystems allen Schülern gleiche Lerngrundlagen und Möglichkeiten mitzugeben.
Ob die Art und Weise, wie der Gemeinsame Unterricht in NRW durchgeführt wird und gesetzlich festgelegt ist, für echte Chancengleichheit sorgt, soll im Rahmen dieser Arbeit erörtert werden.
Dabei soll zunächst der Personenkreis eingegrenzt und ein kurzer historischer Überblick über die sonderpädagogische Förderung in der BRD gegeben werden. Weiterhin wird der Bereich der schulischen Integration beschrieben, wobei die Form des Gemeinsamen Unterrichts im Mittelpunkt stehen soll.
Im darauf folgenden Kapitel wird der Gemeinsame Unterricht, vor allem wie er in Nordrhein- Westfalen stattfindet, dargestellt. Diese Eingrenzung ist notwendig, da der Bildungsföderalismus große Unterschiede in der Praxis der integrativen Beschulung der BRD mit sich bringt. Um die Thematik nicht nur theoretisch, mit Hilfe von Literatur, zu beleuchten, wurden Interviews geführt, die in Kapitel 4 dargestellt und hinsichtlich ausgewählter Themenbereiche ausgewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Zielsetzung
- Methodik
- Die Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland- Ein historischer Überblick
- Entwicklung bis 1945
- Phase des Aufbaus
- Phase des Ausbaus
- Phase des Umbaus
- Schulische Integration- sonderpädagogische Förderung in allgemeinen Schulen
- Begriffsbestimmung
- Organisationsformen der sonderpädagogischen Förderung in den allgemeinen Schulen Nordrhein-Westfalens
- Gemeinsamer Unterricht
- Der Gemeinsame Unterricht in Nordrhein-Westfalen
- Schulversuche zum Gemeinsamen Unterricht in NRW
- Positionen der Landesregierung auf dem Weg zu einer gesetzlichen Regelung sonderpädagogischer Förderung in Nordrhein-Westfalen
- Das Gesetz zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Schulen
- Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und zur Festlegung des Förderortes
- Gegenwärtiger Stand der schulpolitischen Entwicklungen
- Der Gemeinsame Unterricht in der Praxis am Beispiel einer Wuppertaler und Zwei Kölner Schulen
- Vorstellung der Peter- Petersen Schule (Köln), der Ernst- Moritz- Arndt Schule (Köln) und der Gemeinschaftsgrundschule Rudolfstraße (Wuppertal)
- Wichtige Aussagen und Ergebnisse der Interviews
- Aussagen bezüglich besonderer Organisationsformen des jeweiligen Gemeinsamen Unterrichts
- Darstellung der Verteilung der Förderschwerpunkte an o. g. Schulen
- Aussagen bezüglich der Aufnahme von Schülern mit Förderschwerpunkt
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Staatsexamensarbeit befasst sich mit dem aktuellen Stand des Gemeinsamen Unterrichts im Hinblick auf die Integration des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Chancen des Gemeinsamen Unterrichts in der Praxis zu beleuchten und die Frage zu untersuchen, ob das System der sonderpädagogischen Förderung in NRW tatsächlich ein System der Chancengleichheit darstellt.
- Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts in NRW
- Organisationsformen und Praxisbeispiele des Gemeinsamen Unterrichts
- Herausforderungen und Chancen der Integration von Schülern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und schulpolitische Entwicklungen
- Chancengleichheit im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit dar. Sie führt ein in die Thematik des Gemeinsamen Unterrichts und die Integration von Schülern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Das erste Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland. Es beschreibt die verschiedenen Phasen und Entwicklungsschritte, die zu den heutigen Formen der Förderung führten. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der schulischen Integration und den Organisationsformen der sonderpädagogischen Förderung in allgemeinen Schulen Nordrhein-Westfalens. Der Fokus liegt dabei auf dem Gemeinsamen Unterricht als einer Form der Integration. Das dritte Kapitel beleuchtet den Gemeinsamen Unterricht in Nordrhein-Westfalen. Es analysiert die Schulversuche, die zur Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts führten, beschreibt die Positionen der Landesregierung und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Es wird zudem der gegenwärtige Stand der schulpolitischen Entwicklungen dargestellt. Das vierte Kapitel stellt anhand von Praxisbeispielen aus Wuppertal und Köln die Herausforderungen und Chancen des Gemeinsamen Unterrichts in der Praxis dar. Es werden Interviews mit Lehrkräften und Schulleitungen ausgewertet und wichtige Aussagen und Ergebnisse der Interviews präsentiert. Die Diskussion greift die Ergebnisse der Arbeit auf und diskutiert die Herausforderungen und Chancen des Gemeinsamen Unterrichts im Hinblick auf die Integration von Schülern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.
Schlüsselwörter
Gemeinsamer Unterricht, Inklusion, Integration, Sonderpädagogische Förderung, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Chancengleichheit, Schulsystem, Heterogenität, Nordrhein-Westfalen, Praxisbeispiele, Interviews.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Gemeinsamer Unterricht" (GU) in NRW?
GU bezeichnet die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in einer allgemeinen Schule.
Wie wird der Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" integriert?
Die Arbeit untersucht, wie Schüler mit diesem speziellen Bedarf im GU gefördert werden und welche praktischen Herausforderungen dabei entstehen.
Bietet der Gemeinsame Unterricht echte Chancengleichheit?
Dies ist eine zentrale Frage der Arbeit, die sowohl gesetzliche Regelungen als auch die Schulpraxis kritisch hinterfragt.
Wie wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt?
Es gibt ein formelles Verfahren (AO-SF), bei dem Gutachter den Bedarf prüfen und den geeigneten Förderort vorschlagen.
Welche Rolle spielen Inklusion und Integration?
Während Integration oft die Anpassung des Kindes meint, zielt Inklusion auf ein System ab, das von vornherein auf die Verschiedenheit aller Schüler ausgelegt ist.
- Citar trabajo
- Immacolata Venturiello (Autor), 2006, Aktueller Stand des Gemeinsamen Unterrichts im Hinblick auf die Integration des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung in NRW, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93661