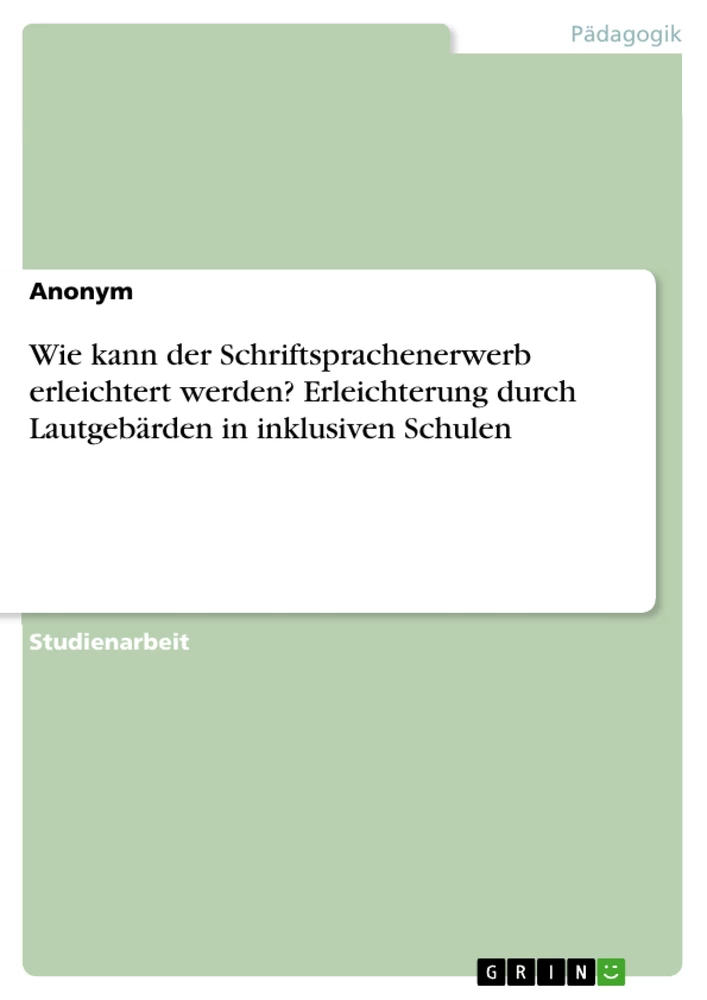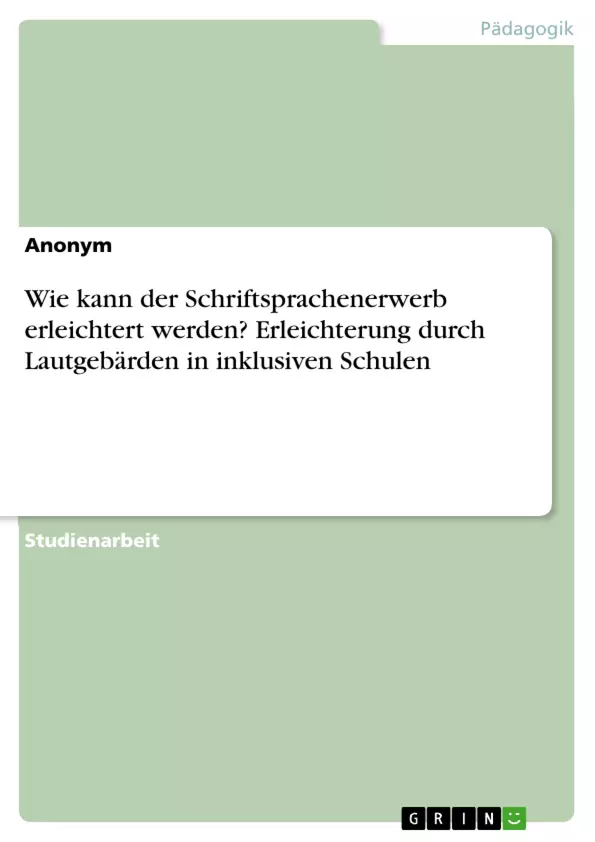Diese Arbeit geht der Frage nach, wie der Schriftspracherwerb, also die Erlangung basaler Lese- und Schreibkompetenzen, durch Lautgebärden erleichtert werden kann. Untersuchungsort sind dabei besonders inklusive Schulen.
Um den Kindern eine Unterstützung im Durchlaufen des Schriftspracherwerbs zu bieten, kann man als Lehrperson mit dem Eintritt der Kinder in die alphabetische Strategie die Lautgebärden im Unterricht einführen. Mit Beginn der ersten Klasse und dem Erlernen der Buchstaben in Kombination zu Lauten, wird das Anwenden der Lautgebärden sinnvoll, sie geben den Kindern einen direkten Bezug zu den Buchstaben und Lauten. Des Weiteren fördern die Lautgebärden das Herstellen und Speichern der Graphem-Phonem-Korrespondenz und die Artikulation der Kinder.
Für die Anwendung der Lautgebärden in inklusiven Schulen könnten gerade die motorischen, koordinativen und abstrahierenden Punkte bei der Durchführung von Lautgebärden überfordernd wirken, jedoch darf man hierbei nicht vergessen das dies ein methodisches Lern- und Entwicklungsfeld im Schriftspracherwerb darstellt, welches eher unterstützend wirkt. Lautgebärden gibt es noch nicht in allen Grundschulen und inklusiven Schulen in Deutschland und somit ist es auch den Schulen freigestellt diese im Unterricht zu integrieren. Wenn sich aber eine Schule dafür entscheidet Lautgebärden zu verwenden ist es wichtig, dass es sich um einheitliche Lautgebärden innerhalb einer Schule handelt, um eine angemessene Unterstützung des Schriftspracherwerbs in allen Fächern zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeine Informationen zum Schriftspracherwerb
- 1.1. Definition des Schriftspracherwerbs
- 1.2. Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs
- 2. Unterschied zwischen Lautgebärden und der Deutschen Gebärdensprache
- 2.1. Die Deutsche Gebärdensprache
- 2.2. Lautgebärden zur Unterstützung des Schriftspracherwerbs
- 3. Theoretische Grundlagen von Lautgebärden
- 3.1. Leitlinie zur Auswahl von Lautgebärden
- 3.2. Stellung, Wirkung und Implementierung von Lautgebärden im Unterricht
- 3.3. Lautgebärden im Lehrplan und die Umsetzung in der Praxis
- 4. Beispiele für unterschiedliche Lautgebärdensysteme
- 4.1. Der Kieler Leseaufbau
- 4.2. Das „ABC der Tiere“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Schriftspracherwerb und die unterstützende Rolle von Lautgebärden in inklusiven Schulen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen von Lautgebärden zu beleuchten und deren praktische Implementierung im Unterricht zu diskutieren. Dabei werden verschiedene Lautgebärdensysteme vorgestellt und im Kontext der Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs betrachtet.
- Definition und Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs
- Unterschied zwischen Lautgebärden und Deutscher Gebärdensprache (DGS)
- Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung von Lautgebärden im Unterricht
- Beispiele verschiedener Lautgebärdensysteme
- Der Einfluss von Lautgebärden auf den Schriftspracherwerb in inklusiven Settings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeine Informationen zum Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel definiert den Schriftspracherwerb als mehrstufigen Prozess des Lesen- und Schreibenlernens, der verschiedene Teilfertigkeiten umfasst, von der Buchstaben-Laut-Zuordnung bis zum Verständnis der Schreibrichtung. Es werden wichtige Entwicklungsstufen anhand des Modells von Uta Frith (1985) erläutert, das die logographische, alphabetische und orthographische Phase beschreibt. Die Grenzen des Modells im deutschen Kontext werden angesprochen, und Erweiterungen durch Scheerer-Neumann (1986) und Valtin (1997) werden erwähnt, wobei die Bedeutung des familiären Umfelds hervorgehoben wird. Der Text betont die Notwendigkeit visueller Aufmerksamkeit, Diskriminationsfähigkeit und eines ausgeprägten Wortschatzes für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb.
2. Unterschied zwischen Lautgebärden und der Deutschen Gebärdensprache: Das Kapitel beleuchtet die Geschichte und den Status der Deutschen Gebärdensprache (DGS). Es beschreibt die lange Zeit der Unterdrückung der DGS nach dem Mailänder Beschluss von 1880 und den daraus resultierenden negativen Folgen für die Bildung und Emanzipation Gehörloser. Im Kontrast dazu wird die Entwicklung und die letztendlich erreichte Anerkennung der DGS als offizielle Sprache in Deutschland im Jahr 2002 hervorgehoben. Der Text erwähnt regionale Dialekte innerhalb der DGS und betont den fundamentalen Unterschied zwischen DGS als eigenständiger Sprache und Lautgebärden als unterstützendem Hilfsmittel im Schriftspracherwerb.
Schlüsselwörter
Schriftspracherwerb, Lautgebärden, Deutsche Gebärdensprache (DGS), inklusive Schule, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, Entwicklungsstufen, Graphem-Phonem-Korrespondenz, inklusive Pädagogik, Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Schriftspracherwerb und Lautgebärden
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Schriftspracherwerb und die unterstützende Rolle von Lautgebärden, insbesondere in inklusiven Schulen. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der theoretischen Grundlagen von Lautgebärden und deren praktischer Umsetzung im Unterricht. Verschiedene Lautgebärdensysteme werden vorgestellt und im Kontext der Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs betrachtet. Der Unterschied zwischen Lautgebärden und Deutscher Gebärdensprache (DGS) wird deutlich herausgestellt.
Was sind die zentralen Themen des Textes?
Die zentralen Themen sind der Schriftspracherwerb, die Definition und der Unterschied zwischen Lautgebärden und Deutscher Gebärdensprache (DGS), die theoretischen Grundlagen und die praktische Anwendung von Lautgebärden im Unterricht, verschiedene Lautgebärdensysteme (z.B. Kieler Leseaufbau, „ABC der Tiere“), sowie der Einfluss von Lautgebärden auf den Schriftspracherwerb in inklusiven Settings.
Welche Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs werden beschrieben?
Der Text beschreibt die Entwicklungsstufen des Schriftspracherwerbs anhand des Modells von Uta Frith (1985), welches die logographische, alphabetische und orthographische Phase umfasst. Es werden jedoch auch die Grenzen dieses Modells im deutschen Kontext angesprochen und Erweiterungen durch Scheerer-Neumann (1986) und Valtin (1997) erwähnt. Die Bedeutung des familiären Umfelds und die Notwendigkeit visueller Aufmerksamkeit, Diskriminationsfähigkeit und eines ausgeprägten Wortschatzes werden hervorgehoben.
Was ist der Unterschied zwischen Lautgebärden und Deutscher Gebärdensprache (DGS)?
Der Text betont den fundamentalen Unterschied zwischen DGS als eigenständiger Sprache und Lautgebärden als unterstützendem Hilfsmittel im Schriftspracherwerb. Er beleuchtet die Geschichte der DGS, ihre lange Zeit der Unterdrückung und die schließlich erreichte Anerkennung als offizielle Sprache in Deutschland. Regionale Dialekte innerhalb der DGS werden ebenfalls erwähnt.
Welche Beispiele für Lautgebärdensysteme werden genannt?
Als Beispiele für Lautgebärdensysteme werden der Kieler Leseaufbau und das „ABC der Tiere“ genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Schriftspracherwerb, Lautgebärden, Deutsche Gebärdensprache (DGS), inklusive Schule, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, Entwicklungsstufen, Graphem-Phonem-Korrespondenz, inklusive Pädagogik, Unterricht.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für Pädagogen, Lehramtsstudenten, Logopäden, Sonderpädagogen und alle, die sich mit dem Schriftspracherwerb und inklusiver Bildung auseinandersetzen. Er bietet wertvolle Informationen für die praktische Arbeit im Unterricht und die theoretische Fundierung des Themas.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Wie kann der Schriftsprachenerwerb erleichtert werden? Erleichterung durch Lautgebärden in inklusiven Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/934685