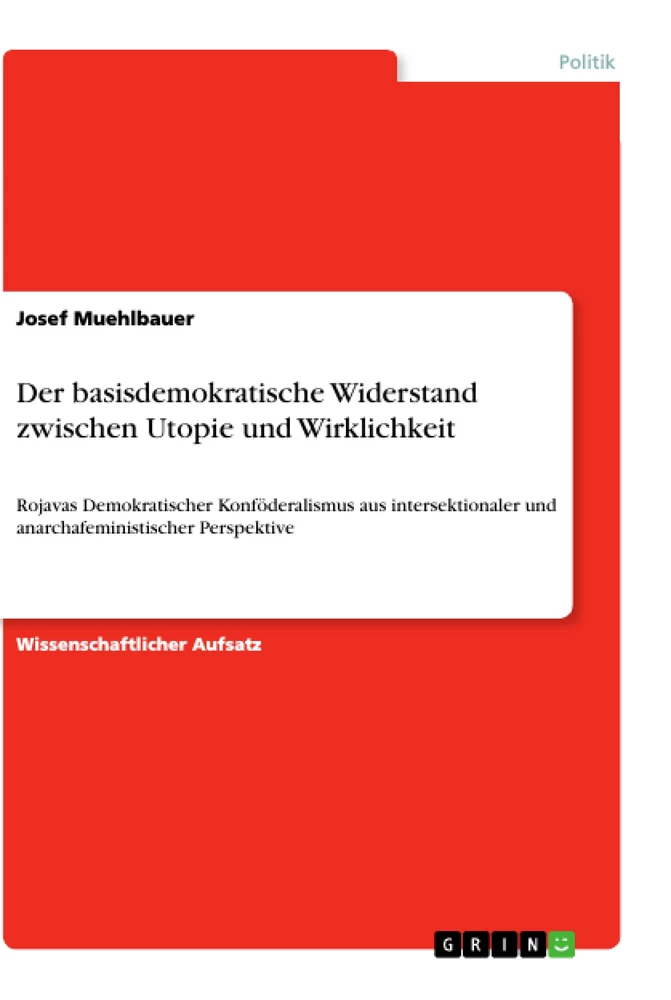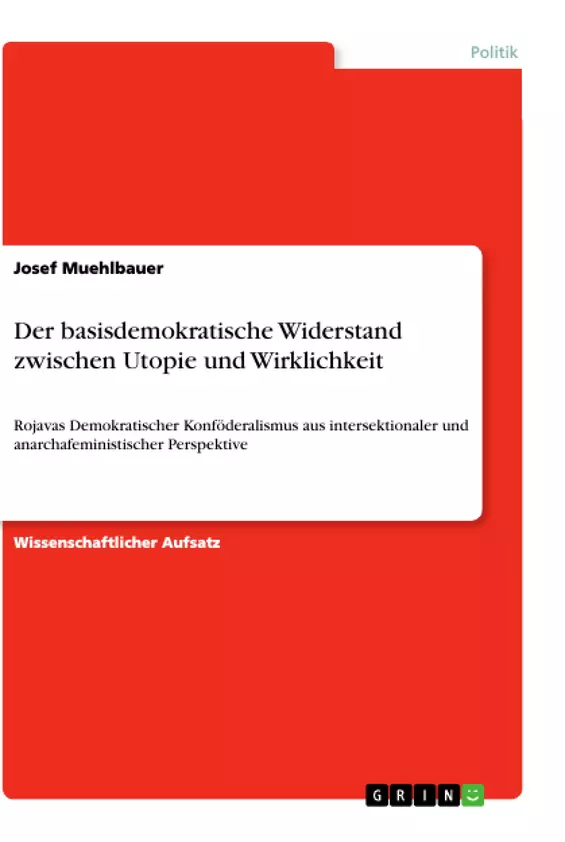Auf interdisziplinäre Art und Weise untersucht der Beitrag die Gesellschaftskonfiguration, also den Demokratischen Konföderalismus Rojavas. Dabei werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse, entlang von Kategorien wie Race, Class und Gender auf der Subjekt-, Struktur-, und Symbolebene intersektional analysiert.
Es werden soziale Ungleichheiten, Formen der Diskriminierung, sowie Partizipations- und Selbstermächtigungsmöglichkeiten in der Konfiguration der Herrschaftsinstitutionen erforscht. Gezeigt wird, inwieweit gesellschaftliche Spannungsverhältnisse mittels basisdemokratischer Konsensfindung und polit-ökonomischer Inklusion von Frauen und ethnischer Minderheiten friedlich entschärft werden konnten.
Ausgegangen wird von der These, dass der Demokratische Konföderalismus eine gesellschaftliche Kooperationsform mit anarchafeministischen Merkmalen ist, welche einen geringen Einsatz von Gewalt, Zwang und Hierarchie aufweist. Der Beitrag geht über eine Policy-Analyse des Gesellschaftsvertrages hinaus, stützt sich kombinatorisch auf empirische und theoretische Quellen und deckt die progressiven Elemente, als auch die Widersprüche und ambivalenten Machtkonstellationen Rojavas auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfrage und -Relevanz
- Theoretischer Rahmen und Begriffsbestimmung
- Intersektionalität
- Politischer Anarchismus und Anarchafeminismus
- Methodologische Herangehensweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Demokratischen Konföderalismus Rojavas und analysiert seine gesellschaftliche Konfiguration aus intersektionaler und anarchafeministischer Perspektive. Die Untersuchung zielt darauf ab, Macht- und Herrschaftsverhältnisse in Rojava entlang von Kategorien wie Race, Class und Gender auf der Subjekt-, Struktur- und Symbolebene zu analysieren. Der Beitrag beleuchtet soziale Ungleichheiten, Formen der Diskriminierung sowie Partizipations- und Selbstermächtigungsmöglichkeiten innerhalb der herrschenden Institutionen.
- Intersektionalität als Analyseinstrument für Machtstrukturen und Diskriminierung in Rojava
- Anarchafeministische Prinzipien und ihre Umsetzung im Demokratischen Konföderalismus
- Basisdemokratische Entscheidungsfindung und die Inklusion von Frauen und ethnischen Minderheiten
- Ambivalente Machtverhältnisse und Spannungsfelder zwischen idealen und realen Strukturen
- Bewertung des Demokratischen Konföderalismus als Gesellschaftsmodell mit anarchafeministischen Merkmalen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Beitrag stellt die Forschungsfrage und -relevanz vor und skizziert den aktuellen Forschungsstand zum Demokratischen Konföderalismus Rojavas.
- Theoretischer Rahmen und Begriffsbestimmung: Dieser Abschnitt erläutert die theoretischen Grundlagen der Intersektionalität und des Anarchismus, wobei der Fokus auf den Anarchafeminismus gelegt wird.
- Methodologische Herangehensweise: Es wird eine innovative Herangehensweise vorgestellt, die intersektional geprägt ist und Macht- und Herrschaftsverhältnisse anhand der Kategorien Race, Class und Gender auf drei Ebenen (Struktur-, Symbol- und Subjektebene) analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Beitrags sind Intersektionalität, Anarchafeminismus, Basisdemokratie, Demokratischer Konföderalismus, Geschlechterverhältnisse, Rojava. Der Beitrag analysiert den Demokratischen Konföderalismus Rojavas, ein Gesellschaftssystem, das auf dezentralen Strukturen, Selbstverwaltung und der Einbeziehung aller Gesellschaftsgruppen, insbesondere von Frauen und ethnischen Minderheiten, basiert. Die Untersuchung beleuchtet die Umsetzung anarchafeministischer Prinzipien und die Herausforderungen und Chancen, die mit der Verwirklichung von basisdemokratischen und inklusiven Gesellschaftsstrukturen verbunden sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Demokratische Konföderalismus in Rojava?
Es handelt sich um ein Gesellschaftssystem, das auf dezentralen Strukturen, Selbstverwaltung und der Einbeziehung aller Gruppen, insbesondere Frauen und ethnischer Minderheiten, basiert.
Was bedeutet eine intersektionale Analyse in diesem Kontext?
Dabei werden Macht- und Herrschaftsverhältnisse gleichzeitig entlang der Kategorien Race, Class und Gender auf verschiedenen Ebenen (Subjekt, Struktur, Symbol) untersucht.
Welche Rolle spielt der Anarchafeminismus?
Der Beitrag betrachtet den Demokratischen Konföderalismus als Kooperationsform mit anarchafeministischen Merkmalen, die auf die Reduzierung von Hierarchie, Zwang und Gewalt abzielt.
Wie werden gesellschaftliche Spannungen in Rojava gelöst?
Spannungsverhältnisse konnten bisher oft durch basisdemokratische Konsensfindung und die polit-ökonomische Inklusion marginalisierter Gruppen friedlich entschärft werden.
Untersucht die Arbeit nur die Theorie oder auch die Praxis?
Die Arbeit stützt sich auf eine Kombination aus empirischen und theoretischen Quellen, um sowohl progressive Elemente als auch reale Widersprüche und Machtkonstellationen aufzudecken.
- Quote paper
- Josef Muehlbauer (Author), 2019, Der basisdemokratische Widerstand zwischen Utopie und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/933380