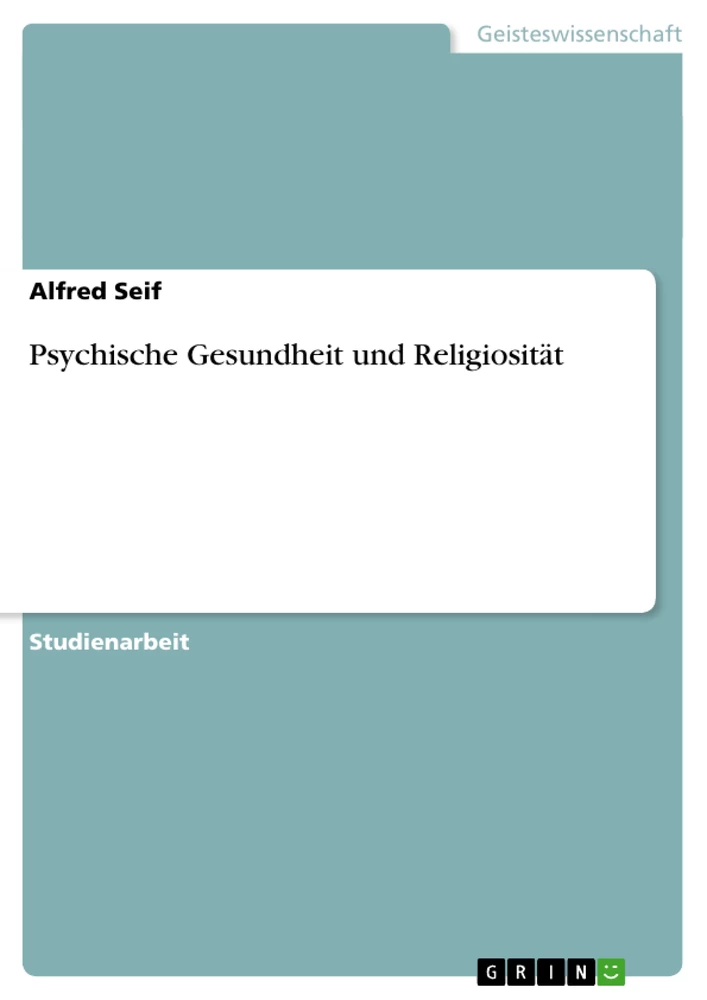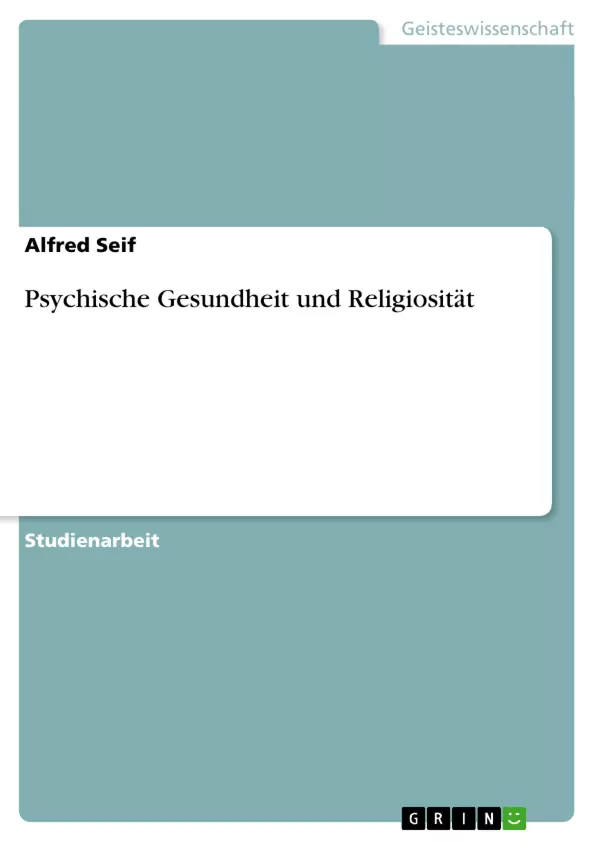Macht Religion oder Religiosität krank oder verläuft die Wirkung umgekehrt und neigen psychisch kranke oder auffällige Menschen zu Religiosität? Auf der einen Seite, so Godwin
Lämmermann (1) finden sich Belege für einen positiven Effekt von Religiosität auf die psychische Gesundheit - andererseits gibt es Hinweise, dass Religiosität mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt. Lämmermann führt dabei Henning (Henning u.a., 2003, 147)
an, dass „insgesamt mehr Studien eine positive als eine negative Korrelation nachweisen.“ Allerdings zeigten sich hier „only slightly positive correlates of religion“ (Bergin 1983, 170) und diese Effekte sind auch nur geringfügig (O`Conolly u.a.2002,56;Bergin 1983, 176).
Es sei, glaube man Murken (1994, 141), „innerhalb der Religionspsychologie die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Religiosität und seelischer Gesundheit eine der am meisten diskutierten“. Die Frage, wie Religion und Gesundheit zusammenhingen, sei nicht einfach zu beantworten. Der Grund sei, dass die meisten empirischen Untersuchungen dazu auf Korrelationen beruhten, über die kausalen Wirkungsverhältnisse jedoch wenig aussagten und somit kein wirklich treffendes Bild über dieses Problem abgeben würden. Dabei könne man nie völlig ausschließen, dass Korrelationen von anderen intervenierenden Variablen beeinflusst würden. Wenn extrem religiöse Menschen weniger suchtgefährdet seien, so könne dies nicht nur auf die prophylaktische Wirkung starker Religiosität, sondern genauso auf rigider sozialer Kontrolle oder Selbstbeschränkung oder aber auch auf religiös bewirkten Angst- und Schuldgefühlen beruhen.
Glaube man den vielen amerikanischen Studien zu diesem Thema, dann sind religiöse Menschen gesünder, angstfreier und zuversichtlicher als Atheisten. „Die große Mehrzahl der Studien erweist, dass Religion heilsame Wirkungen auf die Gesundheit ausübt“ (Utsch 2005, 159) . Viele andere Untersuchung ergäben, dass suchtkrank und sexgierig werde, wer sein spirituelles Potenzial nicht ausschöpfe (Utsch 2005, 189) und dass der „Verlauf einer schweren Krebserkrankung ... von der Religiosität und Spiritualität des Patienten mitgesteuert“ werde. Dieser Euphorie stehe jedoch entgegen, dass viele dieser Studien, so Lämmermann, von evangelikalen Forschern stamme. Satura (1981, 6) stellt die Frage, ob „es in der religiösen Erfahrung Momente gibt, die zur seelischen Gesundheit beitragen“ und vermutet diesbezüglich vier Zusammenhänge, in denen Religiosität positiv wirken könne:
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Bedeutung der Religiosität für die Gesundheit
- 1. Religionspsychologie und Gesundheitsforschung
- 2. Religiosität und Wohlbefinden
- 3. Religion und Angst
- 4. Religiosität und Depression
- 5. Religiosität und Neurose
- 6. Religiöse Wahnvorstellungen
- II. Mitgliedschaft in einer extremen religiösen Gruppe
- 1. Destruktive Gruppen
- 2. Anwerben und Erzeugen von Abhängigkeit
- 3. Die Führungsinstanz
- 4. Die Indoktrination
- III. Zeugen Jehovas und psychische Gesundheit
- 1. Die Zeugen Jehovas unter dem Aspekt der Sozialpsychologie
- a) Kognitive Dissonanz und Zeugen Jehovas
- b) Psychologische Reaktanz bei den Zeugen Jehovas
- c) Soziale Vergleichsprozesse bei den Zeugen Jehovas
- d) Selbstwerterhaltung und Selbstwerterhöhung bei den Zeugen Jehovas
- 2. Die Untersuchung der seelischen Gesundheit der Zeugen Jehovas von Jerry Bergman
- a) Zeugen Jehovas und das Problem der psychischen Erkrankungen
- b) Zu Erkrankungen beitragende Faktoren
- 3. Stellungnahme der Zeugen Jehovas Deutschland und persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Religiosität. Ziel ist es, verschiedene Facetten dieser Beziehung zu beleuchten und die Auswirkungen von Religiosität auf das Wohlbefinden zu analysieren. Dabei werden sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt.
- Der Einfluss von Religiosität auf die psychische Gesundheit (positive und negative Korrelationen).
- Die Rolle von Religiosität bei Angst und Depression.
- Die Auswirkungen extremer religiöser Gruppen auf die psychische Gesundheit.
- Eine Fallstudie zu den Zeugen Jehovas und deren psychischer Gesundheit.
- Die Bedeutung von Selbstwertgefühl und Selbstkonzept im Kontext von Religiosität und psychischer Gesundheit.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Bedeutung der Religiosität für die Gesundheit: Dieses Kapitel erörtert den vielschichtigen Zusammenhang zwischen Religiosität und psychischer Gesundheit. Es werden Studien vorgestellt, die sowohl positive als auch negative Korrelationen belegen. Die Schwierigkeit, kausale Zusammenhänge zu definieren, wird hervorgehoben, da intervenierende Variablen den Einfluss von Religiosität auf die Gesundheit beeinflussen können. Die Arbeit diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven von Forschern und die Komplexität der Thematik, wobei sowohl positive Effekte wie z.B. angsthemmende Wirkung als auch negative Effekte wie z.B. religiös bedingte Angst und Schuldgefühle berücksichtigt werden. Es wird der Frage nachgegangen, ob Religion krank machen kann oder ob sie im Gegenteil einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat.
II. Mitgliedschaft in einer extremen religiösen Gruppe: Dieser Abschnitt befasst sich mit den destruktiven Auswirkungen einer Mitgliedschaft in extremen religiösen Gruppen auf die psychische Gesundheit. Es werden Mechanismen wie Anwerbung, Abhängigkeitserzeugung und Indoktrination analysiert, die zur Beeinträchtigung des individuellen Wohlbefindens beitragen können. Die Rolle der Führungsstruktur und die Methoden der Manipulation werden beleuchtet, um die Prozesse zu verstehen, die zu einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit führen können.
III. Zeugen Jehovas und psychische Gesundheit: Dieses Kapitel analysiert die psychische Gesundheit von Zeugen Jehovas unter sozialpsychologischen Aspekten. Es werden Konzepte wie kognitive Dissonanz, psychologische Reaktanz und soziale Vergleichsprozesse im Kontext der Glaubensgemeinschaft untersucht. Die Arbeit bezieht sich auf eine Studie von Jerry Bergman, die sich mit psychischen Erkrankungen bei Zeugen Jehovas auseinandersetzt und mögliche Risikofaktoren beleuchtet. Schließlich wird eine kritische Stellungnahme der Zeugen Jehovas Deutschland sowie ein persönliches Fazit einbezogen.
Schlüsselwörter
Psychische Gesundheit, Religiosität, Wohlbefinden, Angst, Depression, extreme religiöse Gruppen, Zeugen Jehovas, kognitive Dissonanz, soziale Vergleichsprozesse, Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, Gesundheitsforschung, Religionspsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Bedeutung der Religiosität für die Gesundheit
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Religiosität, beleuchtet verschiedene Facetten dieser Beziehung und analysiert die Auswirkungen von Religiosität auf das Wohlbefinden – sowohl positive als auch negative Aspekte.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss von Religiosität auf die psychische Gesundheit (positive und negative Korrelationen), die Rolle von Religiosität bei Angst und Depression, die Auswirkungen extremer religiöser Gruppen auf die psychische Gesundheit, eine Fallstudie zu den Zeugen Jehovas und deren psychischer Gesundheit sowie die Bedeutung von Selbstwertgefühl und Selbstkonzept im Kontext von Religiosität und psychischer Gesundheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel I befasst sich mit der Bedeutung der Religiosität für die Gesundheit im Allgemeinen. Kapitel II analysiert die Mitgliedschaft in extremen religiösen Gruppen und deren Auswirkungen. Kapitel III konzentriert sich auf die Zeugen Jehovas und deren psychische Gesundheit unter sozialpsychologischen Aspekten.
Welche konkreten Aspekte der Religiosität werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Religiosität auf verschiedene psychische Zustände wie Angst und Depression. Sie analysiert auch die Rolle von Religiosität bei der Entstehung von Wahnvorstellungen und betrachtet die Auswirkungen sowohl moderater als auch extremer Formen von Religiosität.
Wie wird der Einfluss extremer religiöser Gruppen betrachtet?
Der Abschnitt zu extremen religiösen Gruppen analysiert Mechanismen wie Anwerbung, Abhängigkeitserzeugung und Indoktrination, um die Beeinträchtigung des individuellen Wohlbefindens zu verstehen. Die Rolle der Führungsstruktur und Methoden der Manipulation werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird die Fallstudie zu den Zeugen Jehovas durchgeführt?
Die Fallstudie zu den Zeugen Jehovas betrachtet die psychische Gesundheit dieser Gruppe unter sozialpsychologischen Aspekten, indem Konzepte wie kognitive Dissonanz, psychologische Reaktanz und soziale Vergleichsprozesse untersucht werden. Sie bezieht sich auf eine Studie von Jerry Bergman und berücksichtigt die Stellungnahme der Zeugen Jehovas Deutschland.
Welche sozialpsychologischen Konzepte werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene sozialpsychologische Konzepte, um den Zusammenhang zwischen Religiosität und psychischer Gesundheit zu analysieren, darunter kognitive Dissonanz, psychologische Reaktanz, soziale Vergleichsprozesse, Selbstwerterhaltung und Selbstwerterhöhung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt die Komplexität des Zusammenhangs zwischen Religiosität und psychischer Gesundheit auf. Sie verdeutlicht sowohl positive als auch negative Korrelationen und hebt die Schwierigkeiten hervor, kausale Zusammenhänge zu definieren, da intervenierende Variablen eine Rolle spielen. Die Fallstudie zu den Zeugen Jehovas liefert spezifische Einblicke in die psychische Gesundheit innerhalb einer bestimmten religiösen Gruppe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Psychische Gesundheit, Religiosität, Wohlbefinden, Angst, Depression, extreme religiöse Gruppen, Zeugen Jehovas, kognitive Dissonanz, soziale Vergleichsprozesse, Selbstwertgefühl, Selbstkonzept, Gesundheitsforschung, Religionspsychologie.
- Arbeit zitieren
- Alfred Seif (Autor:in), 2008, Psychische Gesundheit und Religiosität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93320