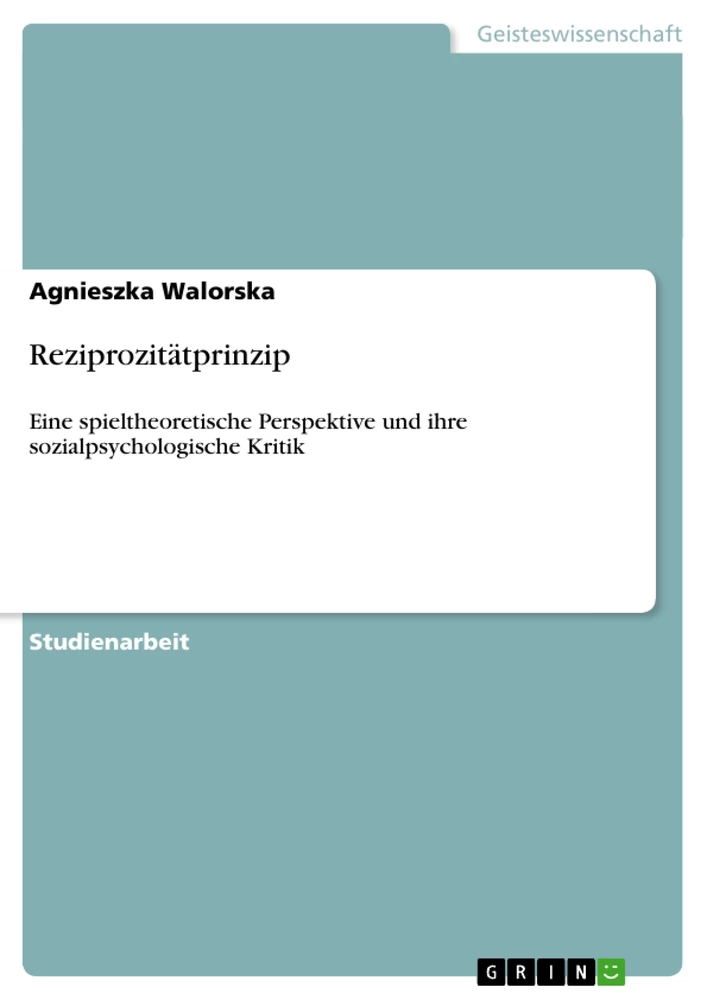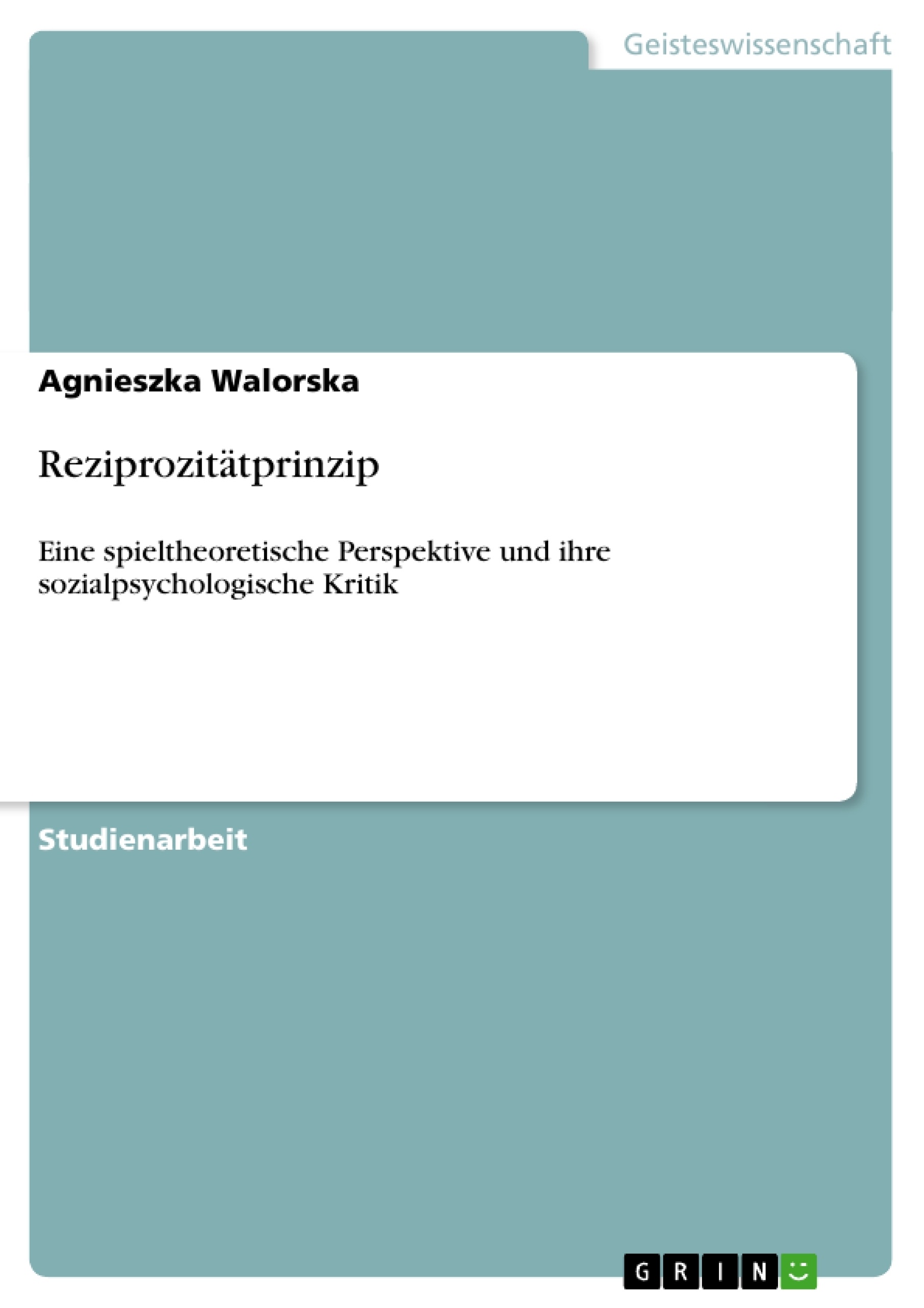Diese Arbeit beschäftigt sich mit einen der wichtigsten Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens, nämlich mit dem Reziprozitätprinzip. Dieses Prinzip fasziniert zahlreiche Wissenschaftler aus verschiedensten Bereichen – Soziologie, Anthropologie, Psychologie, aber auchWirtschaftswissenschaften, Mathematik, Biologie... Abhängig von der Disziplin ist die auch verschieden definierbar. Das Vorhaben dieser Arbeit ist zwei Perspektiven der Reziprozität, nämlich die spieltheoretische und die sozialpsychologische, zu Analysieren und sie miteinander zu konfrontieren. Warum gerade die beiden? Weil sich die beiden relativ jungen (beide sind erst in dem zweiten Viertel des zwanzigsten Jahrhundert entstanden) Disziplinen mit der Analyse menschlicher Entscheidungen beschäftigen und dabei von den ziemlich unterschiedlichen Menschenbilder ausgehen. Während wir in der Spieltheorie mit dem völlig rational handelnden, Nutzen maximierenden homo oeconomicus zu tun haben, ist er in der Sozialpsychologie animal sociale, nicht mehr so rational, empfänglich für Manipulation und Einfluss. Es ist also zu prüfen, ob sich dieser Verhaltensmuster auch auf den Umgang mit der Reziprozität übertragen lässt und welche sind dessen Konsequenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reziprozität in der Spieltheorie
- Einführung
- Der Inhalt der Spieltheorie
- Allgemeines zur Reziprozität in der Spieltheorie
- Das reinste Beispiel der Reziprozität in der Spieltheorie - TIT FOR TAT
- Das Programm
- Das Auszahlungsmatrix
- Wann ist die Reziprozität unmöglich?
- Einfache Zweipersonen-Nullsummenspiele
- Einfache Diktatorspiele
- Verschiedene Arten der Reziprozität in der Spieltheorie
- Negative vs. positive Reziprozität
- Direkte vs. indirekte Reziprozität
- Informationenbasierte Reziprozität vs. vermutungsbasierte Reziprozität
- Wann ist die Reziprozität unerwünscht?
- Reziprozität in der Sozialpsychologie
- Einführung
- Reziprozität in der Sozialpsychologie
- Manipulation dank der Reziprozitätprinzip und Abwehrstrategie
- Erst ein Wohltäter dann Bettler
- „Tür-ins-Gesicht-Taktik“
- „Das-ist-noch-nicht-alles“
- Abwehr
- Reziprozität in der Spieltheorie vs. Reziprozität in der Sozialpsychologie
- Annahme der Rationalität vs. Annahme der Einflussanfälligkeit
- 1 zu 1 vs. 1 zu ∞
- Axiologische Neutralität vs. moralische Wertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Reziprozitätprinzip aus spieltheoretischer und sozialpsychologischer Perspektive und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Ansätze auf. Dabei wird untersucht, wie sich die unterschiedlichen Menschenbilder (homo oeconomicus und animal sociale) auf die Analyse des Reziprozitätprinzips auswirken.
- Die Definition und Bedeutung des Reziprozitätprinzips
- Die spieltheoretische Analyse der Reziprozität, insbesondere im Kontext des wiederholten Gefangenendilemmas
- Die sozialpsychologische Perspektive auf die Reziprozität, einschließlich manipulativer Strategien und Abwehrmechanismen
- Der Vergleich der spieltheoretischen und sozialpsychologischen Ansätze in Bezug auf Rationalität, Interaktionsformen und moralische Bewertung
- Die Auswirkungen der unterschiedlichen Perspektiven auf das Verständnis des Reziprozitätprinzips im menschlichen Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Reziprozitätprinzip als zentrales Element des menschlichen Zusammenlebens vor und definiert es. Es werden die spieltheoretische und sozialpsychologische Perspektive auf die Reziprozität als zwei wichtige und unterschiedliche Ansätze vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert und miteinander verglichen werden.
- Reziprozität in der Spieltheorie: Dieses Kapitel führt zunächst in die Spieltheorie ein und erklärt den Ansatz der Reziprozität im Kontext des wiederholten Gefangenendilemmas. Besonders die „TIT FOR TAT“ Strategie wird als ein Standardbeispiel für die Reziprozität in der Spieltheorie dargestellt und mit Hilfe eines Programms und einer Auszahlungsmatrix veranschaulicht.
- Reziprozität in der Sozialpsychologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der sozialpsychologischen Perspektive auf die Reziprozität. Es werden verschiedene manipulativen Strategien vorgestellt, die auf dem Reziprozitätprinzip basieren und als Abwehrmechanismen betrachtet werden.
- Reziprozität in der Spieltheorie vs. Reziprozität in der Sozialpsychologie: Dieses Kapitel vergleicht die spieltheoretische und sozialpsychologische Sichtweise auf die Reziprozität. Es werden die Unterschiede in Bezug auf Rationalität, Interaktionsformen und moralische Bewertung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Reziprozitätprinzip, einem fundamentalen Prinzip des menschlichen Zusammenlebens. Die Arbeit betrachtet dieses Prinzip aus der Perspektive der Spieltheorie und der Sozialpsychologie, wobei die unterschiedlichen Menschenbilder (homo oeconomicus und animal sociale) eine zentrale Rolle spielen. Schlüsselbegriffe sind daher: Reziprozität, Spieltheorie, Sozialpsychologie, Gefangenendilemma, TIT FOR TAT, Manipulation, Abwehrmechanismen, Rationalität, Einflussanfälligkeit, axiologische Neutralität, moralische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Reziprozitätsprinzip?
Es ist das Prinzip der Gegenseitigkeit („Wie du mir, so ich dir“), das eine fundamentale Rolle im menschlichen Zusammenleben und in der Entscheidungsfindung spielt.
Was ist die „TIT FOR TAT“-Strategie in der Spieltheorie?
Es ist eine Strategie im Gefangenendilemma, bei der ein Spieler im ersten Schritt kooperiert und danach immer genau das tut, was der Gegenspieler im vorherigen Zug getan hat.
Wie unterscheidet sich das Menschenbild der Spieltheorie von der Sozialpsychologie?
Die Spieltheorie geht vom rationalen „homo oeconomicus“ aus. Die Sozialpsychologie betrachtet den Menschen als „animal sociale“, der oft irrational handelt und für Manipulationen anfällig ist.
Welche manipulativen Techniken nutzen das Reziprozitätsprinzip?
Beispiele sind die „Tür-ins-Gesicht-Taktik“ (erst eine große, dann eine kleine Bitte) oder die „Das-ist-noch-nicht-alles“-Methode, um durch kleine Vorleistungen eine Gegenleistung zu erzwingen.
Wann ist Reziprozität in der Spieltheorie unmöglich?
In einfachen Zweipersonen-Nullsummenspielen oder Diktatorspielen kann Reziprozität oft nicht entstehen, da die strukturellen Voraussetzungen für wechselseitiges Handeln fehlen.
- Arbeit zitieren
- Agnieszka Walorska (Autor:in), 2007, Reziprozitätprinzip, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92943