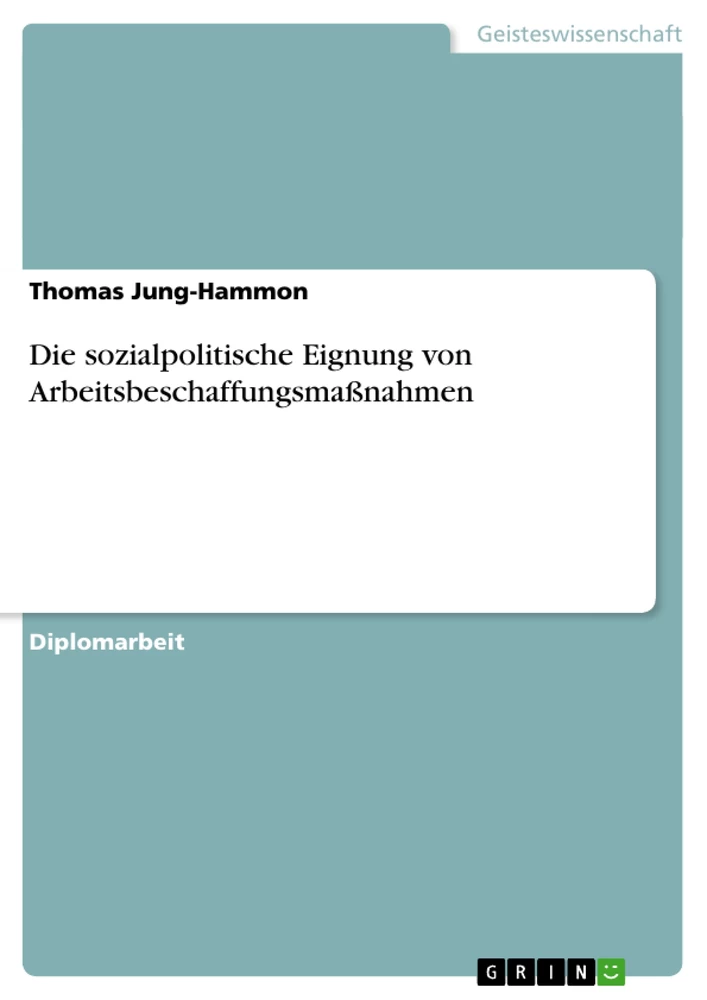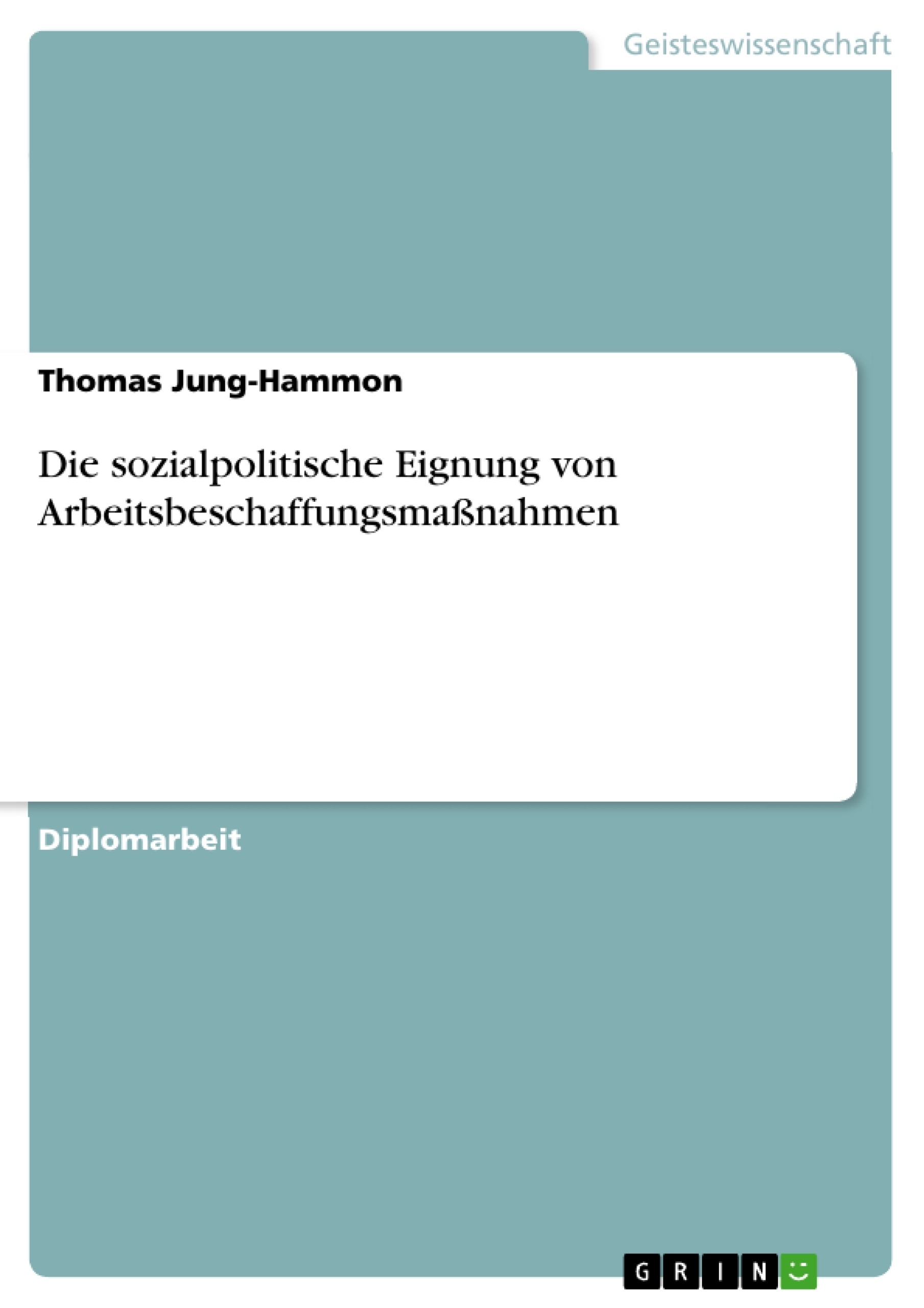Die Diskussion um die Mittel zur Bekämpfung der “Arbeits-losigkeit“ wird seit dem Aufkommem als Massenerscheinung geführt. Ein in der jüngeren Vergangenheit (70er Jahre) und vielleicht heute noch mit vielen Erwartungen befrachtetes und zugleich umstrittenes Instrument aus der Palette arbeitsmarktpolitischer Bekämpfungsmöglichkeiten stellen die sog. Arbeitsbeschaffungs-maßnahmen (ABM) dar. In diesem Kontext wurde auch die Zweck-mäßigkeit eines "zweiten Arbeitsmarktes" diskutiert, zu dem die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gerechnet werden.
Die Grundidee ist, daß durch eine zeitlich befristete großteils öffentliche Förderung von Arbeiten, die im öffentlichen Interesse liegen, ohne Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aber nicht erledigt würden, Arbeitslosen eine befristete Unterbrechung ihrer Arbeitslosigkeit, mit allen daraus folgenden Konsequenzen, u.a. verbesserte Chancen für den Übergang in dauerhafte Beschäftigung, ermöglicht werden soll.
Teil A 1 gibt zunächst einen knappen historischen Abriß der Arbeitsbeschaffungspolitik in Deutschland; daran anschließend befaßt sich Teil A 2 eingehender mit dem Begriff “Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ und stellt das Instrument in seiner heutigen Ausgestaltung vor.
Teil B widmet sich der rein quantitativen Dimension dieses arbeitsmarktpolitischen Instruments. Dabei sollen die Komponenten, die zu einer Erhöhung oder zumindest Erhaltung des Beschäftigungsstandes und damit zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes beitragen den theoretisch denkbaren konterkarierenden Wirkungskomponenten gegenübergestellt werden.
Teil C diskutiert die Vor- und Nachteile, die sich für die Person selbst ergeben können, wenn sie in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beschäftigt ist. Dabei beschränkt sich die Diskussion auf die Bereiche psychosoziale Auswirkungen, materielle Lage und qualifikatorische Effekte.
Teil D schließlich wirft einen Blick auf die Situation nach der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und stellt die Frage, ob sie ein geeignetes Mittel ist, die Wiedereingliederung in den regulären Arbeitsmarkt zu fördern; da mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bevorzugt schwervermittelbare Arbeitslose gefördert werden sollen, muss auch geklärt werden, inwiefern dieses Instrument überhaupt geeignet ist, die Lebenslage bestimmter als Problemgruppen und/oder als "sozial schwach" definierter Personen zu verbessern.
Die Arbeit ergänzt die nach 1989 veröffentlichten Beiträge zu "ABM" und zur Evaluation von aktiver Arbeitsmarktpolitik des IAB in Nürnberg.
Inhaltsverzeichnis
- Teil A: Historische Entwicklung der Arbeitsbeschaffungspolitik und allgemeine Darstellung des Instruments "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" heute
- 1. Historischer Abriß der Arbeitsbeschaffungspolitik
- 1.1 Vorindustrielle Zeitalter
- 1.2 Frühindustrialisierung und Pauperismus
- 1.3 Die Notstandsarbeiten der Kommunen bis zum Ersten Weltkrieg
- 1.4 Die Notstandsarbeiten in der Weimarer Republik bis zum Inkrafttreten des AVAVG (1918-1927)
- 1.5 Die Politik der "Wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge" bis 1957
- 1.5.1 Die Entwicklung der Notstandsarbeiten
- 1.5.2 Arbeitsbeschaffungsprogramme der späten Weimarer Republik (ca. 1929-1933)
- 1.6 Die Arbeitsbeschaffungspolitik Hitlers bis 1939
- 1.7 Die Politik der "Wertschaffenden Arbeitslosenhilfe" nach der Großen Novelle des AVAVG 1957
- 1.8 Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969
- 1.8.1 Die "Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung"
- 1.8.2 Sonderprogramme des Bundes
- 2. Darstellung des arbeitsmarktpolitischen Instruments "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" heute
- 2.1 Begriff, Abgrenzung und sozialorganisatorische Einordnung von "Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen"
- 2.1.1 Begriff und Abgrenzung von "Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" zu ähnlichen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten
- 2.1.2 Sozialorganisatorische Darstellung und Einordnung des Instruments "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme"
- 2.2 Zieldimensionen und Zielgruppen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- 2.3 Darstellung des Instruments Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
- 2.3.1 Voraussetzungen des Einsatzes von AB-Maßnahmen
- 2.3.1.1 Das Erfordernis des "öffentlichen Interesses"
- 2.3.1.2 "Zusätzlichkeit" der zu fördernden Maßnahmen
- 2.3.1.3 Erfordernis der "arbeitsmarktpolitischen Zweckmäßigkeit"
- 2.3.2 Art und Umfang der Förderung von AB-Maßnahmen
- 2.3.3 Mögliche Träger von AB-Maßnahmen
- 2.3.4 Die Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- Teil B: Quantitative Arbeitsmarktwirkungen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- Teil C: Selbstfinanzierungsquoten für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- Teil D: Zur Mitteladäquanz von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für das Ziel "dauerhafte und qualifikationsgerechte Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer" (§1 I Nr. 2 ABM-Anordnung), insbesondere für die Zielgruppen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sozialpolitische Eignung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ziel ist es, die Arbeitsmarktwirkungen, die psycho-sozialen Auswirkungen und die Mitteladäquanz dieser Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer zu analysieren.
- Historische Entwicklung der Arbeitsbeschaffungspolitik
- Quantitative Arbeitsmarktwirkungen (Beschäftigungseffekte, Kompensationseffekte)
- Psycho-soziale Auswirkungen auf die Betroffenen
- Mitteladäquanz der Maßnahmen für eine dauerhafte Wiedereingliederung
- Finanzierung und Träger von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil A: Historische Entwicklung der Arbeitsbeschaffungspolitik und allgemeine Darstellung des Instruments "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" heute: Dieser Teil bietet einen umfassenden historischen Überblick über die Arbeitsbeschaffungspolitik in Deutschland, beginnend mit dem vorindustriellen Zeitalter und reichend bis zum Arbeitsförderungsgesetz von 1969. Er beleuchtet verschiedene Epochen und deren spezifische Ansätze zur Arbeitsbeschaffung, von den Notstandsarbeiten über die Weimarer Republik bis hin zum Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit. Der Teil schließt mit einer detaillierten Darstellung des Instruments "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" in seiner heutigen Form, inklusive Begriffsbestimmung, Zielgruppen, Förderkriterien und Finanzierung. Die historische Perspektive liefert wichtige Kontextualisierung für die Analyse der gegenwärtigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Teil B: Quantitative Arbeitsmarktwirkungen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Dieser Abschnitt analysiert die quantitativen Auswirkungen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf den Arbeitsmarkt. Die Analyse umfasst die Untersuchung direkter und indirekter Beschäftigungseffekte, einschließlich Einkommensmultiplikatoren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kompensation von Arbeitsplatzschaffung durch mögliche Verdrängungseffekte ("Crowding-Out"). Durch Modellrechnungen und einen fiskalischen Kostenvergleich werden die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Vergleich zu den Kosten der Arbeitslosigkeit bewertet.
Teil C: Selbstfinanzierungsquoten für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Dieser Teil behandelt die Selbstfinanzierungsquoten von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Er beschreibt die finanziellen Aspekte und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. (Further details would be added here based on the original text's content for this section.)
Teil D: Zur Mitteladäquanz von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für das Ziel "dauerhafte und qualifikationsgerechte Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer" (§1 I Nr. 2 ABM-Anordnung), insbesondere für die Zielgruppen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Dieser Teil untersucht, inwieweit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geeignet sind, arbeitslose Arbeitnehmer dauerhaft und qualifikationsgerecht wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Er analysiert sowohl zielkonforme als auch zielinkonforme Faktoren, die den Erfolg der Maßnahmen beeinflussen. Die Analyse umfasst die Erreichbarkeit der Zielgruppen, die Verringerung des Risikos längerfristiger Arbeitslosigkeit, die Übernahmechancen bei den Trägern der Maßnahmen und die Wiedereingliederungschancen im externen Arbeitsmarkt. Dabei werden auch die Auswirkungen auf die berufliche Qualifikation der Betroffenen berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosigkeit, Wiedereingliederung, Beschäftigungseffekte, psycho-soziale Auswirkungen, Mitteladäquanz, Finanzierung, Zielgruppen, qualifikationsgerechte Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in Deutschland - Eine sozialpolitische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die sozialpolitische Eignung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) in Deutschland. Der Fokus liegt auf den Arbeitsmarktwirkungen, den psycho-sozialen Auswirkungen und der Mitteladäquanz dieser Maßnahmen hinsichtlich einer dauerhaften Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Arbeitsbeschaffungspolitik in Deutschland, von vorindustriellen Zeiten bis zum Arbeitsförderungsgesetz von 1969. Sie untersucht die quantitativen Arbeitsmarktwirkungen von ABM (Beschäftigungseffekte, Verdrängungseffekte), die psycho-sozialen Auswirkungen auf die Betroffenen, die Mitteladäquanz der Maßnahmen für eine dauerhafte Wiedereingliederung, sowie die Finanzierung und die Träger von ABM.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Teil A beschreibt die historische Entwicklung der Arbeitsbeschaffungspolitik und die heutige Form von ABM. Teil B analysiert die quantitativen Arbeitsmarktwirkungen. Teil C befasst sich mit den Selbstfinanzierungsquoten von ABM. Teil D untersucht die Mitteladäquanz von ABM für eine dauerhafte und qualifikationsgerechte Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Teil A bietet einen umfassenden historischen Überblick über die Arbeitsbeschaffungspolitik, von vorindustriellen Zeiten über die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus bis zur Nachkriegszeit. Verschiedene Epochen und ihre spezifischen Ansätze zur Arbeitsbeschaffung werden beleuchtet, von Notstandsarbeiten bis zu den Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz von 1969.
Wie werden die quantitativen Arbeitsmarktwirkungen analysiert?
Teil B analysiert die quantitativen Auswirkungen von ABM auf den Arbeitsmarkt, inklusive direkter und indirekter Beschäftigungseffekte und Einkommensmultiplikatoren. Die Kompensation von Arbeitsplatzschaffung durch mögliche Verdrängungseffekte ("Crowding-Out") wird ebenfalls untersucht. Modellrechnungen und ein fiskalischer Kostenvergleich werden verwendet, um Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu bewerten.
Was ist der Fokus von Teil C?
Teil C behandelt die Selbstfinanzierungsquoten von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und beschreibt die finanziellen Aspekte und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. (Genauere Details müssten dem Originaltext entnommen werden.)
Worauf konzentriert sich Teil D?
Teil D untersucht die Eignung von ABM zur dauerhaften und qualifikationsgerechten Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer. Es werden zielkonforme und zielinkonforme Faktoren analysiert, die den Erfolg beeinflussen, einschließlich Erreichbarkeit der Zielgruppen, Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit, Übernahmechancen und Wiedereingliederungschancen im externen Arbeitsmarkt sowie Auswirkungen auf die berufliche Qualifikation.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosigkeit, Wiedereingliederung, Beschäftigungseffekte, psycho-soziale Auswirkungen, Mitteladäquanz, Finanzierung, Zielgruppen, qualifikationsgerechte Integration.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sozialpolitische Eignung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und analysiert deren Arbeitsmarktwirkungen, psycho-sozialen Auswirkungen und die Mitteladäquanz im Hinblick auf eine dauerhafte Wiedereingliederung arbeitsloser Arbeitnehmer.
- Quote paper
- Thomas Jung-Hammon (Author), 1989, Die sozialpolitische Eignung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92590