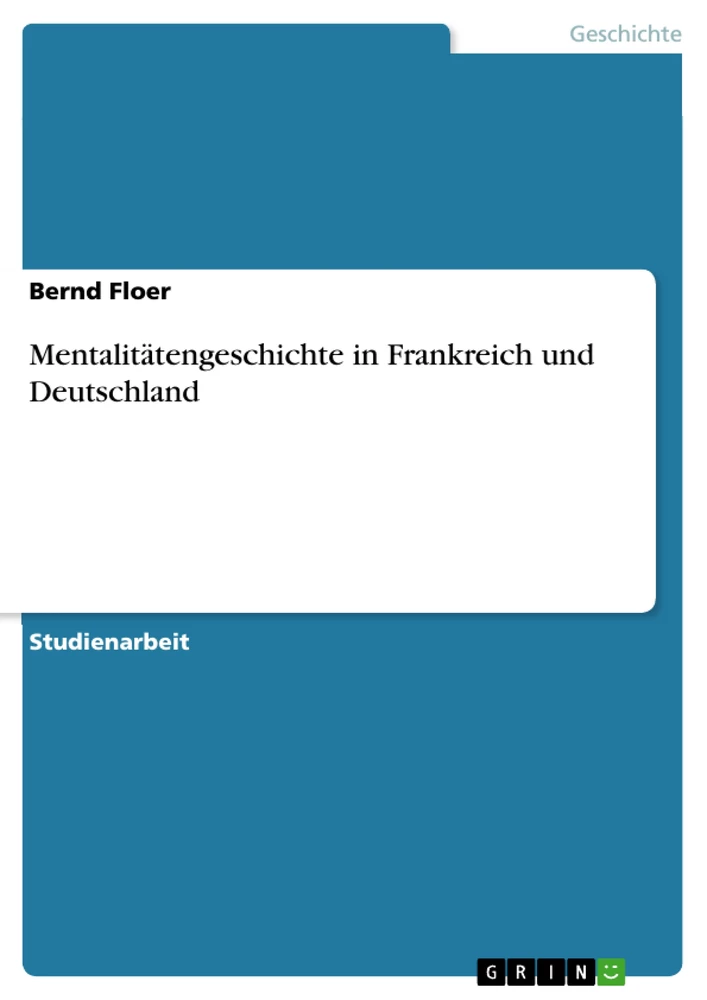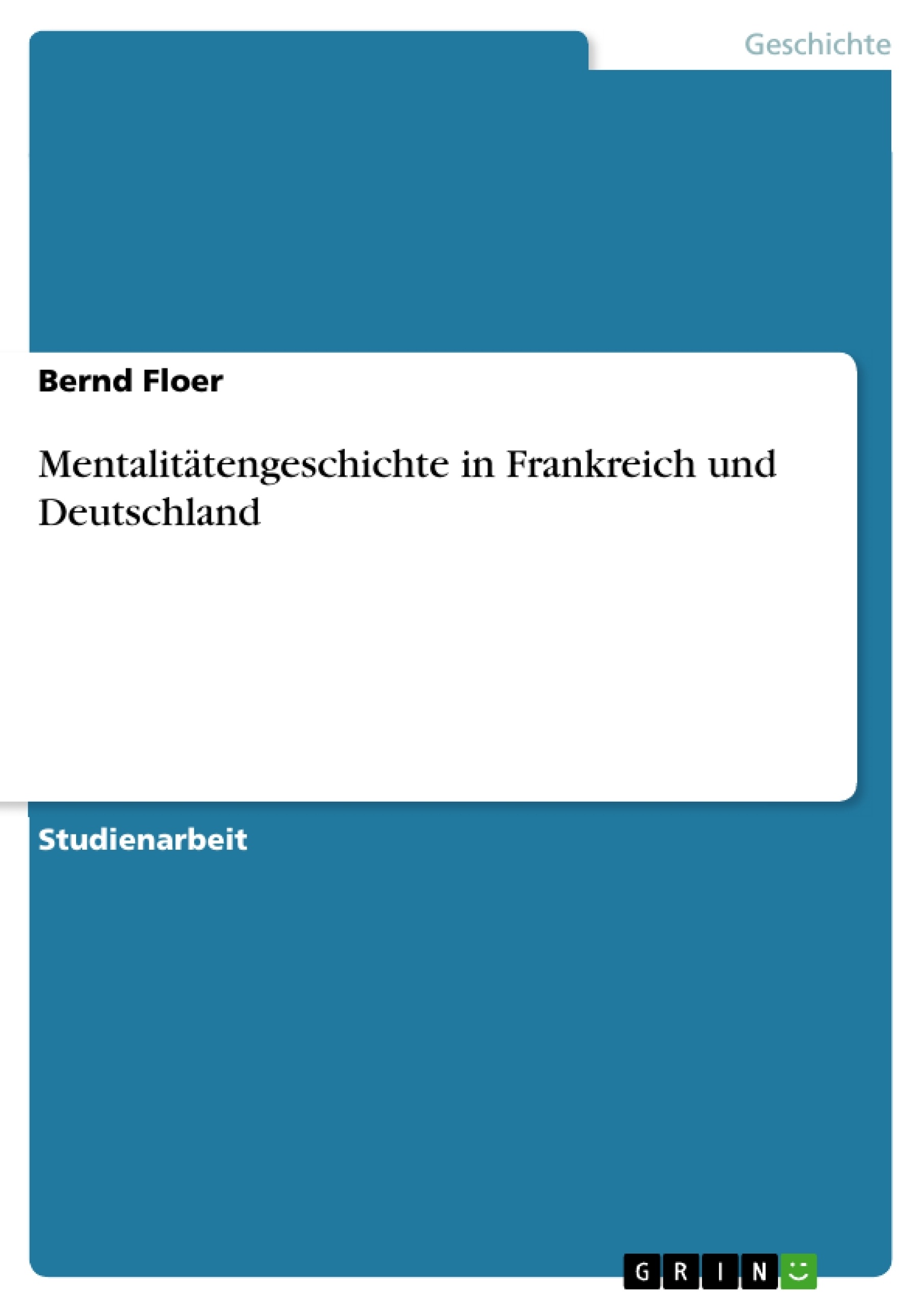[...]
In jenen Bereich der "Orchideenwissenschaften" ist nun auch die "Mentalitäten-Geschichte" einzuordnen. Aus der Schule der bedeutenden französischen historischen Zeitschrift "Anna- les" hervorgegangen, wagt die Mentalitäten-Geschichte als erste und vielleicht einzige Teildisziplin in der Geschichtswissenschaft den Schritt in die Interdisziplinarität. Verstanden als die "sozialpsychologische Dimension der Sozialgeschichte" versucht die Mentalitäten- Geschichte seit den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, diejenigen Einflussgrößen auf die historische Entwicklung offen zu legen, welche nicht etwa der bewussten Reflexion der handelnden, Geschichte machenden und erlebenden Personen entspringen, sondern viel- mehr jenem geheimnisvollen, nur halbbewussten "Kollektivwissen" - in der Alltagssprache zumeist als "Mentalität" bezeichnet - entstammen.
Die besondere Bedeutung der Mentalitäten-Geschichte liegt hierbei sowohl in ihrem doch recht außergewöhnlichen, fachübergreifenden und psychologische, soziologische und anthro- pologische Elemente integrierenden Anspruch, als auch in ihrer bis heute nicht durch eine gemeinsame Theorie versöhnten Heterogenität ihrer Interpreten bezüglich der Forschungs- weise, Schwerpunktsetzung und auch bezüglich des Verständnisses des bloßen Begriffs der "Mentalität" als ihrem Forschungsgebiet.
In dieser Seminararbeit soll nun zunächst versucht werden, am Beispiel einiger Hauptinter- preten der Mentalitäten-Geschichte in Frankreich und Deutschland die Entwicklung und die Vorgehensweise jener jungen Forschungsdisziplin deutlich zu machen. Anhand zweier kon- kreter Beispiele mentalitäten-geschichtlicher "Exegese" soll das Verständnis hierfür anschlie- ßend noch vertieft werden. Eine kurze Betrachtung der jeweils in Frankreich und Deutschland schwerpunktmäßig durch die Mentalitäten-Geschichte erforschten Zeiträume und Histori-schen Orte sowie eine Diskussion von Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen der Men- talitäten-Geschichte dieseits und jenseits des Rheins bildet sodann den Abschluß dieser Ar- beit.
Ziel dieser Arbeit soll es zum einen sein, einen gerafften und sicherlich auch unvollständigen Überblick über Herkommen und Forschungsweise dieser jungen Disziplin zu geben, zum an- deren aber auch, die enormen Chancen und Zukunftsmöglichkeiten aufzuzeigen, welche sich in jener neuen Herangehensweise an die Menschheitsgeschichte eröffnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1: Begriffsbestimmung
- II.1.1. Etymologische Herkunft des Begriffs "Mentalität"
- II.1.2. Karriere eines Begriffs
- II.1.3. Heutiger Bedeutungsgehalt
- II.2. Ursprung der Disziplin
- II.2.1. Die Anfänge in Frankreich
- II.2.1.1. Lucien Febvre
- II.2.1.2. Marc Bloch
- II.2.2. Mentalitäten-Historiker im heutigen Frankreich
- II.2.2.1. Georges Duby
- II.2.2.2. Michel Vovelle
- II.2.3. Die Anfänge in Deutschland
- II.2.3.1. Ulrich Raulff
- II.2.3.2. Rolf Sprandel
- II.2.4. Zusammenfassung
- II.2.1. Die Anfänge in Frankreich
- II.3. Gegenstand und Vorgehensweise der Mentalitäten-Geschichte an zwei Beispielen erläutert
- II.3.1. Was erforscht, was erfragt die Mentalitäten-Geschichte?
- II.3.2. Das Hildebrandslied mentalitätenhistorisch gedeutet
- II.3.3. Der "Hexenhammer" als Schlüssel zur Mentalität der frühen Neuzeit?
- II.3.4. Ergebnis und Zusammenfassung
- II.4. Forschungsschwerpunkte und Fragestellungen in Frankreich und Deutschland im Vergleich
- II.4.1. Frankreich und "seine Revolution"
- II.4.2: Deutschland und sein "Hineinwachsen in die Moderne"
- II.4.3. Ergebnis und Zusammenfassung
- II.1: Begriffsbestimmung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Überblick über die Mentalitäten-Geschichte, ihre Entwicklung in Frankreich und Deutschland und ihre methodischen Ansätze. Das Ziel ist es, die Herangehensweise dieser Disziplin zu erläutern und ihr Potential für das Verständnis der Menschheitsgeschichte aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung und Entwicklung des Konzepts "Mentalität"
- Ursprünge und Entwicklung der Mentalitäten-Geschichte in Frankreich und Deutschland
- Methodische Ansätze und Forschungsfragen der Mentalitäten-Geschichte
- Vergleich der Forschungsschwerpunkte in Frankreich und Deutschland
- Beispiele für mentalitätsgeschichtliche Analysen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausdifferenzierung der Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert und positioniert die Mentalitäten-Geschichte als interdisziplinäre Teildisziplin, die sich mit den unbewussten, kollektiven Einflussfaktoren auf die historische Entwicklung befasst. Sie hebt die Bedeutung der Mentalitäten-Geschichte aufgrund ihres fachübergreifenden Anspruchs und ihrer heterogenen Interpretationsansätze hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
II.1: Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Mentalität" aus etymologischer und historischer Perspektive. Es untersucht die Entwicklung des Begriffs durch verschiedene Sprachen und wissenschaftliche Diskurse, zeigt seine Bedeutungswandel auf und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs innerhalb der Mentalitäten-Geschichte selbst. Die Analyse der verschiedenen Definitionen von "Mentalität" unterstreicht die Komplexität und die Heterogenität des Forschungsfeldes.
II.2. Ursprung der Disziplin: Dieses Kapitel verfolgt die Entstehung der Mentalitäten-Geschichte, beginnend mit ihren Anfängen in Frankreich mit zentralen Figuren wie Lucien Febvre und Marc Bloch und ihrer Weiterentwicklung durch nachfolgende Historiker. Es vergleicht die Entwicklung in Frankreich mit der in Deutschland, indem es die Beiträge von wichtigen deutschen Vertretern wie Ulrich Raulff und Rolf Sprandel diskutiert und die spezifischen nationalen Schwerpunkte und Unterschiede herausstellt. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Entwicklungslinien und die nationale Divergenz zusammen.
II.3. Gegenstand und Vorgehensweise der Mentalitäten-Geschichte an zwei Beispielen erläutert: Dieses Kapitel erklärt den Gegenstand und die Methodik der Mentalitäten-Geschichte anhand konkreter Beispiele. Es untersucht, wie die Mentalitäten-Geschichte Fragen stellt und was sie erforscht. Die Analyse des Hildebrandslieds und des "Hexenhammers" verdeutlicht die Anwendung der Methodik und die Interpretation von Quellenmaterial im Kontext kollektiver Mentalitäten. Die Zusammenfassung der Ergebnisse betont die Interpretation verschiedener Quellen und die methodischen Herausforderungen.
II.4. Forschungsschwerpunkte und Fragestellungen in Frankreich und Deutschland im Vergleich: Das Kapitel vergleicht die Forschungsschwerpunkte der Mentalitäten-Geschichte in Frankreich und Deutschland. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die jeweilige nationale Geschichte, beispielsweise den Fokus Frankreichs auf die Revolution und Deutschlands auf den Prozess der Modernisierung. Der Vergleich zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Schwerpunktsetzung und der Fragestellung auf.
Schlüsselwörter
Mentalitäten-Geschichte, Frankreich, Deutschland, Lucien Febvre, Marc Bloch, Georges Duby, Michel Vovelle, Ulrich Raulff, Rolf Sprandel, kollektive Mentalität, Sozialgeschichte, Interdisziplinarität, methodische Ansätze, Forschungsschwerpunkte, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mentalitätsgeschichte in Frankreich und Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Mentalitätsgeschichte, ihre Entwicklung in Frankreich und Deutschland sowie ihre methodischen Ansätze. Sie behandelt die Begriffsbestimmung von "Mentalität", die Ursprünge der Disziplin, ihre Forschungsmethoden und -schwerpunkte in beiden Ländern und vergleicht diese miteinander. Die Arbeit enthält eine Einleitung, einen Hauptteil mit detaillierten Kapiteln und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Schlüsselbegriffe und eine Kapitelzusammenfassung erleichtern das Verständnis.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Die Definition und historische Entwicklung des Begriffs "Mentalität", die Ursprünge der Mentalitätsgeschichte in Frankreich (mit Fokus auf Lucien Febvre und Marc Bloch) und Deutschland (mit Fokus auf Ulrich Raulff und Rolf Sprandel), die methodischen Ansätze und Forschungsfragen der Mentalitätsgeschichte, ein Vergleich der Forschungsschwerpunkte in Frankreich und Deutschland (z.B. Frankreichs Fokus auf die Revolution, Deutschlands Fokus auf die Modernisierung), und die Anwendung der Mentalitätsgeschichte anhand von Beispielen wie dem Hildebrandslied und dem "Hexenhammer".
Welche Autoren werden in der Seminararbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt zentrale Figuren der Mentalitätsgeschichte, darunter die französischen Historiker Lucien Febvre, Marc Bloch, Georges Duby und Michel Vovelle sowie die deutschen Historiker Ulrich Raulff und Rolf Sprandel. Diese Autoren werden im Kontext der Entwicklung und Ausgestaltung der Mentalitätsgeschichte in ihren jeweiligen Ländern vorgestellt.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt: Eine Einleitung, die den Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit beschreibt; ein Hauptteil, der die Begriffsbestimmung, die Ursprünge der Disziplin, die Methoden und Forschungsgegenstände sowie einen Vergleich der Forschungsschwerpunkte in Frankreich und Deutschland behandelt; und abschließende Kapitel mit einer Zusammenfassung und Schlüsselwörtern. Der Aufbau ist klar strukturiert und durch eine detaillierte Inhaltsübersicht nachvollziehbar.
Welche Methoden werden in der Mentalitätsgeschichte angewendet?
Die Seminararbeit erläutert die methodischen Ansätze der Mentalitätsgeschichte anhand konkreter Beispiele. Sie zeigt auf, wie Quellenmaterial (wie das Hildebrandslied und der "Hexenhammer") interpretiert und im Kontext kollektiver Mentalitäten analysiert werden. Die Arbeit betont die interdisziplinäre Natur der Mentalitätsgeschichte und die damit verbundenen methodischen Herausforderungen.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, einen umfassenden Überblick über die Mentalitätsgeschichte zu geben und ihr Potential für das Verständnis der Menschheitsgeschichte aufzuzeigen. Sie soll die Herangehensweise dieser Disziplin erläutern und die Entwicklung und die nationalen Unterschiede in Frankreich und Deutschland beleuchten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Mentalitätsgeschichte, Frankreich, Deutschland, Lucien Febvre, Marc Bloch, Georges Duby, Michel Vovelle, Ulrich Raulff, Rolf Sprandel, kollektive Mentalität, Sozialgeschichte, Interdisziplinarität, methodische Ansätze, Forschungsschwerpunkte, historische Entwicklung.
- Quote paper
- Diplom-Staatswissenschaftler (univ.) Bernd Floer (Author), 2002, Mentalitätengeschichte in Frankreich und Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/92416