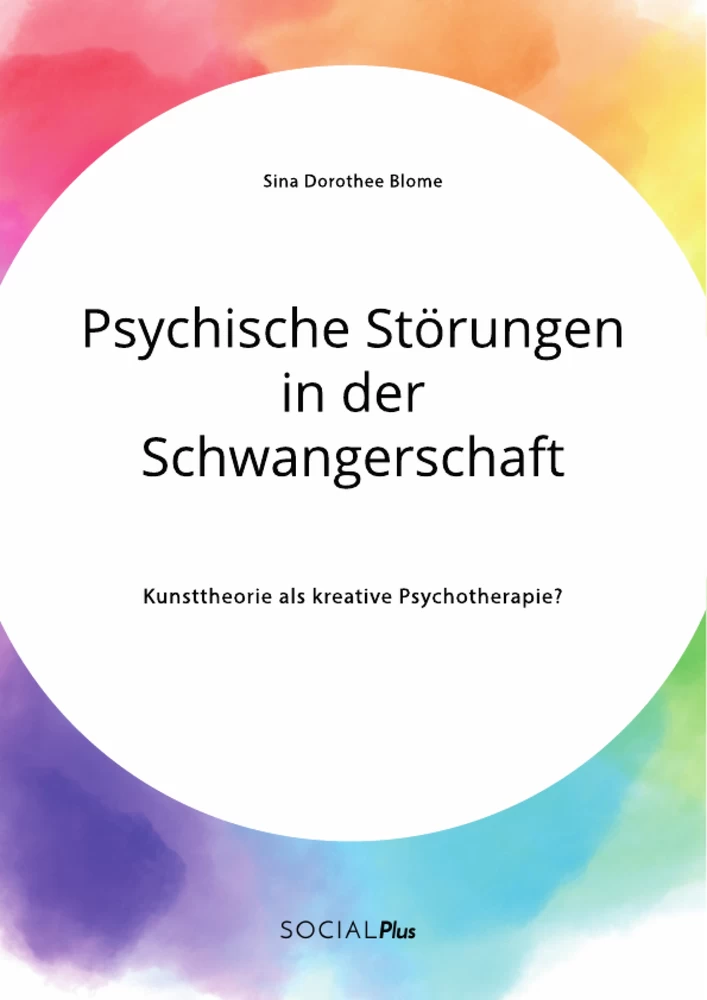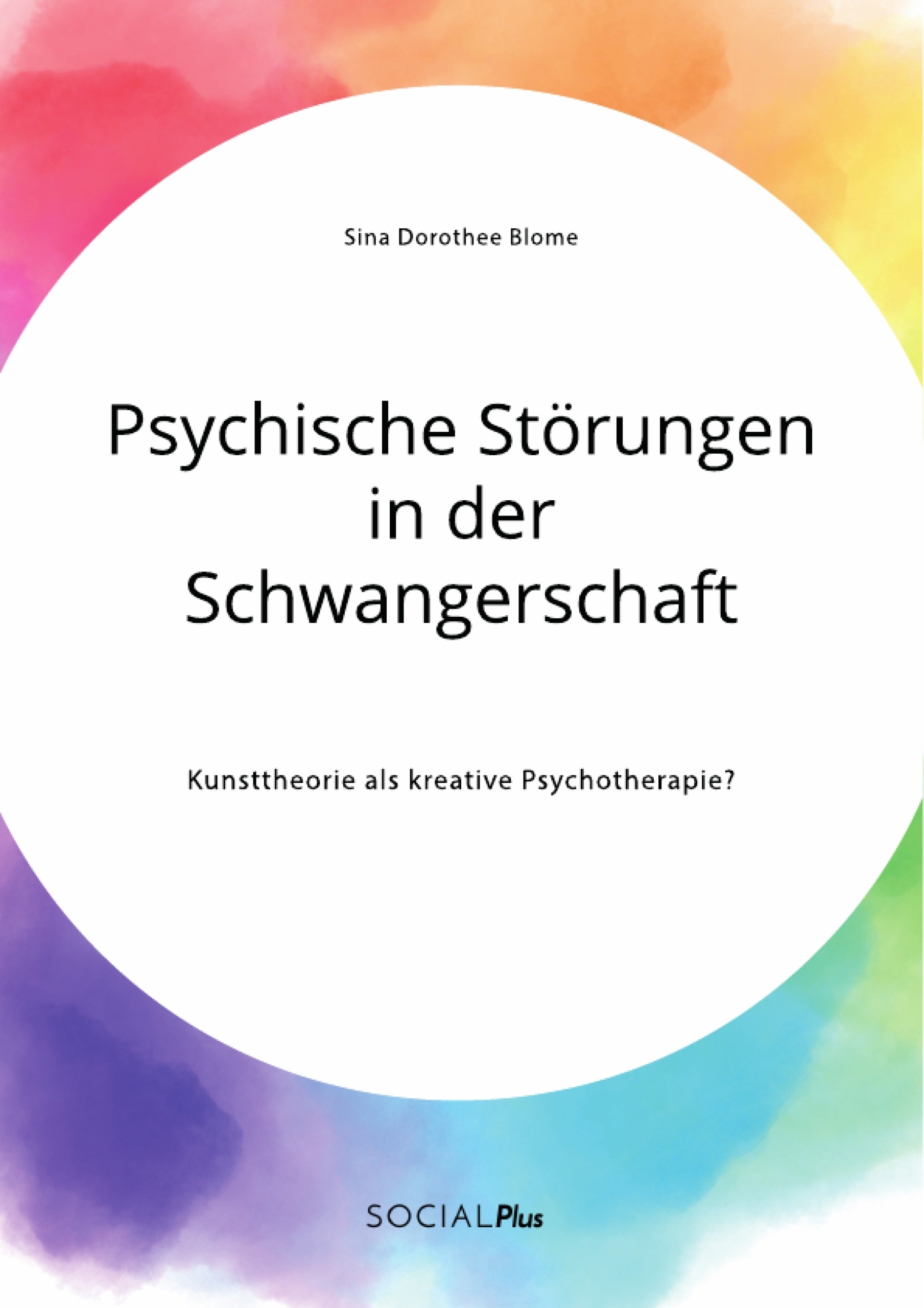Psychische Störungen sind in Deutschland ein aktuelles und viel diskutiertes Thema. Trotzdem sind die Forschungslage und die psychiatrische Versorgung immer noch unzureichend. Dies ist vor allem in der Schwangerschaft und Stillzeit eine besondere Herausforderung. Eine neue Behandlungsmethode ist die Kunsttherapie.
Welche Arten von psychischen Störungen können in der Schwangerschaft und Peripartalzeit auftreten und wo liegt deren Ursache? Welche Möglichkeiten der psychiatrischen Versorgung sind dann besonders sinnvoll? Und inwieweit kann die Kunsttherapie als Psychotherapie von Vorteil sein?
Die Autorin Sina Dorothee Blome klärt die wichtigsten Fragen zu psychischen Störungen in der Schwangerschaft und Peripartalzeit. Sie zeigt Behandlungsmöglichkeiten auf und vergleicht diese mit denen der klassischen Psychotherapie. Dabei geht Blome vor allem auf die Kunsttherapie ein, stellt Vor- und Nachteile dar und leitet Behandlungsempfehlungen ab.
Aus dem Inhalt:
- Depression;
- kognitive Verhaltenstherapie;
- Soziotherapie;
- Psychopharmakotherapie;
- Therapie-Resistenz
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hintergrund
- 2.1 Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit
- 2.2 Psychische Störungen
- 3 Methodisches Vorgehen
- 4 Psychische Störungen in der Peripartalzeit
- 4.1 Schwangerschaftsassoziierte (psychische) Störungen
- 4.2 Angst- und Zwangsstörungen
- 4.3 Depression
- 4.4 Schizophrenie
- 4.5 Abhängigkeitserkrankungen
- 4.6 Postpartale psychische Erkrankungen
- 5 Therapiemaßnahmen
- 5.1 Psychotherapie
- 5.2 Klient-zentrierte Kunsttherapie als kreative Psychotherapie
- 6 Diskussion
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht psychische Störungen während der Schwangerschaft und im Wochenbett. Das Ziel ist es, einen Überblick über die verschiedenen Arten von psychischen Erkrankungen in dieser sensiblen Lebensphase zu geben und mögliche Therapieansätze, insbesondere die klientenzentrierte Kunsttherapie, zu beleuchten.
- Psychische Störungen während der Schwangerschaft und im Wochenbett
- Verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen in der Perinatalzeit
- Möglichkeiten der Psychotherapie
- Klientenzentrierte Kunsttherapie als kreative Psychotherapie
- Diskussion der therapeutischen Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema psychischer Störungen während der Schwangerschaft und im Wochenbett ein. Sie skizziert die Relevanz der Thematik und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der frühzeitigen Erkennung und Behandlung psychischer Erkrankungen in dieser Phase des Lebens, um negative Auswirkungen auf Mutter und Kind zu minimieren.
2 Hintergrund: Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit sowie über verschiedene Arten psychischer Störungen. Es bildet die fachliche Basis für die folgende Analyse und Diskussion spezifischer psychischer Erkrankungen im Kontext der Perinatalzeit. Die Darstellung der physiologischen und psychosozialen Veränderungen während dieser Phase schafft ein Verständnis für die Vulnerabilität von Frauen für psychische Erkrankungen.
3 Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik, die für die Untersuchung und Analyse der Thematik verwendet wurde. Es erläutert die Vorgehensweise und die angewandten Methoden, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Arbeit zu gewährleisten. Die detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens erlaubt die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und deren Interpretation.
4 Psychische Störungen in der Peripartalzeit: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Beschreibung verschiedener psychischer Störungen, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett auftreten können, einschließlich Schwangerschaftsassoziierter Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen und postpartalen psychischen Erkrankungen. Für jede Störung werden Symptome, Diagnostik und mögliche Folgen dargestellt. Die Kapitel unterstreichen die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung dieser Erkrankungen, die stark von individuellen Faktoren abhängen.
5 Therapiemaßnahmen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Therapieansätzen für psychische Störungen in der Perinatalzeit. Es werden sowohl allgemeine psychotherapeutische Verfahren als auch die klientenzentrierte Kunsttherapie als spezifische Methode ausführlich diskutiert. Die Darstellung der verschiedenen Ansätze verdeutlicht die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung, angepasst an die Bedürfnisse der Patientin und die Art der psychischen Störung.
Schlüsselwörter
Psychische Störungen, Schwangerschaft, Wochenbett, Perinatalzeit, Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, Postpartale Depression, Psychotherapie, Kunsttherapie, klientenzentrierte Kunsttherapie, Therapieansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Psychische Störungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über psychische Störungen während der Schwangerschaft und im Wochenbett (Perinatalzeit). Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hintergrundteil mit Informationen zu Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und verschiedenen psychischen Erkrankungen, eine Beschreibung der angewandten Methodik, eine detaillierte Darstellung verschiedener psychischer Störungen in der Perinatalzeit (z.B. Depression, Angststörungen, Schizophrenie), eine Diskussion verschiedener Therapieansätze (inklusive klientenzentrierter Kunsttherapie) und abschließend ein Fazit.
Welche psychischen Störungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von psychischen Störungen, die während der Schwangerschaft und im Wochenbett auftreten können. Dies umfasst Schwangerschaftsassoziierte Störungen, Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen und postpartale psychische Erkrankungen. Für jede Störung werden Symptome, Diagnostik und mögliche Folgen beschrieben.
Welche Therapieansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Therapieansätze für psychische Erkrankungen in der Perinatalzeit. Ein Schwerpunkt liegt auf der klientenzentrierten Kunsttherapie als kreative Psychotherapie, zusätzlich werden aber auch allgemeine psychotherapeutische Verfahren behandelt. Die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung, angepasst an die Bedürfnisse der Patientin und die Art der Störung, wird hervorgehoben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen in der sensiblen Lebensphase der Schwangerschaft und des Wochenbetts zu geben und mögliche Therapieansätze, insbesondere die klientenzentrierte Kunsttherapie, zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der frühzeitigen Erkennung und Behandlung, um negative Auswirkungen auf Mutter und Kind zu minimieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Hintergrund (Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und psychische Störungen), Methodisches Vorgehen, Psychische Störungen in der Peripartalzeit (detaillierte Beschreibung verschiedener Störungen), Therapiemaßnahmen (mit Fokus auf klientenzentrierte Kunsttherapie), Diskussion und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Psychische Störungen, Schwangerschaft, Wochenbett, Perinatalzeit, Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schizophrenie, Abhängigkeitserkrankungen, Postpartale Depression, Psychotherapie, Kunsttherapie, klientenzentrierte Kunsttherapie, Therapieansätze.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt detailliert die Methodik, die für die Untersuchung und Analyse der Thematik verwendet wurde. Die genaue Vorgehensweise und die angewandten Methoden werden erläutert, um die wissenschaftliche Fundiertheit der Arbeit zu gewährleisten und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die klientenzentrierte Kunsttherapie?
Die klientenzentrierte Kunsttherapie wird als spezifische Methode der Psychotherapie im Kontext psychischer Störungen während der Schwangerschaft und im Wochenbett ausführlich diskutiert und als möglicher Therapieansatz vorgestellt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte im Gesundheitswesen (Ärzte, Hebammen, Psychologen, Therapeuten), die sich mit der Betreuung von Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett befassen. Sie kann auch für Wissenschaftler, die sich mit psychischen Erkrankungen in der Perinatalzeit beschäftigen, sowie für betroffene Frauen und deren Angehörige von Interesse sein.
- Arbeit zitieren
- Sina Dorothee Blome (Autor:in), 2021, Psychische Störungen in der Schwangerschaft. Kunsttheorie als kreative Psychotherapie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/923299