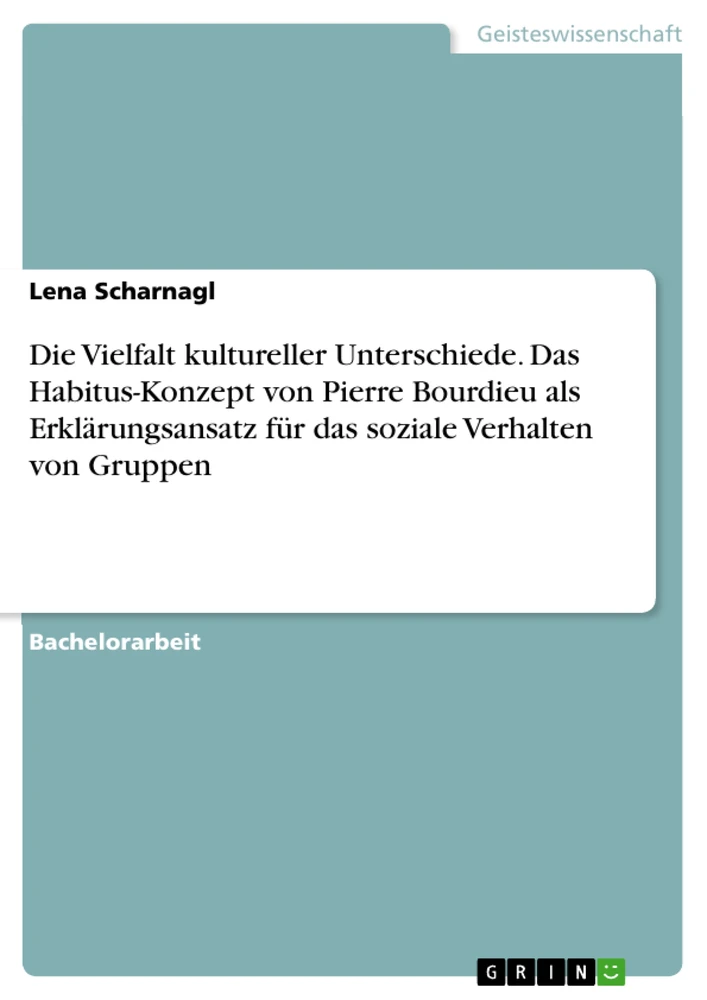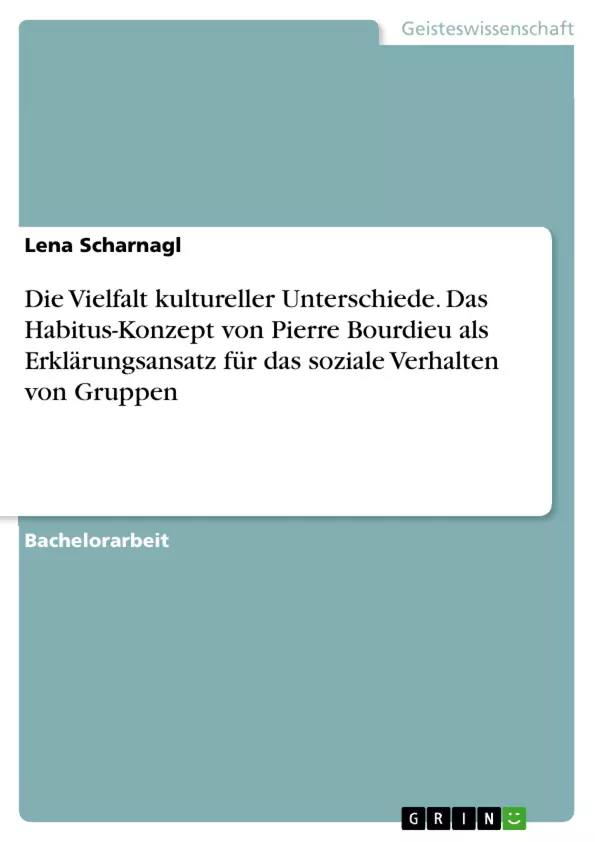Um im Verlauf dieser Arbeit der Frage auf den Grund zu gehen, inwiefern der Habitus-Ansatz von Pierre Bourdieu das soziale Verhalten von Gruppen erklären kann und wie dies in der Anwendung genau geschieht, soll der Fokus zuerst auf die methodologische Sichtweise Bourdieus gelegt werden, mit der sich die Entstehung des Habitus-Konzepts erläutern lässt. Dabei werden die Probleme von subjektivistischen und objektivistischen Theorien aufgezeigt, die Bourdieu zu dem Entwurf einer praxeologischen Erkenntnisweise bewegen. Anschließend wird mithilfe der Definition und Funktion des Habitus versucht, kulturelle Unterschiede von sozialen Gruppen in der Theorie sowie in der empirischen Forschung herauszuarbeiten. Zum Schluss sollen zwei wichtige Rezeptionen dargelegt werden, welche die theoretische Idee Bourdieus aufgreifen. Jedoch muss auch die kritische Auffassung gegenüber dem bourdieuschen Konzept in Betracht gezogen werden, was letztendlich zu einem umfassenden Fazit führt.
Bereits im Jugendalter setzte sich Pierre Bourdieu mit seiner sozialen Herkunft auseinander. Als Kind eines Briefträgers stammte er aus bescheidenen Verhältnissen, welche später seine Beziehung zur gesellschaftlichen Welt prägen sollten. Durch die Berufstätigkeit des Vaters, die trotz langer Arbeitszeiten nur eine einfache Wohnsituation ermöglichte, entwickelte Bourdieu ein Verständnis für die Lebensbedingungen der einfachen Leute. Mit dem Eintritt in das Internat erlebte er den Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Wertesystemen. Es wurden von ihm Eigenschaften, wie gute Manieren und sittliches Verhalten gefordert, die im Kontrast zu seiner ländlich geprägten Erziehung standen. Obwohl er als Schüler im Internat sehr gute Leistungen erzielte, fühlte er sich aufgrund seines niedrigen Sozialstatus nie dazugehörig. Enorme Unterschiede im Vergleich zu seinen bürgerlichen Mitschülern, beispielsweise der Kleidungsstil, das finanzielle Vermögen und sein bäuerlicher Sprachdialekt, verstärkten seine Rolle als Außenstehender zunehmend. Aber nicht nur individuelle Differenzen, sondern auch institutionelle Vorgehensweisen der Schule, wie Auszeichnungen, die sich am gesellschaftlichen Status der Eltern orientierten, beeinflussten Bourdieus Position im Internat im negativen Sinne. Seine Erfahrungen mit der Welt wurden von Anfang an mit sozialer Ungleichheit konfrontiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die methodologische Grundlage Bourdieus für die Entwicklung des Habitus
- 2.1 Der Konflikt der Distanz zum Forschungsgegenstand
- 2.2 Die Schwierigkeiten des Objektivismus und Subjektivismus
- 2.3 Die praxeologische Erkenntnisweise als Lösungsvorschlag
- 3. Die Habitus-Theorie als Erklärung für das soziale Verhalten von Gruppen
- 3.1 Die Definition und Funktion des Habitus
- 3.2 Die Entstehung kultureller Unterschiede
- 3.3 Bourdieus Anwendung des Konzepts in der empirischen Forschung
- 4. Weiterführende Rezeption: Beispiele aus dem Alltag
- 4.1 Der Körper in der Soziologie: Programmieren
- 4.2 Die Musik als Legitimationsmittel für Geschmack
- 5. Ein kritischer Ausblick
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Pierre Bourdieus Habitus-Konzept das soziale Verhalten von Gruppen erklären kann. Sie analysiert Bourdieus methodologische Grundlagen, beleuchtet die Definition und Funktion des Habitus und untersucht dessen Anwendung in der empirischen Forschung. Zusätzlich werden Rezeptionen des Konzepts im Alltag betrachtet.
- Bourdieus methodologische Grundlagen und die Entwicklung seines Habitus-Konzepts
- Definition und Funktion des Habitus
- Erklärung kultureller Unterschiede durch den Habitus
- Anwendung des Habitus-Konzepts in der empirischen Forschung
- Rezeptionen des Habitus-Konzepts im Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund von Pierre Bourdieu, der durch seine soziale Herkunft und Erfahrungen mit unterschiedlichen Wertesystemen geprägt wurde. Sie skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit und gibt einen Überblick über die Struktur. Bourdieus eigene soziale Positionierung und der daraus resultierende Blickwinkel auf soziale Ungleichheit bilden den Ausgangspunkt der Untersuchung.
2. Die methodologische Grundlage Bourdieus für die Entwicklung des Habitus: Dieses Kapitel erörtert Bourdieus methodologischen Ansatz. Es analysiert kritisch sowohl den Objektivismus als auch den Subjektivismus und präsentiert Bourdieus praxeologische Erkenntnisweise als Lösungsansatz. Die Diskussion der methodischen Herausforderungen beim Studium sozialer Phänomene bildet die Grundlage für das Verständnis des Habitus-Konzepts.
3. Die Habitus-Theorie als Erklärung für das soziale Verhalten von Gruppen: Dieses Kapitel stellt Bourdieus Habitus-Theorie im Detail vor. Es definiert den Habitus, erklärt seine Funktion und beleuchtet, wie er kulturelle Unterschiede zwischen sozialen Gruppen entstehen lässt. Die Anwendung des Konzepts in der empirischen Forschung wird ebenfalls diskutiert, untermauert durch Beispiele aus Bourdieus eigenen Arbeiten. Der Fokus liegt auf der Erklärung sozialer Praktiken und deren Zusammenhang mit der sozialen Positionierung.
4. Weiterführende Rezeption: Beispiele aus dem Alltag: Dieses Kapitel präsentiert Beispiele aus dem Alltag, die die Relevanz und Anwendbarkeit des Habitus-Konzepts illustrieren. Die Analyse von Körperpraktiken und Musikpräferenzen als Ausdrucksformen des Habitus verdeutlicht die allgegenwärtige Bedeutung der Theorie für das Verständnis sozialer Dynamiken. Die Beispiele veranschaulichen die praktische Relevanz der Theorie und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Habitus, Pierre Bourdieu, soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede, soziale Gruppen, methodologische Grundlagen, praxeologie, empirische Forschung, Rezeption, Alltag.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pierre Bourdieus Habitus-Konzept
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Pierre Bourdieus Habitus-Konzept das soziale Verhalten von Gruppen erklären kann. Sie analysiert seine methodologischen Grundlagen, die Definition und Funktion des Habitus und dessen Anwendung in der empirischen Forschung. Zusätzlich werden Rezeptionen des Konzepts im Alltag betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bourdieus methodologische Grundlagen und die Entwicklung seines Habitus-Konzepts, die Definition und Funktion des Habitus, die Erklärung kultureller Unterschiede durch den Habitus, die Anwendung des Habitus-Konzepts in der empirischen Forschung und Rezeptionen des Habitus-Konzepts im Alltag.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Bourdieus methodologischen Grundlagen, ein Kapitel zur Habitus-Theorie und ihrer Anwendung zur Erklärung sozialen Verhaltens, ein Kapitel mit Beispielen aus dem Alltag und abschließende Kapitel mit Ausblick und Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Welche methodologische Grundlage verwendet Bourdieu?
Bourdieu entwickelt eine praxeologische Erkenntnisweise als Lösungsansatz, der sowohl Objektivismus als auch Subjektivismus kritisch hinterfragt. Die Diskussion der methodischen Herausforderungen beim Studium sozialer Phänomene bildet die Grundlage für das Verständnis des Habitus-Konzepts.
Was ist der Habitus nach Bourdieu?
Der Habitus wird definiert und seine Funktion erklärt. Es wird gezeigt, wie er kulturelle Unterschiede zwischen sozialen Gruppen entstehen lässt und wie er in der empirischen Forschung angewendet wird. Der Fokus liegt auf der Erklärung sozialer Praktiken und deren Zusammenhang mit der sozialen Positionierung.
Wie werden kulturelle Unterschiede erklärt?
Kulturelle Unterschiede werden durch den Habitus erklärt, der als ein System von dauerhaften, erworbenen Dispositionen verstanden wird, das Denken, Handeln und Wahrnehmen prägt und so zu unterschiedlichen sozialen Praktiken führt.
Welche Beispiele aus dem Alltag werden betrachtet?
Es werden Beispiele aus dem Alltag, wie Körperpraktiken und Musikpräferenzen, analysiert, um die Relevanz und Anwendbarkeit des Habitus-Konzepts zu veranschaulichen. Dies verdeutlicht die allgegenwärtige Bedeutung der Theorie für das Verständnis sozialer Dynamiken.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Habitus, Pierre Bourdieu, soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede, soziale Gruppen, methodologische Grundlagen, Praxeologie, empirische Forschung, Rezeption, Alltag.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund von Pierre Bourdieu. Sie skizziert die zentralen Forschungsfragen und gibt einen Überblick über die Struktur. Bourdieus soziale Positionierung und sein Blickwinkel auf soziale Ungleichheit bilden den Ausgangspunkt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit wird im Text nicht explizit zusammengefasst, aber es kann angenommen werden, dass es die zentralen Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Analyse von Bourdieus Habitus-Konzept zusammenfasst.)
- Citation du texte
- Lena Scharnagl (Auteur), 2017, Die Vielfalt kultureller Unterschiede. Das Habitus-Konzept von Pierre Bourdieu als Erklärungsansatz für das soziale Verhalten von Gruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922555