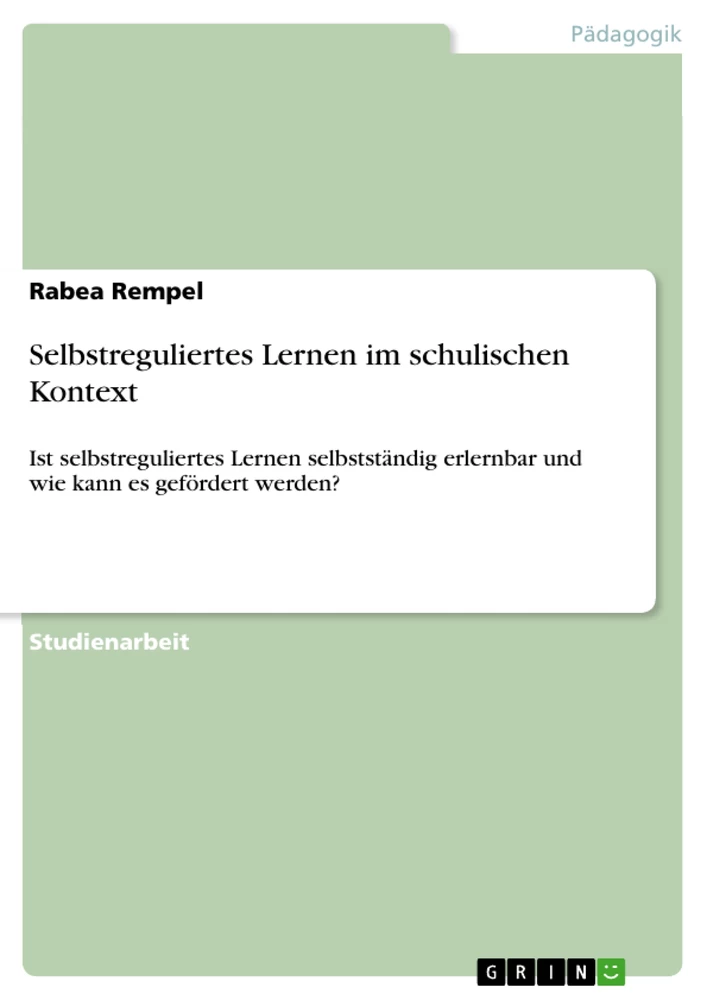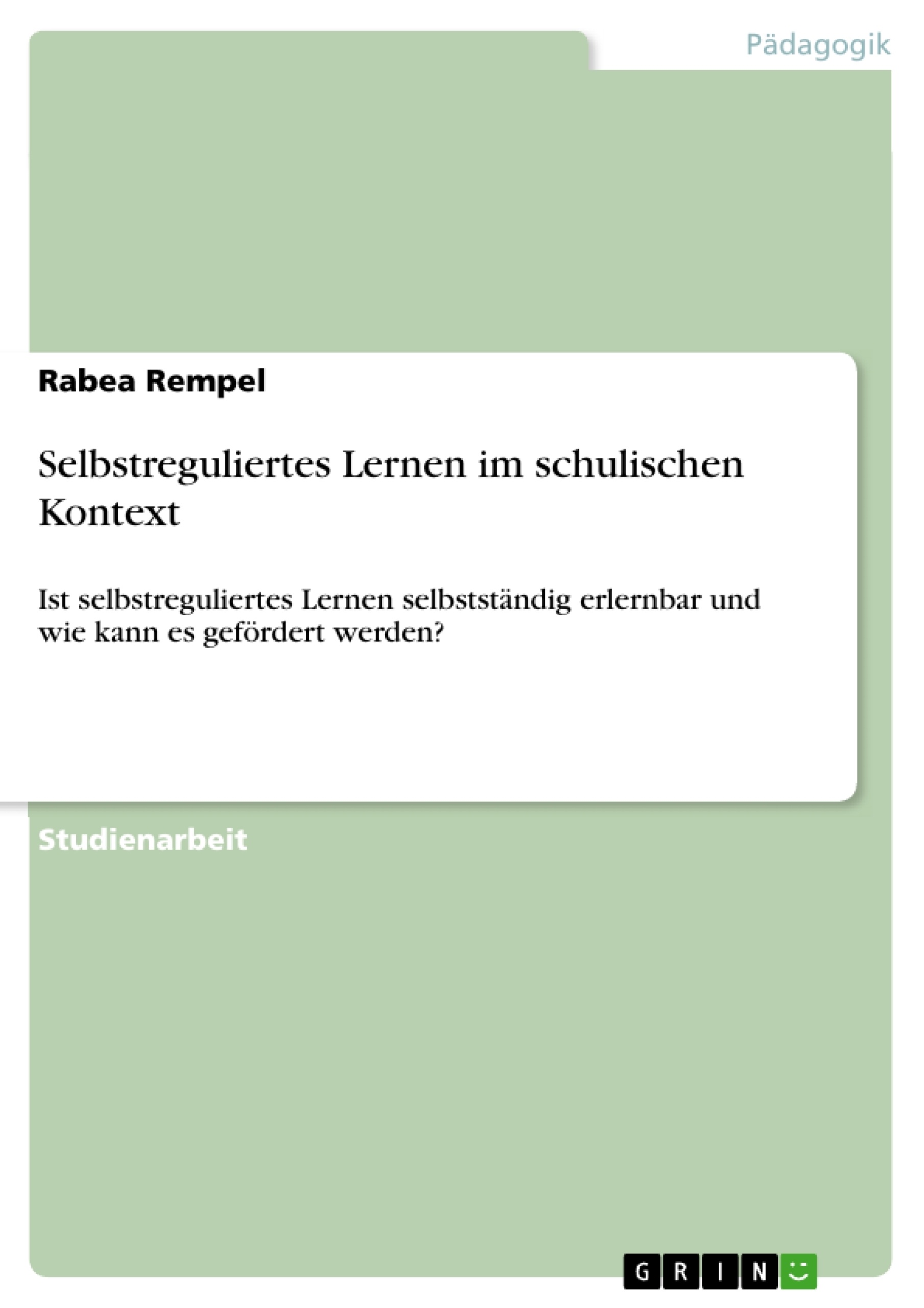Diese Arbeit beschäftigt sich mit selbstreguliertem Lernen in der Schule. Sie stellt zuerst dar, wie selbstreguliertes Lernen funktioniert und ob es für Schüler heutzutage relevant ist. Auf Grundlage der CHILD Studie der University of Cambridge wird der Forschungsstand dazu aufgezeigt. Zuletzt wird die aktuelle Situation der Schulen und Schüler daraufhin untersucht, ob sie dem gewonnenen Anspruch gerecht werden. Dieses Thema bietet sich als Forschungsthema an, da bisher noch nicht viel dazu geforscht wurde, das Interesse an der Thematik aber im Allgemeinen steigt.
Selbstreguliertes Lernen ist erlernbar und beginnt bereits im Kindesalter. Noch gibt es viele Fragen auf dem Gebiet, wie und wann Kinder Selbstkontrolle lernen. In dieser Arbeit wird festgehalten, dass Kinder zu einem gewissen Teil von sich aus entsprechende Kompetenzen entwickeln können. Diese reichen für unseren Alltag aber nicht aus. Das Schul- und Erziehungssystem bietet in seinem jetzigen Zustand nicht die richtige Umgebung, um Selbstkontrolle und Autonomie zu lernen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern, Erzieher und Lehrkräfte sich bemühen, aus den gegebenen Strukturen eine passende Umgebung zu schaffen und weitere Kompetenzen zu fördern, damit Kinder am Ende ihrer Schulzeit in der Lage sind, an die heutigen Anforderungen der Gesellschaft angepasst, selbstständig zu lernen und zu handeln. Aus diesem Grund werden am Ende der Arbeit verschiedene Methoden vorgestellt, mithilfe derer Lehrer den Unterricht entsprechend gestalten können.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung meiner Arbeit
- Einführung in das Thema Selbstreguliertes Lernen
- Was bedeutet Selbstreguliertes Lernen?
- Prozessmodelle nach Zimmermann
- Schichtmodell nach Boekaerts (1999)
- Sind selbstreguliertes Lernen und Lernstrategien relevant für heutige Schüler?
- Forschungen zu selbstreguliertem Lernen vor bewusster Förderung
- Kann man Lernkompetenzen erfassen und messen?
- Erlernt ein Schüler solche Strategien selbstständig?
- Welche Strategien werden am häufigsten gelernt und woran liegt das?
- Selbstreguliertes Lernen im Schulalltag
- Werden solche Strategien in dem Schulalltag vermittelt?
- Was sind Gründe, an denen die Vermittlung scheitert?
- Warum ist es nötig Selbstregulationsstrategien zu vermitteln, wenn die Schüler sie doch selbst lernen?
- Wie kann man sie vermitteln?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept des selbstregulierten Lernens und dessen Bedeutung im schulischen Kontext. Es wird analysiert, ob und wie sich selbstreguliertes Lernen erlernen lässt, und welche Faktoren seine Entwicklung fördern können.
- Definition und Modelle des selbstregulierten Lernens
- Relevanz von Lernstrategien für heutige Schüler
- Forschungsergebnisse zum selbstregulierten Lernen
- Förderung von Selbstregulation im Schulalltag
- Möglichkeiten zur Gestaltung des Unterrichts zur Förderung des selbstregulierten Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung meiner Arbeit
Die Zusammenfassung stellt fest, dass selbstreguliertes Lernen erlernbar ist und bereits im Kindesalter beginnt. Es werden wichtige Fragen zur Entwicklung von Selbstkontrolle bei Kindern aufgeworfen. Die Arbeit betont, dass Kinder zwar selbständig Kompetenzen entwickeln, diese aber für den heutigen Alltag nicht ausreichen. Das Schul- und Erziehungssystem bietet nicht die optimale Umgebung zur Förderung von Selbstkontrolle und Autonomie. Daher wird die Notwendigkeit betont, Eltern, Erziehern und Lehrkräften zu helfen, aus den gegebenen Strukturen eine geeignete Umgebung zu schaffen und weitere Kompetenzen zu fördern. Ziel ist es, dass Kinder am Ende ihrer Schulzeit in der Lage sind, selbstständig zu lernen und zu handeln. Verschiedene Methoden werden vorgestellt, mit denen Lehrer den Unterricht entsprechend gestalten können.
Einführung in das Thema Selbstreguliertes Lernen
Die Einführung erläutert den Begriff des selbstregulierten Lernens und verschiedene Definitionen, insbesondere die von Götz und Nett (2011). Es werden die Komponenten „Selbst", „Regulation" und „Lernen" näher betrachtet. Die Definition von Götz und Nett betont die Eigeninitiative des Lernenden bei der Zielsetzung, der Auswahl von Strategien und der prozessbegleitenden Optimierung. Es werden Prozess- und Schichtmodelle zur Darstellung des selbstregulierten Lernens vorgestellt.
Forschungen zu selbstreguliertem Lernen vor bewusster Förderung
Dieser Abschnitt beleuchtet Forschungsarbeiten zum selbstregulierten Lernen und untersucht, ob und wie sich Lernkompetenzen messen und erfassen lassen. Es wird die Frage behandelt, ob Schüler solche Strategien selbstständig erlernen und welche Strategien am häufigsten gelernt werden.
Selbstreguliertes Lernen im Schulalltag
Der Fokus liegt auf der Frage, ob Selbstregulationsstrategien im Schulalltag vermittelt werden und welche Gründe für eine fehlgeschlagene Vermittlung verantwortlich sind. Die Notwendigkeit der Vermittlung von Selbstregulationsstrategien wird betont und es werden verschiedene Möglichkeiten zur Vermittlung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Selbstreguliertes Lernen, Lernstrategien, Selbstkontrolle, Autonomie, Schulalltag, Unterrichtsgestaltung, Prozessmodelle, Schichtmodelle und die Förderung von Lernkompetenzen. Wichtige Forschungsergebnisse und Studienergebnisse werden ebenfalls behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet selbstreguliertes Lernen?
Es beschreibt die Fähigkeit von Lernenden, eigeninitiativ Ziele zu setzen, passende Strategien auszuwählen und den eigenen Lernprozess zu optimieren.
Können Kinder Selbstregulation von alleine lernen?
Kinder entwickeln zwar gewisse Kompetenzen von sich aus, diese reichen für die heutigen gesellschaftlichen Anforderungen jedoch nicht aus und müssen gezielt gefördert werden.
Warum bietet das heutige Schulsystem oft nicht die richtige Umgebung?
Starre Strukturen und mangelnde Autonomie im Schulalltag erschweren oft das Erlernen von Selbstkontrolle und eigenständigem Handeln.
Welche Prozessmodelle erklären selbstreguliertes Lernen?
Die Arbeit stellt unter anderem die Modelle von Zimmermann und das Schichtmodell von Boekaerts vor.
Wie können Lehrer die Selbstregulation im Unterricht fördern?
Durch die Vermittlung von Lernstrategien, die Schaffung offener Lernumgebungen und Methoden, die Schülern mehr Verantwortung für ihren Lernprozess übertragen.
- Arbeit zitieren
- Rabea Rempel (Autor:in), 2020, Selbstreguliertes Lernen im schulischen Kontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/922470