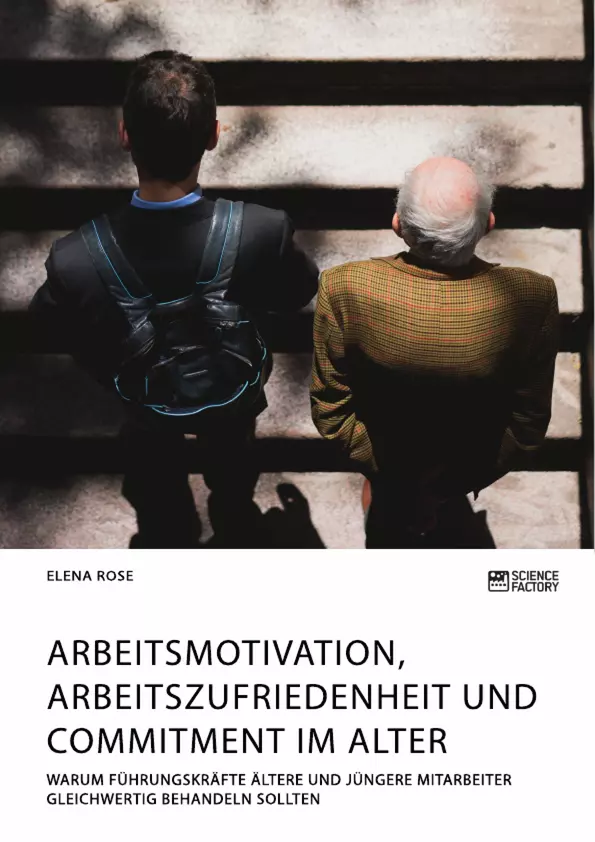Älteres Personal wird häufig für Weiterbildungsmaßnahmen ausgeschlossen, obwohl es für Arbeitgeber:innen in Zukunft immer wichtiger werden wird, sich sowohl mit der Arbeitsmotivation, der Arbeitszufriedenheit als auch mit dem Commitment der älteren Belegschaft zu beschäftigen. Aufgrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels ist es notwendig, gerade diese Arbeitnehmer:innen möglichst lange und leistungsmotiviert in einem Unternehmen zu halten und sie zu binden.
Elena Rose untersucht, ob sich die Bedürfnisse der älteren Mitarbeiter:innen von denen der jüngeren unterscheiden und welche tatsächlichen Auswirkungen das Alter auf die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Bindung an ein Unternehmen hat. Anhand ihrer Ergebnisse gibt sie Unternehmen konkrete Empfehlungen für die Praxis.
Aus dem Inhalt:
- Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter;
- Arbeitsbedingungen;
- Organisationales Commitment;
- Kompetenzmotiv;
- Fachkräftemangel;
- Demografischer Wandel
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemfeld: Die Bedeutung des Alterns in Deutschland
- 1.2 Relevanz des Themas
- 1.3 Zielsetzung und Fragestellung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Demographische Entwicklung in Deutschland
- 2.2 Die Auswirkungen des Alterns auf die Arbeitswelt
- 2.3 Die Arbeitsmotivation
- 2.3.1 Die Bedürfnispyramide nach Maslow
- 2.3.2 Das Risiko-Wahl-Modell
- 2.3.3 Die Theorie der Selbstbestimmung
- 2.4 Die Arbeitszufriedenheit
- 2.4.1 Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg
- 2.4.2 Das Job-Characteristics-Modell
- 2.5 Das Commitment
- 2.5.1 Das dreidimensionale Modell des Commitments
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Forschungsdesign und Methode
- 3.2 Hypothesen
- 3.3 Stichprobe
- 3.4 Datenerhebung und Datenanalyse
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Statistik
- 4.2 Zusammenhänge zwischen den Variablen
- 5 Diskussion
- 5.1 Interpretation der Ergebnisse
- 5.2 Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und das Commitment von älteren und jüngeren Arbeitnehmern. Sie zielt darauf ab, Unterschiede zwischen den Altersgruppen in Bezug auf diese Faktoren zu identifizieren und die Relevanz des Alters für die Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und das Commitment zu beurteilen. Die Ergebnisse der Studie sollen Aufschluss darüber geben, wie Führungskräfte mit den Bedürfnissen von Arbeitnehmern unterschiedlichen Alters umgehen können, um die Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und das Commitment der gesamten Belegschaft zu steigern.
- Demographische Entwicklung in Deutschland und die Auswirkungen des Alterns auf die Arbeitswelt
- Theorien zu Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und Commitment
- Empirische Untersuchung der Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und des Commitments von älteren und jüngeren Arbeitnehmern
- Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- Praktische Implikationen der Ergebnisse für die Führung von Mitarbeitern unterschiedlichen Alters
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Alterns für die Arbeitswelt in Deutschland. Es werden die Forschungslücke und die Zielsetzung der Arbeit definiert. - Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden die relevanten Theorien zu Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und Commitment vorgestellt. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze erläutert, die die Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und das Commitment von Arbeitnehmern beeinflussen. - Kapitel 3: Empirische Untersuchung
Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign und die Methode der Studie. Es wird die Stichprobe vorgestellt und die Datenerhebung sowie Datenanalyse erläutert. - Kapitel 4: Ergebnisse
Hier werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt und interpretiert. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Hypothesen der Studie diskutiert. - Kapitel 5: Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie weitergehend diskutiert und ihre Relevanz für die Praxis erläutert. Es werden die Limitationen der Studie und der Forschungsstand zum Thema beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit, Commitment, Alter, Demographischer Wandel, Führung, Personalmanagement, Berufstätigkeit, Altersstruktur, Arbeitsmarkt
Häufig gestellte Fragen
Unterscheiden sich die Bedürfnisse älterer Mitarbeiter von jüngeren?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und zeigt auf, welche spezifischen Faktoren Motivation, Zufriedenheit und Commitment in verschiedenen Altersgruppen beeinflussen.
Warum ist das Commitment älterer Mitarbeiter für Unternehmen wichtig?
Angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels ist es essenziell, erfahrene Mitarbeiter langfristig und motiviert an das Unternehmen zu binden.
Was besagt die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg?
Sie unterscheidet zwischen Hygienefaktoren (z.B. Gehalt), die Unzufriedenheit verhindern, und Motivatoren (z.B. Anerkennung), die echte Zufriedenheit erzeugen.
Welche Rolle spielt die Leistungsfähigkeit im Alter?
Die Arbeit räumt mit Vorurteilen auf und betont, dass ältere Mitarbeiter durch Weiterbildung und angepasste Arbeitsbedingungen weiterhin hochleistungsfähig bleiben.
Welche Empfehlungen gibt die Studie für Führungskräfte?
Führungskräfte sollten Mitarbeiter unabhängig vom Alter gleichwertig behandeln, individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und gezielt in die Bindung älterer Belegschaften investieren.
- Citation du texte
- Elena Rose (Auteur), 2021, Arbeitsmotivation, Arbeitszufriedenheit und Commitment im Alter. Warum Führungskräfte ältere und jüngere Mitarbeiter gleichwertig behandeln sollten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/918032