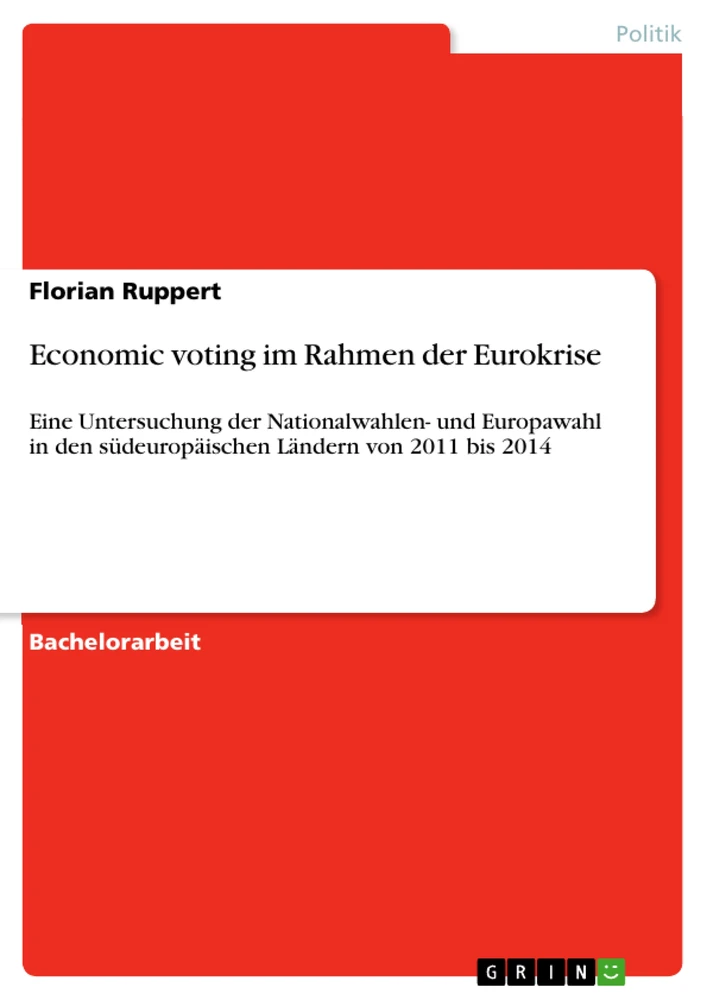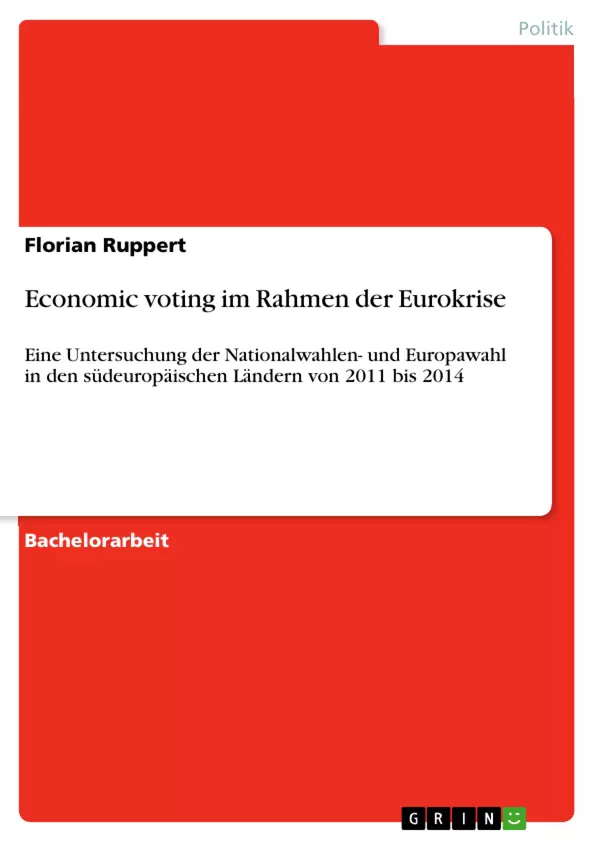„It’s the economy, stupid!“ lautete der bekannteste Wahlkampf-Slogan Bill Clintons im Jahr 1992, in welchem er schließlich auch die US-Präsidentschaftswahl gewann (Die Presse 06.11.2012). Doch nicht erst seit dieser Kampagne gilt die wirtschaftliche Lage als einer der entscheidenden Faktoren in einem Wahlkampf. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Wahlen demnach für den jeweiligen Amtsinhaber deutlich schwieriger zu gewinnen als in prosperierenden Phasen. Genau mit dieser These beschäftigt sich die Theorie des „economic voting“. Auf der Grundlage der Ökonometrie werden Ökonomie und Politikwissenschaft miteinander verknüpft, um zu versuchen, Wahlergebnisse mit wirtschaftlichen Indikatoren zu erklären. Die zentrale Annahme ist hierbei die sogenannte Reward/Punishment-Hypothese, die besagt, dass die Amtsinhaber in wirtschaftlich guten Zeiten bei Wahlen Stimmen hinzu gewinnen und umgekehrt in wirtschaftlich schlechten Zeiten von den Wählern abgestraft werden. Als eine solche wirtschaftliche Krisenzeit stellt sich die Eurokrise, auch Eurozonenkrise
genannt, dar. Infolge der Weltfinanzkrise fielen nahezu alle Staaten der europäischen
Union 2009 in eine tiefe wirtschaftliche Rezession. Gleichzeitig mussten viele
Banken teilweise oder ganz verstaatlicht werden, um diese zu erhalten. Besonders hart
betroffen waren die südeuropäischen Länder Portugal, Spanien, Griechenland und Italien.
Denn die Auswirkungen der Krise führten in diesen Ländern ebenfalls zu einer
Staatsschuldenkrise. Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit dieser Staaten zu verhindern,
wurden finanzielle Hilfen der EU und des Internationalen Währungsfonds in Anspruch
genommen. Diese waren jedoch an strenge Sparmaßnahmen geknüpft, welche
für großen Unmut in der Bevölkerung der betroffenen Ländern sorgte.
In diesem Zeitraum fanden in allen vier Staaten auch Parlamentswahlen statt, die
hauptsächlich unter dem Eindruck der Krise standen. Auch die Europawahlen 2014
waren vor allem in den südeuropäischen Ländern von den Auswirkungen der Eurokrise
geprägt, spielte die EU doch eine bedeutende Rolle in der Bewältigung der Krise
der betroffenen Staaten. Deshalb beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage: „Spielte
economic voting in den Wahlen in Südeuropa von 2011 bis 2014 eine Rolle und gibt
es dabei einen Unterschied zwischen Nationalwahlen und Europawahl?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Eurokrise
- Economic voting
- Entwicklung der Theorie des economic voting
- Economic voting und der politische Kontext
- Aktueller Forschungsstand
- Economic voting in Zeiten der Globalisierung und die Rolle der EU
- Hypothesen
- Economic voting in Südeuropa
- Operationalisierung und verwendete Datensätze
- Abhängige Variablen
- Unabhängige Variablen und Kontrollvariablen
- Verwendete Datensätze
- Operationalisierung und verwendete Datensätze
- Analyse
- Portugal
- Portugiesische Parlamentswahl 2011
- Europawahl 2014 in Portugal
- Spanien
- Spanische Parlamentswahl 2011
- Europawahl 2014 in Spanien
- Griechenland
- Griechische Parlamentswahlen Mai und Juni 2012
- Europawahl 2014 in Griechenland
- Italien
- Italienische Parlamentswahl 2013
- Europawahl 2014 in Italien
- Ergebnisse
- Portugal
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Phänomen des Economic Voting im Kontext der Eurokrise und analysiert, ob sich dieser in den Nationalwahlen und der Europawahl in Südeuropa von 2011 bis 2014 beobachten lässt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle des Economic Voting in diesen Wahlen zu bewerten und mögliche Unterschiede zwischen den beiden Wahltypen aufzuzeigen.
- Die Auswirkungen der Eurokrise auf die südeuropäischen Länder
- Die Theorie des Economic Voting und ihre Entwicklung
- Die Anwendung des Economic Voting Modells im Kontext der Eurokrise
- Die Analyse der Nationalwahlen und der Europawahl in Südeuropa
- Die Herausforderungen und die Bedeutung des Economic Voting in Zeiten der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Economic Voting und die Eurokrise ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Kapitel 2 behandelt die Eurokrise, ihre Entstehung und die Folgen für die südeuropäischen Länder. Kapitel 3 beleuchtet die Theorie des Economic Voting, ihre Entwicklung, den aktuellen Forschungsstand und die Relevanz im Kontext der Globalisierung. Kapitel 4 beschreibt die Operationalisierung und die verwendeten Datensätze der Analyse. Kapitel 5 analysiert die Wahlergebnisse in Portugal, Spanien, Griechenland und Italien, getrennt für die Nationalwahlen und die Europawahl. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse der Analyse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Economic Voting, Eurokrise, Südeuropa, Nationalwahlen, Europawahl, Globalisierung, politische Ökonomie, und die Rolle der Europäischen Union.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des „Economic Voting“?
Die Theorie (Reward/Punishment-Hypothese) besagt, dass Wähler die Regierung bei guter wirtschaftlicher Lage belohnen und bei schlechter wirtschaftlicher Lage durch Entzug der Stimme abstrafen.
Welche Rolle spielte Economic Voting in der Eurokrise?
In südeuropäischen Ländern wie Portugal, Spanien, Griechenland und Italien führte die Krise zu massiven Stimmenverlusten der amtierenden Regierungen, die für die Sparmaßnahmen verantwortlich gemacht wurden.
Gibt es Unterschiede zwischen National- und Europawahlen?
Die Arbeit untersucht, ob Wähler bei Europawahlen anders entscheiden, da die EU oft als Mitverantwortliche für Sparauflagen wahrgenommen wird, während Nationalwahlen direkter die heimische Regierung betreffen.
Was bedeutet „It’s the economy, stupid!“?
Dieser Slogan von Bill Clinton verdeutlicht, dass die wirtschaftliche Lage oft der entscheidende Faktor für den Wahlausgang ist, wichtiger als die meisten anderen politischen Themen.
Wie beeinflusst die Globalisierung das Economic Voting?
Durch die globale Verflechtung haben nationale Regierungen weniger Kontrolle über die Wirtschaft, was die Frage aufwirft, ob Wähler sie dennoch für die wirtschaftliche Lage verantwortlich machen.
- Citation du texte
- Florian Ruppert (Auteur), 2019, Economic voting im Rahmen der Eurokrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/916733