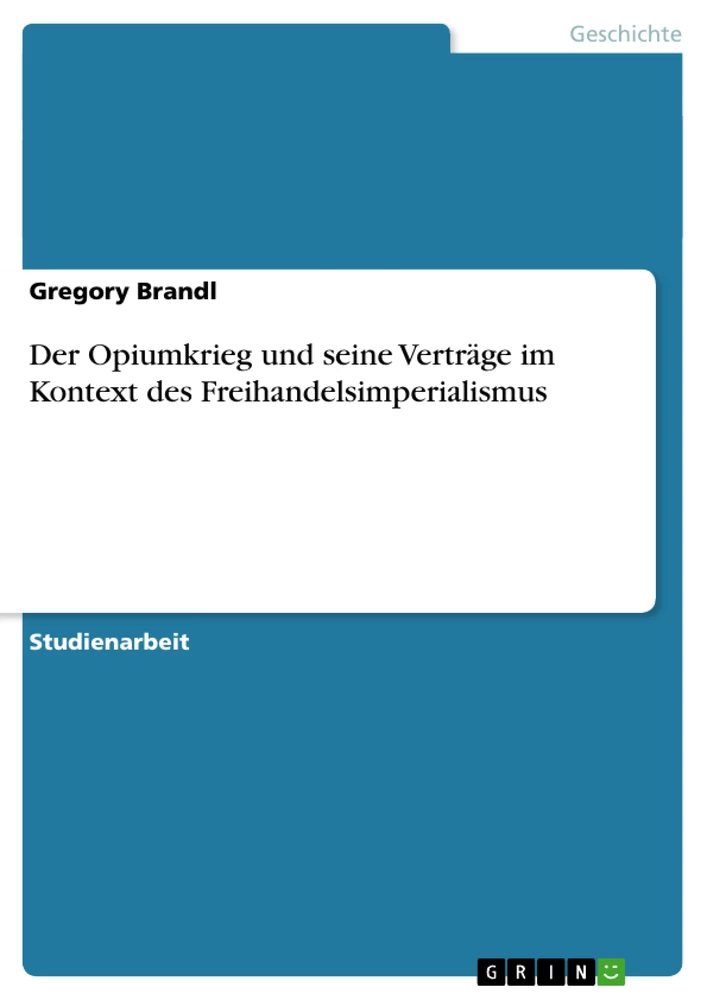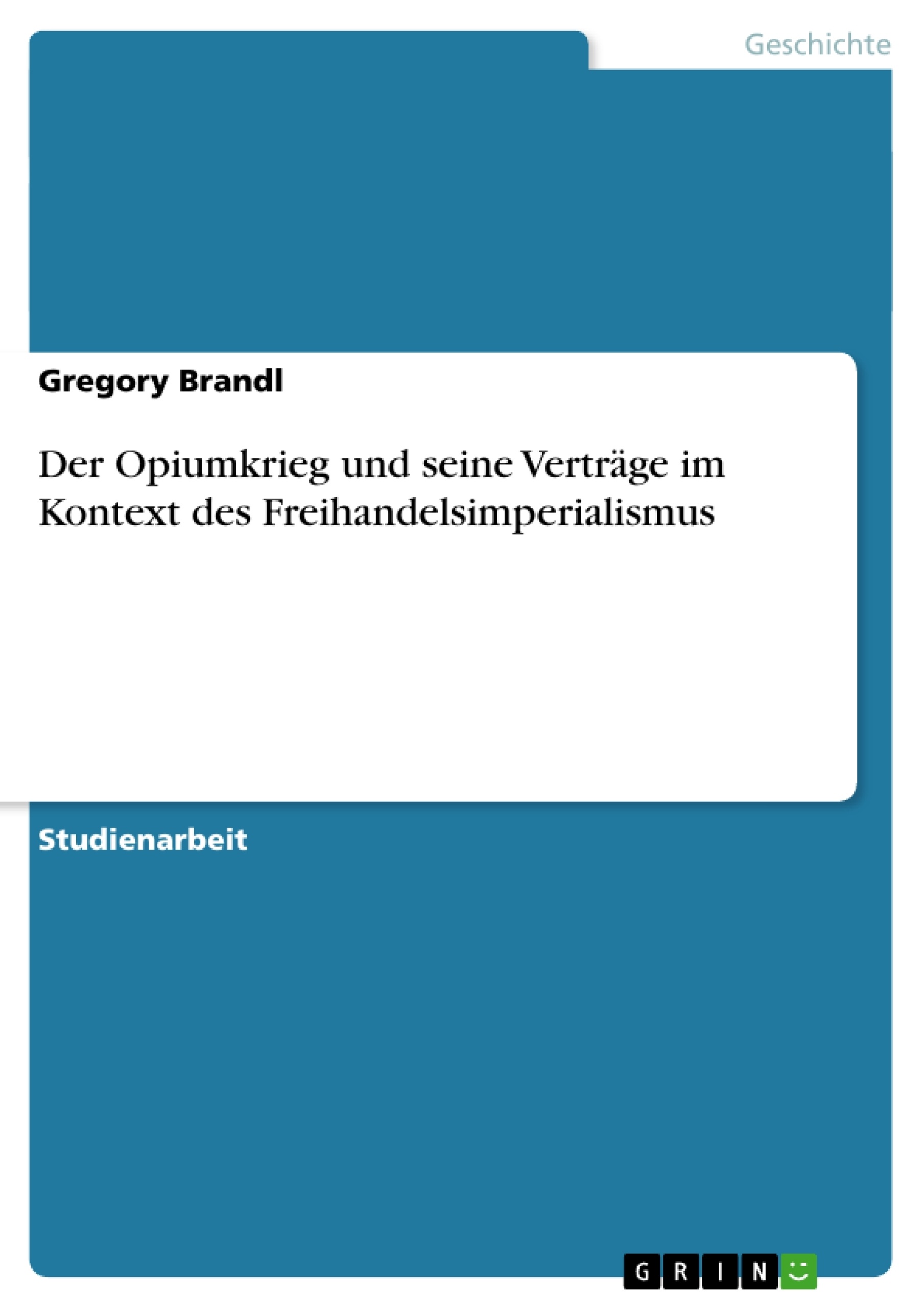Der Opiumkrieg stellte in seinem Ergebnis den Beginn einer neuen Epoche für die Chinesen dar. Der Freihandel, der ihnen von den Briten aufgezwungen wurde, kann als imperialistisch angesehen werden. Imperialismus bezeichnet gemeinhin das Bestreben eines Staates, seinen Einfluss auf andere Länder oder Völker auszudehnen. Dieser Machterweiterungspolitik können unter anderem bevölkerungspolitische, nationalistische und wirtschaftspolitische Motive zugrunde liegen. Im 19. Jahrhundert nahm der europäische Imperialismus im Zuge der industriellen Revolution zu, wobei Großbritannien die führende Rolle übernahm.
John Gallagher und Ronald Robinson behandeln in ihrem Aufsatz „Der Imperialismus des Freihandels“ die Expansionspolitik der Briten im 19. Jahrhundert. Sie definieren den Begriff „Imperialismus“ als politische Funktion eines Prozesses der Eingliederung neuer Gebiete in eine expandierende Wirtschaft. „Nur wenn die politische Ordnung dieser neuen Gebiete keine befriedigenden Bedingungen für eine handelspolitische oder strategische Integration bietet und ihre relative Schwäche es erlaubt, wird die Macht imperialistisch zur Schaffung dieser Bedingungen angewandt.“ Beide kommen zu einer wichtigen These. Sie wandeln die übliche Zusammenfassung der Politik des Freihandels-Empire um. So wird aus dem Grundsatz: „Handel und keine Herrschaft“ bei ihnen „Handel und informelle Herrschaft wenn möglich, Handel und direkte Herrschaft wenn nötig.“ Weiterhin stellen Gallagher und Robinson fest, dass in den Gebieten, wo keine Europäer siedelten, die britische Expansionspolitik zerstörerisch auf die hiesigen Gesellschaftsstrukturen wirkte und diese zusammenbrechen ließ. So erklärt sich auch der vielfache Wandel von indirekter zu direkter Herrschaft.
Das Fallbeispiel „Der Opiumkrieg“ soll untersuchen, inwieweit diese Thesen zutreffend sind. Die daraus entstandenen Verträge, welche in der chinesischen Geschichtsschreibung als die „Ungleichen Verträge“ bekannt sind, sollen genauer beleuchtet werden. Es gilt auch die Frage zu untersuchen, ob diese Bezeichnung gerechtfertigt ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Vorstellung des Themas
- 1.2. Die Quellen
- 2. China zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 2.1. Die Qing-Dynastie
- 2.2. Handel und Verhältnis zum westlichen Ausland
- 3. Das Ende des ersten Opiumkrieges und der Vertrag von Nanking
- 3.1. Tagebuch eines Zeitzeugen aus Chinkiang
- 3.2. Der Vertrag von Nanking
- 4. Der Arrow-Zwischenfall und der Vertrag von Tianjin
- 4.1. Der so genannte „zweite Opiumkrieg“
- 4.2. Karl Marx und der Vertrag von Tianjin
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Opiumkrieg und seine Folgen, insbesondere die „Ungleichen Verträge“, im Kontext des Freihandelsimperialismus. Sie analysiert, inwieweit die Thesen von Gallagher und Robinson zum Freihandelsimperialismus auf den Opiumkrieg zutreffen und ob die Bezeichnung „Ungleiche Verträge“ gerechtfertigt ist. Die Arbeit berücksichtigt dabei die chinesische Perspektive auf den Krieg.
- Der Freihandelsimperialismus Großbritanniens im 19. Jahrhundert
- Die Qing-Dynastie und ihre Herausforderungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Der erste Opiumkrieg und seine Auswirkungen auf China
- Der Vertrag von Nanking und seine Bedeutung
- Die chinesische Wahrnehmung der „Ungleichen Verträge“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Opiumkriegs und der „Ungleichen Verträge“ ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie präsentiert die These, dass der von Großbritannien aufgezwungene Freihandel imperialistischen Charakter hatte und verweist auf die Thesen von Gallagher und Robinson zum Freihandelsimperialismus. Die Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit diese Thesen auf den Opiumkrieg zutreffen und ob die chinesische Bezeichnung der Verträge als „Ungleich“ gerechtfertigt ist. Die Quellenlage wird kurz vorgestellt, wobei der Fokus auf dem Vertrag von Nanking liegt.
2. China zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt die Situation Chinas zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Qing-Dynastie, ihre militärische und politische Stärke sowie die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, wie Bevölkerungswachstum, Umweltprobleme und zunehmende Ineffizienz des Staates. Die beschränkte Handlungsfähigkeit der Regierung im Angesicht des enormen wirtschaftlichen Wachstums wird als Paradoxon dargestellt, das im Kontext des bevorstehenden Opiumkriegs eine entscheidende Rolle spielen wird. Der Abschnitt über den Handel mit dem westlichen Ausland beschreibt die Einschränkungen des Kanton-Systems und die unbefriedigende Situation für die Briten, welche den Hintergrund für den kommenden Konflikt bildet.
3. Das Ende des ersten Opiumkrieges und der Vertrag von Nanking: Dieses Kapitel behandelt das Ende des ersten Opiumkriegs und den daraus resultierenden Vertrag von Nanking. Es wird dabei die chinesische Perspektive durch das Tagebuch eines Zeitzeugen aus Chinkiang einbezogen, um die Erfahrungen der Bevölkerung während der Bombardierungen und des Falls der Stadt zu verdeutlichen. Die Analyse des Vertrags von Nanking, des ersten der „Ungleichen Verträge“, steht im Mittelpunkt, um dessen Auswirkungen und seine Bedeutung für die chinesische Geschichtsschreibung herauszuarbeiten. Der Vertrag wird als Zäsur in der chinesischen Geschichte dargestellt.
4. Der Arrow-Zwischenfall und der Vertrag von Tianjin: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Arrow-Zwischenfall und dem daraus resultierenden Vertrag von Tianjin, der den sogenannten „zweiten Opiumkrieg“ einleitet. Die Rolle von Karl Marx' Analyse beider Verträge wird einbezogen, um eine weitere Perspektive auf die Ereignisse zu bieten. Der Fokus liegt auf den Folgen und den langfristigen Auswirkungen dieser Verträge auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und China. Die Kapitelzusammenfassung vermeidet eine detaillierte Darstellung des Kriegsverlaufs, konzentriert sich aber auf die Bedeutung der Verträge als weitere Eskalation der imperialistischen Politik Großbritanniens.
Schlüsselwörter
Opiumkrieg, Ungleiche Verträge, Freihandelsimperialismus, Qing-Dynastie, Vertrag von Nanking, Vertrag von Tianjin, Großbritannien, China, Imperialismus, Karl Marx, Chinesische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Opiumkrieg und den Ungleichen Verträgen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Opiumkrieg und seine Folgen, insbesondere die „Ungleichen Verträge“, im Kontext des Freihandelsimperialismus. Sie analysiert, inwieweit die Thesen von Gallagher und Robinson zum Freihandelsimperialismus auf den Opiumkrieg zutreffen und ob die Bezeichnung „Ungleiche Verträge“ gerechtfertigt ist. Die chinesische Perspektive wird dabei berücksichtigt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Freihandelsimperialismus Großbritanniens im 19. Jahrhundert, die Herausforderungen der Qing-Dynastie, den ersten und zweiten Opiumkrieg (inklusive Arrow-Zwischenfall), den Vertrag von Nanking und Tianjin, und die chinesische Wahrnehmung der „Ungleichen Verträge“. Die Analyse beinhaltet auch die Perspektive von Karl Marx.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, China zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Das Ende des ersten Opiumkrieges und der Vertrag von Nanking, Der Arrow-Zwischenfall und der Vertrag von Tianjin, und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert die Zielsetzung und These der Arbeit (Freihandelsimperialismus und die Gerechtigkeit der Bezeichnung „Ungleiche Verträge“), und stellt die Quellenlage kurz vor, wobei der Fokus auf dem Vertrag von Nanking liegt.
Wie wird China zu Beginn des 19. Jahrhunderts dargestellt?
Kapitel 2 beschreibt die Situation Chinas unter der Qing-Dynastie, einschließlich militärischer und politischer Stärke, Herausforderungen (Bevölkerungswachstum, Umweltprobleme, Ineffizienz des Staates), und die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Regierung im Kontext des wirtschaftlichen Wachstums und des bevorstehenden Opiumkriegs. Der Handel mit dem Westen und das Kanton-System werden ebenfalls behandelt.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels über den ersten Opiumkrieg und den Vertrag von Nanking?
Kapitel 3 analysiert das Ende des ersten Opiumkriegs und den Vertrag von Nanking. Es integriert die chinesische Perspektive durch ein Zeitzeugendokument aus Chinkiang und arbeitet die Auswirkungen und Bedeutung des Vertrags für die chinesische Geschichtsschreibung heraus.
Was wird im Kapitel über den Arrow-Zwischenfall und den Vertrag von Tianjin behandelt?
Kapitel 4 befasst sich mit dem Arrow-Zwischenfall, dem Vertrag von Tianjin, und dem „zweiten Opiumkrieg“. Es integriert Karl Marx' Analyse und konzentriert sich auf die Folgen und langfristigen Auswirkungen dieser Verträge auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und China.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Opiumkrieg, Ungleiche Verträge, Freihandelsimperialismus, Qing-Dynastie, Vertrag von Nanking, Vertrag von Tianjin, Großbritannien, China, Imperialismus, Karl Marx, Chinesische Perspektive.
- Quote paper
- Gregory Brandl (Author), 2008, Der Opiumkrieg und seine Verträge im Kontext des Freihandelsimperialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/91600