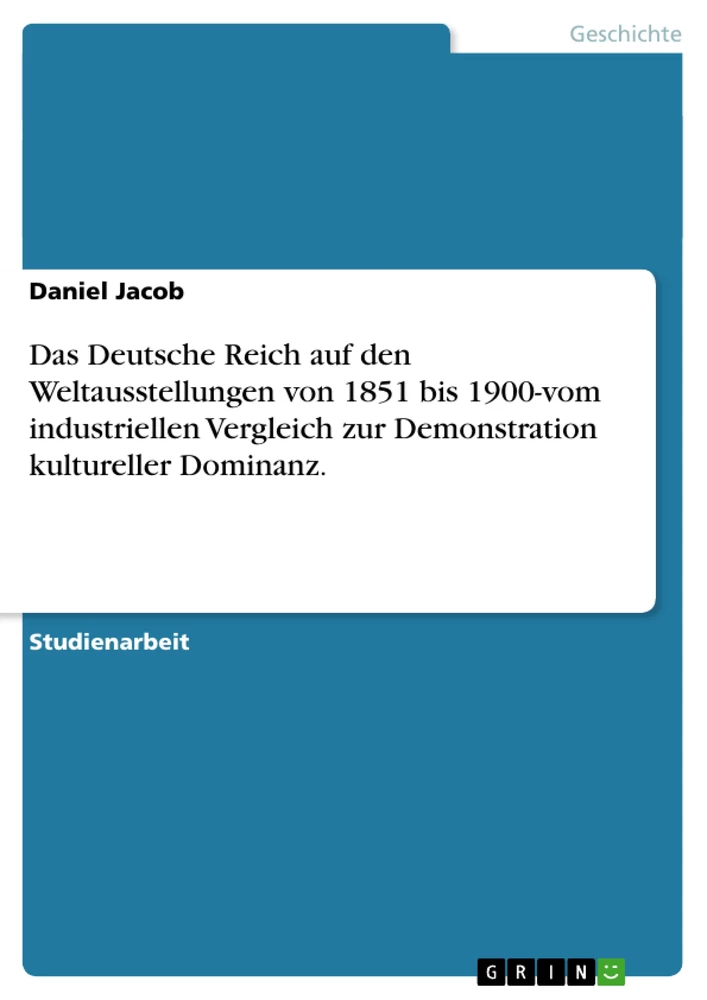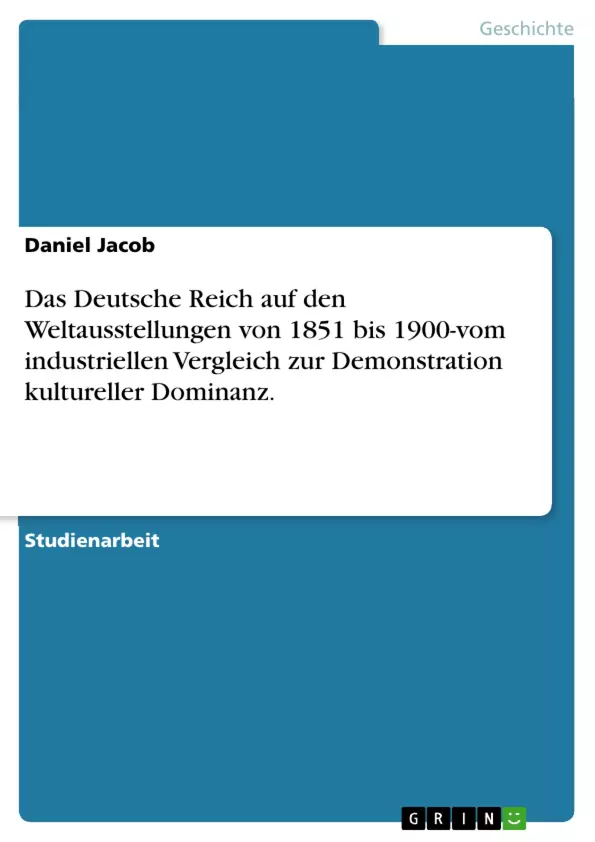Ziel meiner Arbeit ist es,zu zeigen,wie sich die Präsentation Deutschlands auf den zehn großen Weltausstellungen von 1851 bis 1900 veränderte und deutlich zu machen, auf welche Ursachen
dies zurückzuführen ist. Wie kam es, dass die Deutschen auf den ersten Weltausstellungen noch ein Schattendasein fristeten, jedoch gegen Ende des Jahrhunderts, auf dieser Bühne, nicht nur nati-onale Größe, sondern schließlich sogar eine Überlegenheit der eigenen Kultur zu demonstrieren versuchten? Zur Beantwortung dieser Frage sollen etwa die Bedeutung der Reichsgründung, Einflüsse des Zeitgeistes und die Gegebenheiten in den internationalen Beziehungen näher untersucht werden. Das Hauptinteresse liegt also auf der politischen Repräsentation der Deutschen, weshalb andere Aspekte der Weltausstellungsgeschichte hier vernachlässigt werden.
Bei der Betrachtung des Untersuchungszeitraumes werde ich weitgehend chronologisch vorgehen.
Nach einem kurzen Überblick über die Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts steht zuerst die Präsentation der deutschen Länder auf den ersten vier Weltausstellungen im Mittelpunkt. Danach soll untersucht werden, inwieweit die Reichsgründung von 1871 die Präsentation der Deutschen beeinflusst hat. Schließlich sollen die Gründe für das Fernbleiben von den Pariser Weltausstellungen 1878 und 1889 und die erfolgreichen Präsentationen auf den letzten beiden Weltausstellungen des Jahrhunderts in Chicago und Paris näher betrachtet werden.
[...]
Zur Frage der politischen Repräsentation, welche lange Zeit vernachlässigt worden ist, sind die relativ neuen Arbeiten von Eckhardt Fuchs und Christoph Cornelißen von Bedeutung, auf die sich meine Argumentation daher hauptsächlich stützen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Weltausstellungen im 19. Jahrhundert
- Die deutschen Länder auf den Weltausstellungen bis 1867
- Die Reichsgründung und ihre Auswirkung auf die deutsche Präsentation
- Das Fernbleiben des Reiches von den beiden Pariser Weltausstellungen 1878 und 1889
- „Deutsche Siege“ in Chicago und Paris
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der deutschen Präsentation auf den Weltausstellungen zwischen 1851 und 1900. Das Ziel ist es, die Veränderung der deutschen Selbstinszenierung von einem anfänglichen Schattendasein bis hin zum Versuch, kulturelle Dominanz zu demonstrieren, aufzuzeigen und die Ursachen hierfür zu analysieren.
- Die Entwicklung der deutschen Beteiligung an Weltausstellungen im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss der Reichsgründung auf die deutsche Präsentation
- Der Vergleich der deutschen Präsentation mit der anderer Großmächte
- Die Rolle der Weltausstellungen als Bühne nationaler Selbstdarstellung
- Die Bedeutung der Weltausstellungen für das nationale Selbstverständnis Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit anhand eines Zitats von Carl Schurz über die deutsche Präsentation auf der Weltausstellung 1893 in Chicago. Sie skizziert die Forschungsfrage – die Entwicklung der deutschen Präsentation auf Weltausstellungen von 1851 bis 1900 – und die methodische Vorgehensweise, die eine chronologische Betrachtung des Untersuchungszeitraumes umfasst. Der aktuelle Forschungsstand wird kurz erwähnt, wobei die Arbeiten von Wörner, Fuchs und Cornelißen als besonders relevant hervorgehoben werden.
1. Weltausstellungen im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Geschichte der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert. Es betont deren Bedeutung als kulturelle Massenveranstaltungen und als Forum für die Präsentation technologischer, wissenschaftlicher und kultureller Leistungen, aber auch als Schauplatz nationaler Machtdemonstration. Die Entwicklung von einem anfänglichen Ideal des Völkerverständigungsgedankens hin zu einem zunehmenden Wettkampf um nationales Prestige wird nachgezeichnet, unter Berücksichtigung wichtiger Ausstellungen in London, Paris, Wien und Philadelphia.
2. Die deutschen Länder auf den Weltausstellungen bis 1867: Dieses Kapitel analysiert die vergleichsweise unbedeutende Rolle der deutschen Länder auf den ersten vier Weltausstellungen. Es führt die mangelnde Einheit Deutschlands und die wirtschaftliche Rückständigkeit gegenüber Großbritannien und Frankreich als Ursachen für das schwache Auftreten an. Im Gegensatz dazu wird die erfolgreiche Selbstinszenierung Großbritanniens als "Werkstatt der Welt" mit seinen umfangreichen Kolonialexponaten herausgestellt, die ein starkes nationales Selbstverständnis demonstrierten. Die deutschen Präsentationen mangelten an diesem Selbstbewusstsein.
Schlüsselwörter
Weltausstellungen, Deutsches Reich, Nationales Selbstverständnis, Reichsgründung, Industrieproduktion, kulturelle Dominanz, politische Repräsentation, internationale Beziehungen, Nationales Prestige, Wirtschaftsmacht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur deutschen Präsentation auf Weltausstellungen (1851-1900)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der deutschen Präsentation auf Weltausstellungen zwischen 1851 und 1900. Sie analysiert den Wandel der deutschen Selbstinszenierung von einem anfänglichen Schattendasein zu dem Versuch, kulturelle Dominanz zu demonstrieren, und untersucht die Ursachen hierfür.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der deutschen Beteiligung an Weltausstellungen, den Einfluss der Reichsgründung auf die deutsche Präsentation, einen Vergleich mit anderen Großmächten, die Rolle der Weltausstellungen als Bühne nationaler Selbstdarstellung und die Bedeutung der Weltausstellungen für das nationale Selbstverständnis Deutschlands.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu den Weltausstellungen im 19. Jahrhundert allgemein, der deutschen Präsentation bis 1867, dem Einfluss der Reichsgründung, dem Fernbleiben von den Pariser Ausstellungen 1878 und 1889, "deutschen Siegen" in Chicago und Paris und einem abschließenden Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Periode.
Wie wird die deutsche Präsentation vor der Reichsgründung beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die deutsche Präsentation vor 1867 als vergleichsweise unbedeutend, geprägt von der mangelnden Einheit Deutschlands und wirtschaftlicher Rückständigkeit gegenüber Ländern wie Großbritannien und Frankreich. Im Gegensatz dazu wird die erfolgreiche Selbstinszenierung Großbritanniens als "Werkstatt der Welt" hervorgehoben.
Welchen Einfluss hatte die Reichsgründung?
Die Reichsgründung hatte einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Präsentation auf Weltausstellungen. Die Arbeit analysiert diesen Einfluss im Detail und untersucht, wie sich die deutsche Selbstinszenierung nach der Reichsgründung veränderte.
Wie wird die Rolle der Weltausstellungen dargestellt?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Weltausstellungen als kulturelle Massenveranstaltungen und Foren für die Präsentation technologischer, wissenschaftlicher und kultureller Leistungen, aber auch als Schauplätze nationaler Machtdemonstration und des Wettbewerbs um nationales Prestige.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Weltausstellungen, Deutsches Reich, Nationales Selbstverständnis, Reichsgründung, Industrieproduktion, kulturelle Dominanz, politische Repräsentation, internationale Beziehungen, Nationales Prestige und Wirtschaftsmacht.
Welche Quellen werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt die Arbeiten von Wörner, Fuchs und Cornelißen als besonders relevant für den aktuellen Forschungsstand.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine chronologische Betrachtung des Untersuchungszeitraums (1851-1900) um die Entwicklung der deutschen Präsentation auf Weltausstellungen zu analysieren.
Wo finde ich die Einleitung?
Die Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit, die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise. Ein Zitat von Carl Schurz über die deutsche Präsentation auf der Weltausstellung 1893 in Chicago dient als Ausgangspunkt.
- Arbeit zitieren
- Daniel Jacob (Autor:in), 2002, Das Deutsche Reich auf den Weltausstellungen von 1851 bis 1900-vom industriellen Vergleich zur Demonstration kultureller Dominanz., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9133