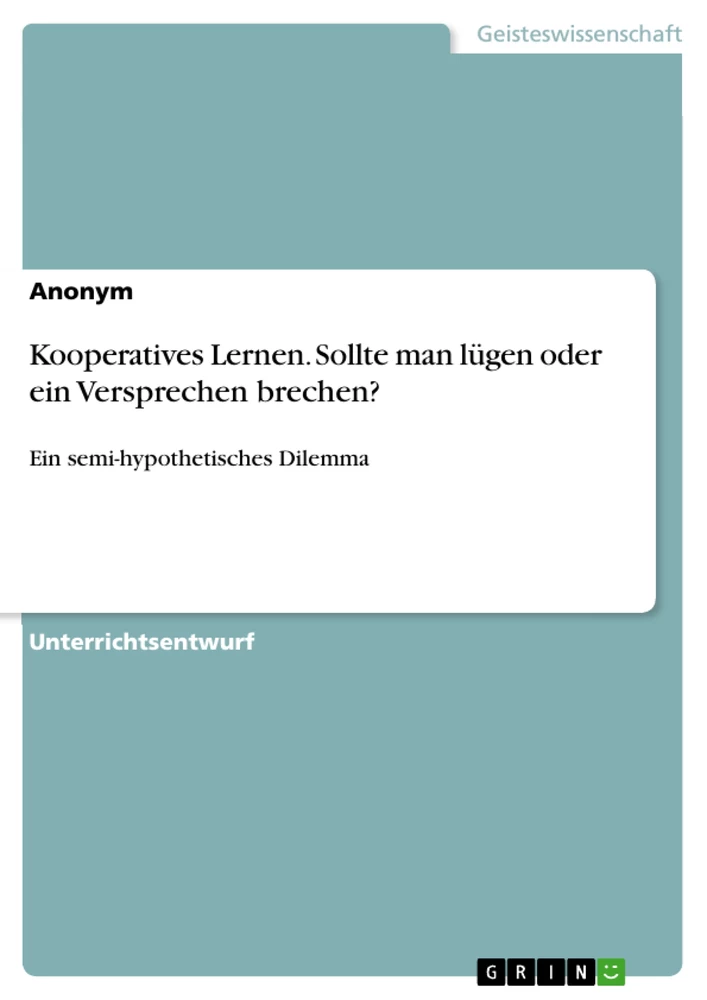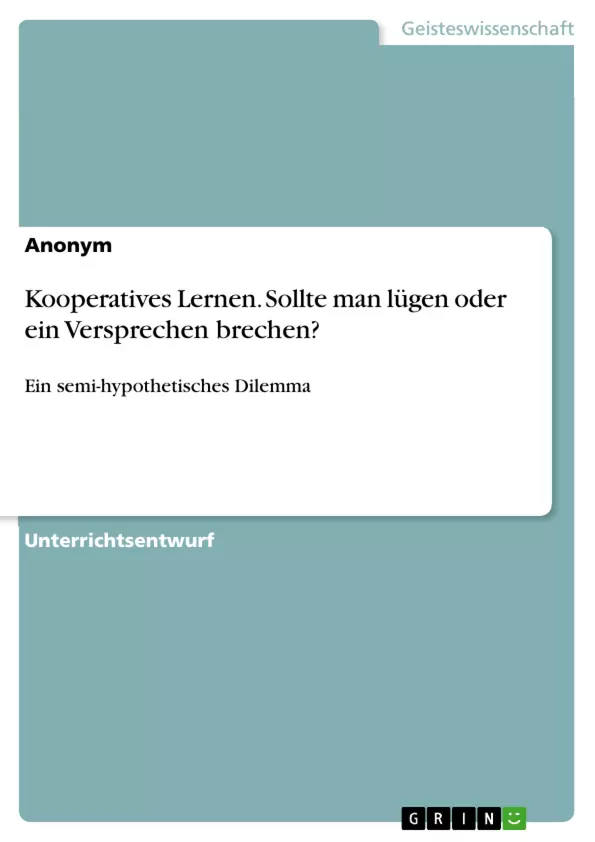Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern einen besseren Umgang mit Konflikten beizubringen. Im Fokus steht dabei die Auseinandersetzung mit inter- und intrapersonellen Konfliktsituationen mit Hinblick auf Ursachen, Folgen und der Lösung von Konflikten.
Schulen haben vor dem Hintergrund des Bildungs- und Erziehungsauftrages nach §2 des Schulgesetzes unter anderem die Aufgabe, Schüler zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Handeln zu erziehen. Schulen haben außerdem die
Aufgabe, Schüler und Schülerinnen dazu zu befähigen, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Dazu ist es unerlässlich, dass die Schüler und Schülerinnen lernen, sich in Konfliktsituationen rational zu verhalten und Achtsamkeit und Toleranz gegenüber der Wahrnehmung, den Gefühlen und den Meinungen anderer Menschen zu entwickeln. In pluralistischen Gesellschaften kann hier im Bereich der Werteerziehung kein allgemeingültiger Konsens im Bezug auf Werte und Normen vorausgesetzt werden, den die Schüler und Schülerinnen nur noch in sich aufnehmen müssen. Gerade der Dissens über verschiedene Wert- und Normvorstellungen führt im Gegenteil häufig zu Konflikten.
Die Werteerziehung in pluralistischen Gesellschaften baut daher darauf auf, die Schüler und Schülerinnen durch eine Förderung der ethischen, moralischen und auch politischen Urteilskompetenz zu mündigen Bürgern mit einer autonomen Urteilsfähigkeit zu erziehen und ihnen dadurch zu ermöglichen, an der gesellschaftlichen Willensbildung selbstbestimmt zu partizipieren. Gerade die Lebensphase der Adoleszenz ist unter anderem geprägt durch das Hinterfragen elterlicher und gesellschaftlicher Wertmaßstäbe und Rollenmuster sowie von Konflikten mit Gleichaltrigen im Spannungsverhältnis von zunehmender Freiheit und Verantwortung.
Inhaltsverzeichnis
- Leitgedanken und Intentionen
- Curriculare Legitimation
- Kompetenzschwerpunkte
- Tabellarische Darstellung der Unterrichtsreihe
- Wie kommt es zu Konflikten? Erstellung und Reflexion einer ,,Hitliste von Provokationen“ in kooperativem Lernen sowie Erarbeitung des Eisbergmodells und Anwendung auf selbstgewählte Fallbeispiele.
- Wie können Konflikte eskalieren? Erarbeitung des Modells: ,,Eskalationsspirale“ und Anwendung auf die Geschichte „,Ärger beim Fußball\" in kooperativem Lernen.
- Meine Wahrheit - deine Wahrheit? Reflexion der Perspektivenabhängigkeit von Wahrnehmung und Anwendung auf selbstgewählte Fallbeispiele
- Wie können wir die Gefühle anderer Menschen besser wahrnehmen? Spielerische Förderung der Wahrnehmungskompetenz und Anwendung auf die Bedeutung der Wahrnehmung von Emotionen bei Konflikten
- Sollte man einen Mitschüler verraten, der sich nicht an der Gruppenarbeit beteiligt? Erarbeitung der Dilemma-Methode anhand eines semi-hypothetischen Dilemmas und Erarbeitung intuitiver Pro- und Kontraargumente in kooperativem Lernen.
- Sollte man die Unterschrift seiner Eltern fälschen, damit die Klasse ins Kino gehen kann? Dilemma-Diskussion anhand eines semi-hypothetischen Dilemmas und Erstellen einer veranschaulichenden Grafik in kooperativem Lernen.
- Sollte man lügen, oder ein Versprechen brechen? Erarbeitung und Bewertung von intuitiven Pro- und Kontraargumenten auf der Grundlage eines semi-hypothetischen Dilemmas und Erstellung einer veranschaulichenden Grafik in kooperativem Lernens.
- Welche Wege gibt es zur Versöhnung? Reflexion und Bewertung verschiedener Formen der Versöhnung.
- Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- Stunden und Teilziele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit Konflikten zu fördern und ihnen die notwendigen Fähigkeiten zum konstruktiven Umgang mit inter- und intrapersonellen Konflikten zu vermitteln. Die Reihe verfolgt dabei einen additiven und abstrahierenden Aufbau, der auf Erfahrungen aus der Lerngruppe basiert. Die Schüler und Schülerinnen lernen verschiedene Konflikttypen kennen und befassen sich mit den Ursachen, Folgen und möglichen Lösungen. Dabei werden Methoden des kooperativen Lernens eingesetzt, um die Entwicklung sozialer Kompetenzen zu fördern.
- Konflikttypen und -ursachen
- Konfliktlösung und Versöhnung
- Perspektivenabhängigkeit von Wahrnehmung
- Ethische und moralische Dilemmata
- Kooperatives Lernen und soziale Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die erste Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit der Entstehung von Konflikten. Die Schüler und Schülerinnen erstellen eine "Hitliste der Provokationen" und lernen das Eisbergmodell kennen, um die Ursachen von Konflikten besser zu verstehen.
- Die zweite Einheit thematisiert die Eskalation von Konflikten und verwendet das Modell der "Eskalationsspirale" zur Analyse von Konfliktverläufen.
- In der dritten Einheit wird die Perspektivenabhängigkeit von Wahrnehmung reflektiert und in Bezug auf selbstgewählte Fallbeispiele angewendet.
- Die vierte Einheit fokussiert auf die Wahrnehmung von Emotionen im Kontext von Konflikten und fördert die Wahrnehmungskompetenz der Schüler und Schülerinnen.
- Die fünfte Einheit stellt das Dilemma "Sollte man einen Mitschüler verraten, der sich nicht an der Gruppenarbeit beteiligt?" vor und die Schülerinnen und Schüler erarbeiten intuitive Pro- und Kontraargumente in kooperativem Lernen.
- Die sechste Einheit beschäftigt sich mit dem Dilemma "Sollte man die Unterschrift seiner Eltern fälschen, damit die Klasse ins Kino gehen kann?" und visualisiert die Argumente in einer Grafik.
Schlüsselwörter
Die Unterrichtsreihe beschäftigt sich mit dem Thema Konflikte, insbesondere im Kontext von inter- und intrapersonellen Konfliktsituationen. Wichtige Schlüsselwörter sind: Konfliktlösung, Versöhnung, Wahrnehmung, Perspektivenabhängigkeit, Dilemma, ethische und moralische Fragen, kooperatives Lernen und soziale Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Unterrichtsreihe zum kooperativen Lernen?
Ziel ist es, Schülern den konstruktiven Umgang mit inter- und intrapersonellen Konflikten zu vermitteln und ihre ethisch-moralische Urteilskompetenz zu fördern.
Was erklärt das „Eisbergmodell“ im Kontext von Konflikten?
Es verdeutlicht, dass bei Konflikten oft nur ein kleiner Teil (Sachebene) sichtbar ist, während die tieferliegenden Ursachen (Gefühle, Werte) verborgen bleiben.
Welche Rolle spielt die Dilemma-Methode im Unterricht?
Anhand von Beispielen wie „Lügen oder Versprechen brechen“ lernen Schüler, Pro- und Kontra-Argumente abzuwägen und selbstständig moralische Entscheidungen zu treffen.
Was versteht man unter der „Eskalationsspirale“?
Dieses Modell zeigt auf, wie kleine Provokationen stufenweise zu massiven Konflikten führen können, und hilft Schülern, solche Verläufe frühzeitig zu erkennen.
Warum wird kooperatives Lernen in dieser Reihe eingesetzt?
Es fördert soziale Kompetenzen, da Schüler gemeinsam an Lösungen arbeiten und lernen, die Perspektiven anderer wahrzunehmen und zu respektieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Kooperatives Lernen. Sollte man lügen oder ein Versprechen brechen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/909631