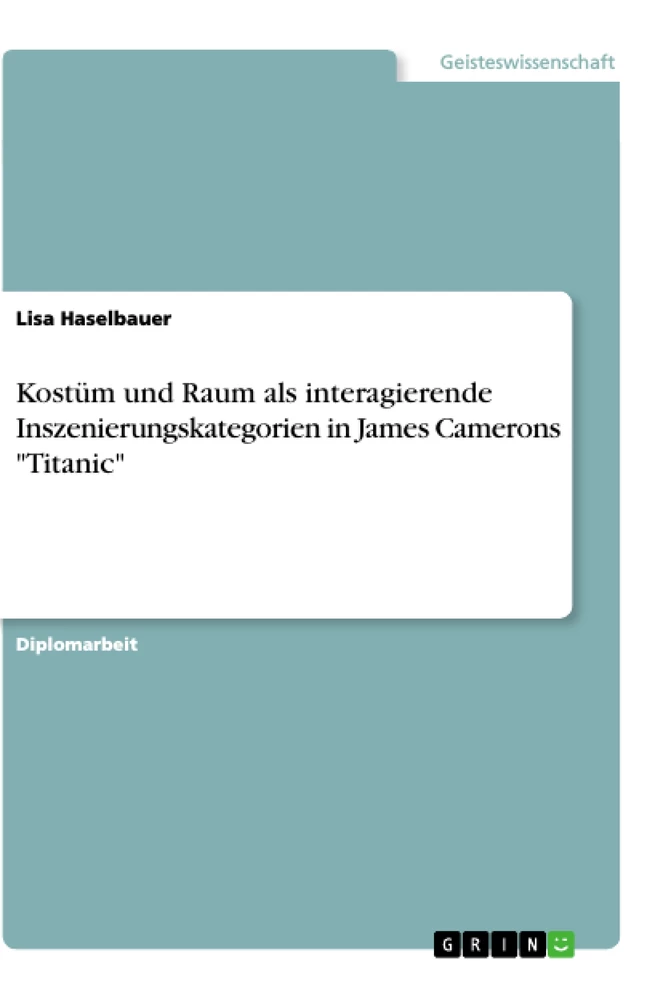Die vorliegende Arbeit stellt Thesen sowie Beobachtungen vor, wie sich Kostüm und Raum als Zeichenkategorien inszenierter Vorgänge zueinander verhalten. Im ersten Teil wird das Kostüm als räumliches Hilfsmittel des Darstellers betrachtet und damit einhergehende Aspekte erläutert, die die Körperlichkeit des Materials, die Raumbildung um den Körper des Tragenden und die Qualitäten eines sogenannten „Kostümraums“ betreffen. Anschließend richtet sich der Fokus auf die Wechselbeziehung beider Kategorien, die sich konkret in Designelementen und Kompositionprinzipien ausdrückt. Ein zweiter Teil ist der Analyse des filmischen Beispiels Titanic (1997) von James Cameron gewidmet. Das Kostümdesign ist dabei mit der Herausforderung konfrontiert, jenseits historischer Korrektheit eine fiktive Geschichte, die Heldenreise der Protagonistin zu erzählen und illustrieren. Diese in eine räumliche begrenzte Lokalität – das Schiff – zu übertragen sorgt für einen hinreichend interessanten Kontext und eine faszinierende Interdependenz der zwei Inszenierungskategorien, die anhand der beiden Hauptfiguren aufgezeigt werden.
Der Raum oder das Kostüm kann aus sehr verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und bewertet werden. In einer Inszenierung – und damit sind sämtliche theatrale Momente, die ein Kostüm produzieren, eingeschlossen – interagieren jedoch zwangsläufig mindestens zwei, meist mehrere Zeichenkategorien miteinander. Daher ist es von größter Wichtigkeit, diese Kategorien in Beziehung zueinander zu setzen und nicht ausschließlich getrennt voneinander zu analysieren. Durch ihre ihnen zugrunde liegende Funktion, Bedeutung zu generieren einerseits, und die Tatsache, dass innerhalb einer Inszenierung mehrere Kategorien zusammenwirken, rekurrieren Zeichen nicht nur auf sich selbst, sondern strahlen gewissermaßen in andere Zeichenkonglomerate hinein und erzeugen eine Bedeutungsebene, die weder von der einen, noch der anderen Zeichenkategorie allein hervorgebracht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I
- 1. Einleitung
- 2. Kostüm als raumkonstituierendes Hilfsmittel des Darstellers
- 2.1. Definition Kostüm
- 2.2. Textile Komposition
- 2.2.1. Materialfunktion
- 2.2.2. Schnittkonstruktion
- 2.2.3. Formgebung
- 2.3. Qualität des physischen Kostümraums
- 2.3.1. Kontrahierend - expandierend
- 2.3.2. Statisch - dynamisch
- 2.4. Kostümraum und Kinesphäre
- 3. Raum und Kostüm als interagierende Inszenierungskategorien
- 3.1. Funktionen von Kostüm und Raum im theatralischen Code
- 3.2. Visuelle Designelemente
- 3.2.1. Prinzipien der Komposition
- 3.2.2. Licht und Farbe
- 3.3. Beziehungsprinzipien zwischen Kostüm und Raum
- 4. Untersuchungsgegenstand Titanic
- 4.1. Das Schiff: Zeitkapsel edwardianischer Opulenz
- 4.1.1. Menschengemachte Hybris
- 4.1.2. Multiperspektivische Räumlichkeit
- 4.1.3. Titanic als Heterotopie
- 5. Figurenpersonal
- 6. Jack Dawson
- 6.1. Assimilation als Lebens- und Kleidungsstrategie
- 6.2. Symbolische Markierung der Räume: Freiheit
- 6.3. Enthüllung als Rettungstaktik
- 6.4. Werdegang eines Fracks
- 6.4.1. Mimikry der Oberschicht
- 6.4.2. Dekonstruktion des Kostümraums
- 6.5. Raumnutzung durch Verkleidung
- 7. Rose Dewitt Bukater
- 7.1. Das Butterfly-Motiv
- 7.2. Markierung der Räume: Gefangenschaft und Niedergang
- 7.3. Reiseensemble: Verbildlichung emotionaler Befindlichkeit
- 7.4. Gegensätzliche Abendkleider
- 7.4.1. Überlebenskampf zwischen zwei Farbräumen
- 7.4.2. Entdeckung textilen Freiraums
- 7.5. Die blaue Phase der Selbstfindung
- 7.5.1. Metamorphose
- 7.5.2. Entfaltung des neuen Selbst
- 8. Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Interaktion von Kostüm und Raum als Inszenierungskategorien in James Camerons Film "Titanic". Ziel ist es, die wechselseitige Beeinflussung und Bedeutungsproduktion dieser beiden Elemente aufzuzeigen und zu analysieren, wie sie zur Erzählung der Geschichte und Charakterentwicklung beitragen. Die Arbeit geht über eine rein deskriptive Analyse hinaus und befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des theatralischen Codes.
- Kostüm als raumkonstituierendes Element
- Interaktion von Kostüm und Raum im filmischen Kontext
- Bedeutungsproduktion durch visuelle Designelemente
- Charakterentwicklung durch Kostüm und Raum
- Analyse von "Titanic" als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Interaktion von Kostüm und Raum als Inszenierungskategorien ein. Sie verweist auf die Aussage von Francis Ford Coppola über die enge Beziehung zwischen Kostüm und Setdesign und begründet die Notwendigkeit, diese Kategorien nicht isoliert, sondern in ihrem wechselseitigen Bezug zu analysieren. Die Arbeit wird als Beitrag zur Erforschung der Bedeutungsproduktion durch die Interaktion von Zeichenkategorien im theatralischen Code vorgestellt und skizziert den Aufbau der Arbeit, der aus einem theoretischen Teil und einer Filmanalyse von "Titanic" besteht.
2. Kostüm als raumkonstituierendes Hilfsmittel des Darstellers: Dieses Kapitel untersucht das Kostüm aus der Perspektive seiner räumlichen Funktion. Es definiert den Begriff "Kostüm" und analysiert die textile Komposition (Material, Schnitt, Formgebung) in Bezug auf die Raumbildung um den Körper des Trägers. Die "Qualität des physischen Kostümraums" wird in Bezug auf seine Ausdehnung und Dynamik (kontrahierend/expandierend, statisch/dynamisch) betrachtet und in Beziehung zur Kinesphäre des Darstellers gesetzt.
3. Raum und Kostüm als interagierende Inszenierungskategorien: Dieses Kapitel fokussiert auf die Wechselbeziehung von Kostüm und Raum. Es analysiert die Funktionen beider Kategorien im theatralischen Code, untersucht visuelle Designelemente wie Kompositionsprinzipien und die Wirkung von Licht und Farbe, und beschreibt die Beziehungsprinzipien zwischen Kostüm und Raum in der Inszenierung.
4. Untersuchungsgegenstand Titanic: Dieses Kapitel stellt den Film "Titanic" als Untersuchungsgegenstand vor. Es charakterisiert das Schiff als "Zeitkapsel edwardianischer Opulenz" und analysiert seine räumlichen Eigenschaften, insbesondere seine multiperspektivische Räumlichkeit und seine Funktion als Heterotopie. Dieses Kapitel dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, die die Kostümgestaltung der Hauptfiguren analysieren.
5. Figurenpersonal: Dieses Kapitel dient als Einleitung zu den Kapiteln über die Hauptfiguren Jack und Rose. Es bereitet den Leser auf die detaillierte Analyse der Kostüme und ihrer Interaktion mit dem Raum vor.
6. Jack Dawson: Dieses Kapitel analysiert die Kostüme von Jack Dawson und ihre Bedeutung für seine Charakterentwicklung. Es untersucht seine Kleidungsstrategien, die symbolische Markierung von Räumen durch seine Kleidung und wie seine Kleidung seine Raumnutzung beeinflusst. Der Fokus liegt insbesondere auf der Entwicklung seines Kostüms im Laufe des Films und den damit verbundenen symbolischen Veränderungen.
7. Rose Dewitt Bukater: Dieses Kapitel widmet sich den Kostümen von Rose Dewitt Bukater und untersucht den Einfluss der Kleidung auf die Darstellung ihrer emotionalen Entwicklung und ihrer Beziehung zum Raum. Das "Butterfly-Motiv", die symbolische Markierung verschiedener Räume (Gefangenschaft, Freiheit), und die Bedeutung ihrer Kleiderwahl in Bezug auf ihre Selbstfindung werden detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Kostüm, Raum, Inszenierung, theatralischer Code, James Cameron, Titanic, Filmkostüm, Charakterentwicklung, visuelle Gestaltung, Bedeutungsproduktion, Textildesign, Räumliche Semiotik, Heterotopie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Kostüm und Raum in James Camerons "Titanic"
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Interaktion von Kostüm und Raum als Inszenierungskategorien in James Camerons Film "Titanic". Sie analysiert die wechselseitige Beeinflussung und Bedeutungsproduktion dieser Elemente und deren Beitrag zur Erzählung und Charakterentwicklung.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit geht über eine rein deskriptive Analyse hinaus und befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des theatralischen Codes. Sie betrachtet das Kostüm als raumkonstituierendes Element und analysiert die Bedeutungsproduktion durch visuelle Designelemente wie Kompositionsprinzipien und die Wirkung von Licht und Farbe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einem theoretischen Teil und einer Filmanalyse von "Titanic". Sie beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Der theoretische Teil untersucht das Kostüm als raumkonstituierendes Element und die Interaktion von Kostüm und Raum im filmischen Kontext. Der Hauptteil analysiert die Kostüme der Hauptfiguren Jack und Rose und deren Beziehung zum Raum im Film.
Welche Aspekte des Kostüms werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die textile Komposition des Kostüms (Material, Schnitt, Formgebung) und deren Einfluss auf die Raumbildung um den Körper. Sie betrachtet die "Qualität des physischen Kostümraums" in Bezug auf Ausdehnung und Dynamik (kontrahierend/expandierend, statisch/dynamisch) und deren Beziehung zur Kinesphäre des Darstellers.
Welche Rolle spielt der Raum im Film?
Der Film "Titanic" wird als Untersuchungsgegenstand betrachtet, wobei das Schiff als "Zeitkapsel edwardianischer Opulenz", mit multiperspektivischer Räumlichkeit und als Heterotopie analysiert wird. Die Arbeit untersucht, wie der Raum die Charaktere beeinflusst und wie die Kostüme die Raumnutzung der Figuren markieren.
Wie werden die Hauptfiguren Jack und Rose analysiert?
Die Analyse der Hauptfiguren Jack und Rose fokussiert auf die Bedeutung ihrer Kostüme für die Charakterentwicklung. Es werden Kleidungsstrategien, symbolische Raummarkierungen durch Kleidung und die Beeinflussung der Raumnutzung durch die Kostüme untersucht. Für Rose wird das "Butterfly-Motiv" und die Bedeutung ihrer Kleiderwahl in Bezug auf ihre Selbstfindung analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kostüm, Raum, Inszenierung, theatralischer Code, James Cameron, Titanic, Filmkostüm, Charakterentwicklung, visuelle Gestaltung, Bedeutungsproduktion, Textildesign, Räumliche Semiotik, Heterotopie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kostüm als raumkonstituierendes Hilfsmittel, Raum und Kostüm als interagierende Inszenierungskategorien, Untersuchungsgegenstand Titanic, Figurenpersonal, Jack Dawson, Rose Dewitt Bukater und Resumée. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die wechselseitige Beeinflussung und Bedeutungsproduktion von Kostüm und Raum in "Titanic" aufzuzeigen und zu analysieren, wie diese Elemente zur Erzählung und Charakterentwicklung beitragen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Arbeit enthält eine detaillierte Analyse der oben genannten Punkte und bietet einen umfassenden Einblick in die Interaktion von Kostüm und Raum in James Camerons "Titanic".
- Arbeit zitieren
- Lisa Haselbauer (Autor:in), 2020, Kostüm und Raum als interagierende Inszenierungskategorien in James Camerons "Titanic", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/906374