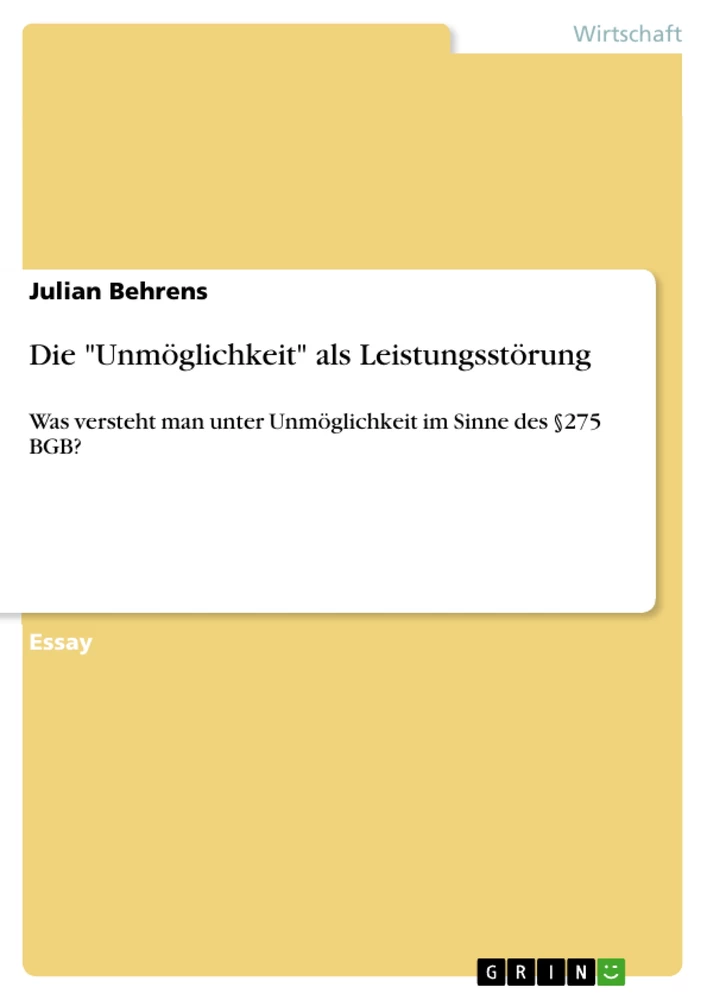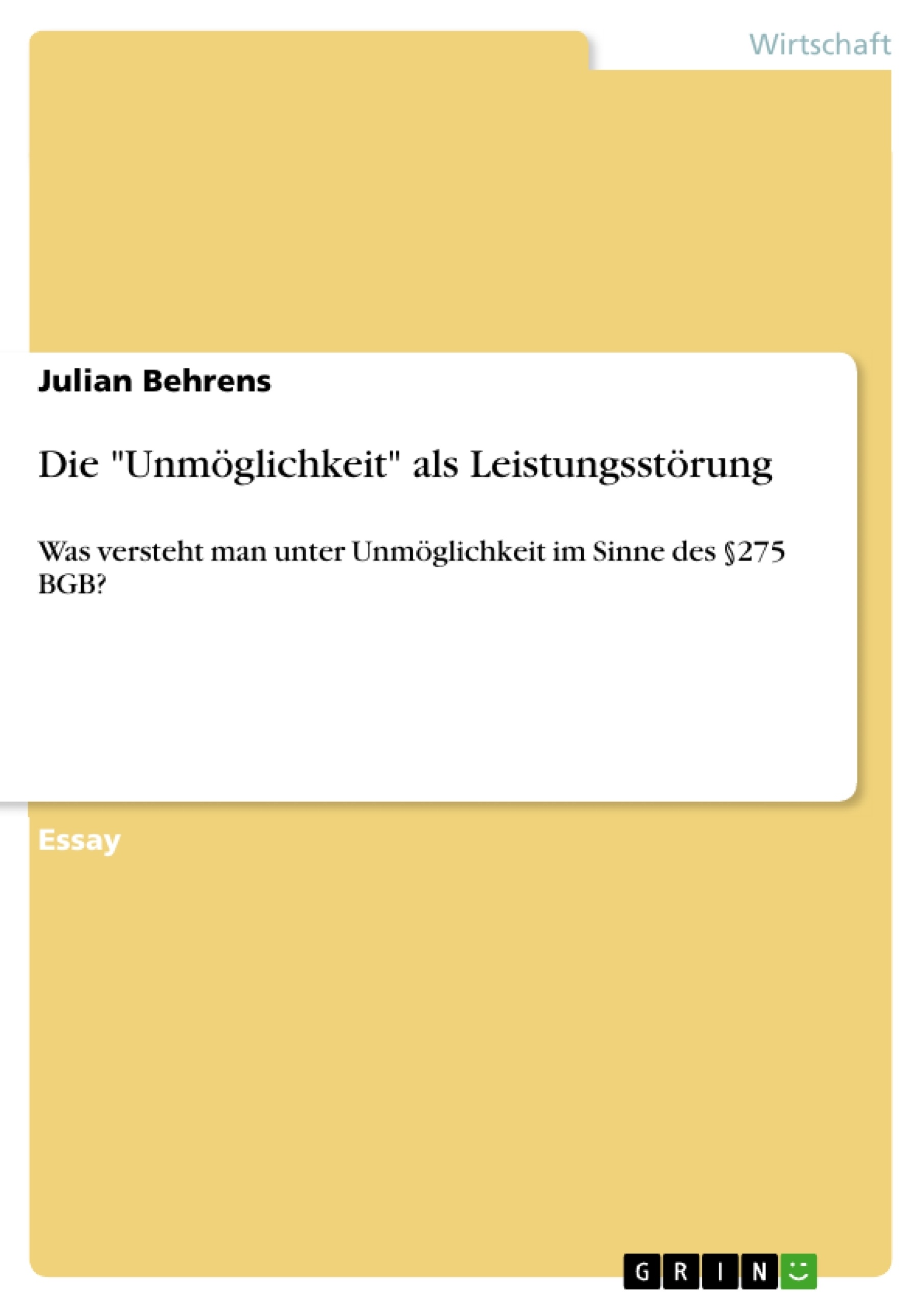Das Ziel dieser Arbeit besteht in der umfassenden Analyse und Untersuchung des Konzepts der Unmöglichkeit im Kontext des §275 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Der Fokus liegt auf einem tieferen Verständnis für die Unmöglichkeit als eine der bedeutendsten Formen der Leistungsstörung im deutschen Schuldrecht.
Die Analyse beginnt mit der Klärung des Begriffs "Unmöglichkeit" im Sinne des §275 BGB. Dabei wird die Definition der Unmöglichkeit als die dauerhafte Nichterbringbarkeit des Leistungserfolgs durch die Leistungshandlung des Schuldners erläutert. Die Unmöglichkeit tritt zum Zeitpunkt ein, in dem das Leistungshindernis auftritt.
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den verschiedenen Arten von Schuldverhältnissen und ihren Auswirkungen auf die Unmöglichkeit. Hierbei wird die Unterscheidung zwischen Stückschuld und Gattungsschuld genauer beleuchtet, da die Art der Schuld einen erheblichen Einfluss darauf hat, wann und unter welchen Bedingungen Unmöglichkeit auftreten kann. Bei der Stückschuld schuldet der Schuldner einen bestimmten, individuell bestimmten Gegenstand, während bei der Gattungsschuld mehrere erfüllungstaugliche Gegenstände existieren.
Die Unterscheidung zwischen Unmöglichkeit nach §275 I, §275 II und §275 III BGB wird in dieser Arbeit ebenfalls detailliert analysiert. Dies ist von großer Bedeutung, da die verschiedenen Fallkonstellationen der Unmöglichkeit im deutschen Schuldrecht unterschiedliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Schließlich werden die Rechtsfolgen der Unmöglichkeit erörtert und die Frage geklärt, ob bei Unmöglichkeit der Leistung eine Gegenleistungspflicht besteht. Durch diese umfassende Untersuchung der Unmöglichkeit im deutschen Schuldrecht sollen die komplexen Aspekte dieses Rechtsinstituts verdeutlicht und ein besseres Verständnis für seine Anwendung und Bedeutung geschaffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 BGB?
- Welche Arten der Schuld werden unterschieden?
- Stückschuld
- Gattungsschuld
- Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 I BGB?
- Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 II BGB?
- Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 III BGB?
- Was ist die Rechtsfolge der Unmöglichkeit?
- Besteht eine Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit der Leistung?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Thema der Unmöglichkeit als Leistungsstörung im Kaufrecht, insbesondere im Kontext des §275 BGB. Ziel ist es, das Verständnis von Unmöglichkeit zu klären, die verschiedenen Arten der Schuld zu differenzieren und die Rechtsfolgen im Falle von Unmöglichkeit zu erläutern.
- Definition und Abgrenzung der Unmöglichkeit nach §275 BGB
- Unterscheidung zwischen Stückschuld und Gattungsschuld
- Analyse der verschiedenen Arten der Unmöglichkeit (objektiv, subjektiv, anfänglich, nachträglich)
- Rechtsfolgen der Unmöglichkeit
- Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Unmöglichkeit als Leistungsstörung im Kaufrecht ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird angekündigt, den Begriff der Unmöglichkeit zu definieren, die Voraussetzungen für eine Leistungsstörung durch Unmöglichkeit zu erläutern und die Rechtsfolgen zu beleuchten.
1. Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 BGB?: Dieses Kapitel definiert Unmöglichkeit als die dauerhafte Nichterbringbarkeit des Leistungserfolgs durch eine Leistungshandlung des Schuldners. Es wird betont, dass der Zeitpunkt des Eintritts des Leistungshindernisses maßgeblich ist. Die Definition verankert sich im §275 BGB und bildet die Grundlage für die weiteren Kapitel.
2. Welche Arten der Schuld werden unterschieden?: Dieses Kapitel differenziert zwischen Stückschuld und Gattungsschuld. Eine Stückschuld liegt vor, wenn ein ganz bestimmter Gegenstand geschuldet wird, während bei einer Gattungsschuld ein nach generalisierenden Merkmalen bestimmter Gegenstand geschuldet wird. Die Unterscheidung ist entscheidend für die Beurteilung der Unmöglichkeit, da bei einer Gattungsschuld die Erfüllung auch dann noch möglich sein kann, wenn einzelne Gegenstände untergegangen sind. Der Abschnitt differenziert zwischen Holschuld, Schickschuld und Bringschuld, erläutert deren jeweilige Charakteristika und die Bedeutung für die Konkretisierung der Leistung.
3. Was versteht man unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 I BGB?: Hier werden die verschiedenen Tatbestände des §275 I BGB erläutert, die die primäre Leistungspflicht des Schuldners entfallen lassen. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen echter Unmöglichkeit (objektiv und subjektiv) und dem Zeitpunkt des Eintritts der Unmöglichkeit (anfänglich oder nachträglich). Die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Unmöglichkeit wird als gleichbedeutend in der Rechtsanwendung dargestellt. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist entscheidend für die Klassifizierung als anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit.
Schlüsselwörter
Unmöglichkeit, Leistungsstörung, Kaufrecht, §275 BGB, Stückschuld, Gattungsschuld, Holschuld, Schickschuld, Bringschuld, objektive Unmöglichkeit, subjektive Unmöglichkeit, anfängliche Unmöglichkeit, nachträgliche Unmöglichkeit, Rechtsfolge.
Häufig gestellte Fragen zu: Unmöglichkeit als Leistungsstörung im Kaufrecht (§275 BGB)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit behandelt die Unmöglichkeit als Leistungsstörung im Kaufrecht, speziell im Kontext von §275 BGB. Sie klärt das Verständnis von Unmöglichkeit, differenziert zwischen verschiedenen Schuldarten und erläutert die Rechtsfolgen bei Unmöglichkeit.
Was wird unter Unmöglichkeit im Sinne des §275 BGB verstanden?
Unmöglichkeit im Sinne des §275 BGB bedeutet die dauerhafte Nichterbringbarkeit des Leistungserfolgs durch eine Leistungshandlung des Schuldners. Der Zeitpunkt des Eintritts des Leistungshindernisses ist entscheidend.
Welche Arten von Schuld werden unterschieden?
Es wird zwischen Stückschuld (ein ganz bestimmter Gegenstand wird geschuldet) und Gattungsschuld (ein nach generalisierenden Merkmalen bestimmter Gegenstand wird geschuldet) unterschieden. Zusätzlich werden Holschuld, Schickschuld und Bringschuld differenziert und deren Bedeutung für die Konkretisierung der Leistung erläutert. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Beurteilung der Unmöglichkeit, da bei einer Gattungsschuld die Erfüllung auch dann noch möglich sein kann, wenn einzelne Gegenstände untergegangen sind.
Welche Arten der Unmöglichkeit nach §275 I BGB werden unterschieden?
Der Text erläutert verschiedene Tatbestände des §275 I BGB, die die primäre Leistungspflicht des Schuldners entfallen lassen. Es wird zwischen echter Unmöglichkeit (objektiv und subjektiv) und dem Zeitpunkt des Eintritts der Unmöglichkeit (anfänglich oder nachträglich) unterschieden. Die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Unmöglichkeit wird als gleichbedeutend in der Rechtsanwendung dargestellt. Der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist entscheidend für die Klassifizierung als anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit.
Welche Rechtsfolgen ergeben sich aus der Unmöglichkeit?
Die Arbeit beleuchtet die Rechtsfolgen der Unmöglichkeit, einschließlich der Frage der Gegenleistungspflicht bei Unmöglichkeit der Leistung. Diese Aspekte werden in den jeweiligen Kapiteln detailliert behandelt.
Was ist der Unterschied zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglichkeit?
Der Zeitpunkt des Eintritts der Unmöglichkeit ist entscheidend. Liegt die Unmöglichkeit bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vor, spricht man von anfänglicher Unmöglichkeit. Tritt die Unmöglichkeit erst später ein, handelt es sich um nachträgliche Unmöglichkeit.
Welche Rolle spielen Stückschuld und Gattungsschuld bei der Unmöglichkeit?
Die Unterscheidung zwischen Stückschuld und Gattungsschuld ist entscheidend für die Beurteilung der Unmöglichkeit. Bei einer Stückschuld ist die Leistung unmöglich, wenn der geschuldete Gegenstand nicht mehr existiert. Bei einer Gattungsschuld ist die Leistung nur dann unmöglich, wenn die gesamte Gattung nicht mehr verfügbar ist.
Was sind die Schlüsselbegriffe dieser Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Unmöglichkeit, Leistungsstörung, Kaufrecht, §275 BGB, Stückschuld, Gattungsschuld, Holschuld, Schickschuld, Bringschuld, objektive Unmöglichkeit, subjektive Unmöglichkeit, anfängliche Unmöglichkeit, nachträgliche Unmöglichkeit, Rechtsfolge.
- Quote paper
- Julian Behrens (Author), 2020, Die "Unmöglichkeit" als Leistungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/905580