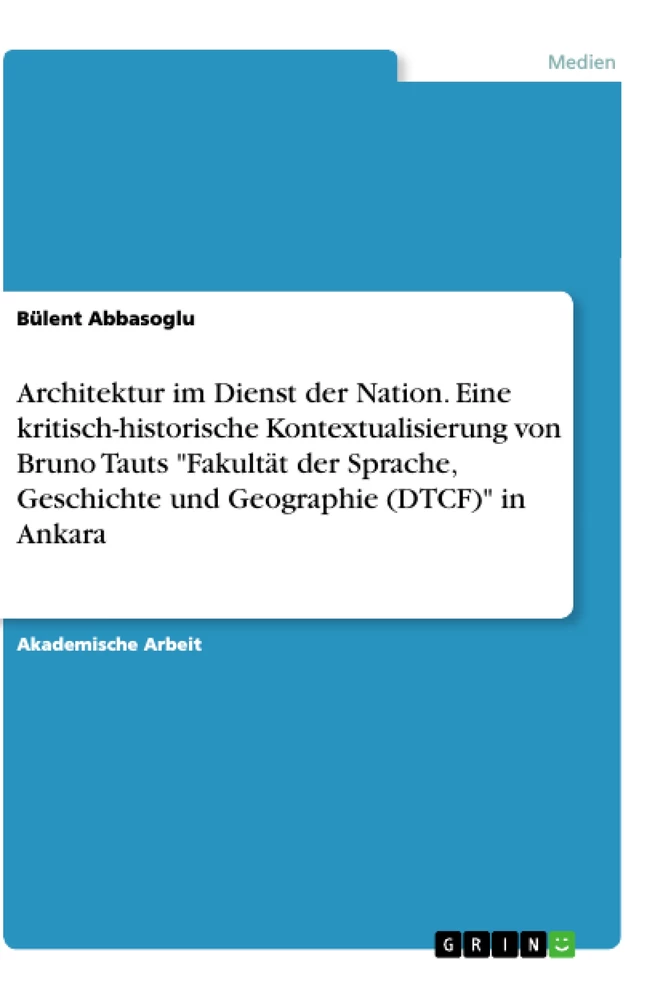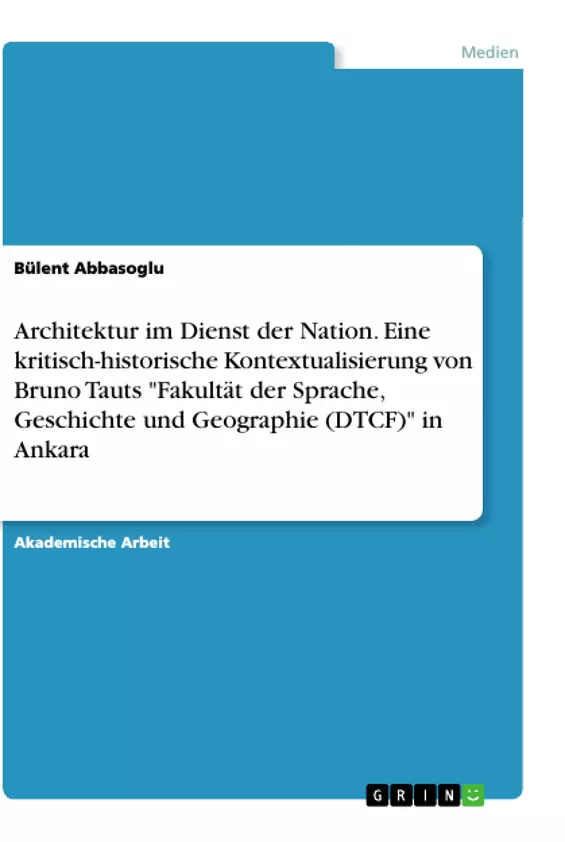Der Autor hinterfragt die bis in die Gegenwart dominierende Repräsentation der kemalistischen Türkei als fortschrittlichem
Modernismus-Projekt und die immer noch überwiegend (insbesondere von deutschen Forschern) positive Bewertung der von Atatürk betriebenen Verwestlichung des Landes. Zum anderen geht es ihm um eine mehr kritische Perspektive auf die autoritäre Seite der modernen Architektur, die staatstragender Ziele diktatorischer Regimes repräsentiert und materialisiert.
Eine dritte Zielrichtung des Autors ist das Erfassen der engen ökonomischen und kulturellen Beziehungen zwischen
dem deutschsprachigen Raum Mitteleuropas und der Türkei seit dem 19. Jahrhundert; eine Kontinuität, in der Abbasoglu auch Bruno Tauts Berufung als Leiter der Architekturfakultät in Istanbul und des Baubüros des türkischen Erziehungsministeriums situiert. Das Verfassen der Arbeit scheint Abbasoglu in der Überzeugung gefestigt zu haben, dass ein politisch in so hohem Masse aufgeladenes Bauwerk nicht getrennt von den Absichten seiner Auftraggeber beurteilt werden kann; und dass ein Architekt, der einen derartigen Auftrag annimmt, Mitverantwortung an der Propaganda eines Regimes trägt.
Diese Bewertung und die "offensichtlichen Wiederspiegelungen" (S. 6) zwischen Rassismus und Diktatur der kemalistischen Türkei und ihrer Stadt- und Architekturpolitik ist bereits zu Beginn der Arbeit (S. 9–10) angekündigt: "Vertreter des Werkbundes waren der Auffassung, dass architektonische Ästhetik eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer Nation spiele". (…) "Das Gebäude DTCF (…) war eine Koproduktion der deutsch-türkischen Zusammenarbeit für die Bildung einer reinen türkischen Nation nach deutschem Vorbild (…)".
In seinem Schlusswort verweist Abbasoglu auf Tauts stille Mittäterschaft (S. 65): "Taut (…) nutzte sein Beruf als Vorwand, sich von der Politik und vom Geschehen in der Türkei zu entziehen". (…) „Er (…) sah sich als unpolitischer Künstler und Organisator, der seine Fähigkeiten in den Nutzen eines Volkes stellte.“ Zugleich weist Abbasoglu auf Tauts Widersprüche in dieser Haltung anhand seiner eigenen, in der Türkei verfassten Architekturlehre hin.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Forschungsfrage und Hypothese
- Zielsetzung und Methode
- Politischer Kontext
- Jungtürkische Revolution
- Die Eroberung des orientalischen Bodens
- Deutscher Einfluss auf die Jungtürken und ihre Ideologie
- Deutscher Kulturimperialismus im Osmanischen Reich: Das Haus der Freundschaft in Konstantinopel
- Deutsch-türkische Beziehungen in der Zeit der Weimarer Republik
- Die Tradition der deutschen Moderne
- Die Rolle der Architektur in der Nation Bildung
- Architektur als politisches Werkzeug und die Vorreiterrolle der deutschen Planungspraxis
- Angora, das neue alte Regierungszentrum
- Der Lörcher-Plan für Angora
- Jansen Plan und Legitimation der autoritären Staatsmacht
- Das Regierungsviertel
- Das Hochschulviertel, der Kniefall der Moderne
- Bruno Taut’s Literatur Fakultät in Ankara
- Der Nutzung angepasste Qualität
- Bruno Tauts Gegenbild Sedad Hakkı Eldem
- Tauts (Un)vollständige Freiheit
- Bruno Taut’s Vorgesetzter: Cevat Dursunoğlu
- Tauts Tod
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kritischen Kontextualisierung des von Bruno Taut entworfenen Gebäudes für die «Fakultät der Sprache, Geschichte und Geographie (DTCF)» in Ankara im Hinblick auf die politischen und architektonischen Strömungen der frühen Republik Türkei. Die Analyse beleuchtet die komplexen Verflechtungen zwischen deutscher Einflussnahme, Kemalistischer Ideologie und der architektonischen Umsetzung des neuen Staatsbildes.
- Der Einfluss deutscher Architekten und Städteplaner auf die Gestaltung Ankaras
- Die Rolle der Architektur als Werkzeug der nationalen Ideologie
- Der Wandel von der osmanischen zur türkischen Architektur
- Die Bedeutung von Tradition und Moderne in der Architektur der frühen Republik Türkei
- Die politische und gesellschaftliche Bedeutung des DTCF-Gebäudes im Kontext der Kemalistischen Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit analysiert zunächst den politischen Kontext der frühen Republik Türkei. Das erste Kapitel beleuchtet die Jungtürkische Revolution und ihren Einfluss auf die staatliche Politik und die Architektur. Es zeigt die deutschen Ambitionen im osmanischen Territorium auf, insbesondere im Zusammenhang mit der Bagdadbahn. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Republik Türkei unter dem Einfluss europäischer Mächte, insbesondere Deutschlands, und analysiert die deutsch-türkischen Beziehungen in der Zeit der Weimarer Republik. Dabei wird auch die Rolle der Militärhilfe und die Bedeutung der Junkers-Werke für den Aufbau der türkischen Armee und der türkischen Flugzeugindustrie betrachtet. Das dritte Kapitel analysiert die Rolle der Architektur im Rahmen der Nationenbildung in der Türkei am Beispiel der Stadt Ankara. Es behandelt die Entstehung des neuen Regierungszentrums, die städtebauliche Gestaltung durch Carl Christoph Lörcher und Hermann Jansen sowie die Verwendung von Architektur als Symbol der Macht. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die von Bruno Taut entworfene Fakultät für Sprachen, Geschichte und Geographie (DTCF). Es beschreibt die Entstehungsgeschichte des Gebäudes, die Zusammenarbeit mit Cevat Dursunoğlu und die Einflussnahme von Mustafa Kemal Atatürk. Darüber hinaus wird der architektonische Stil des DTCF-Gebäudes im Kontext der Werkbunddebatte analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Architektur, des Nationalismus, der deutschen Einflussnahme, der Türkei, des Kemalismus, der Stadtplanung, der Architekturgeschichte, der Moderne und des Exils.
- Citation du texte
- Bülent Abbasoglu (Auteur), 2020, Architektur im Dienst der Nation. Eine kritisch-historische Kontextualisierung von Bruno Tauts "Fakultät der Sprache, Geschichte und Geographie (DTCF)" in Ankara, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902978