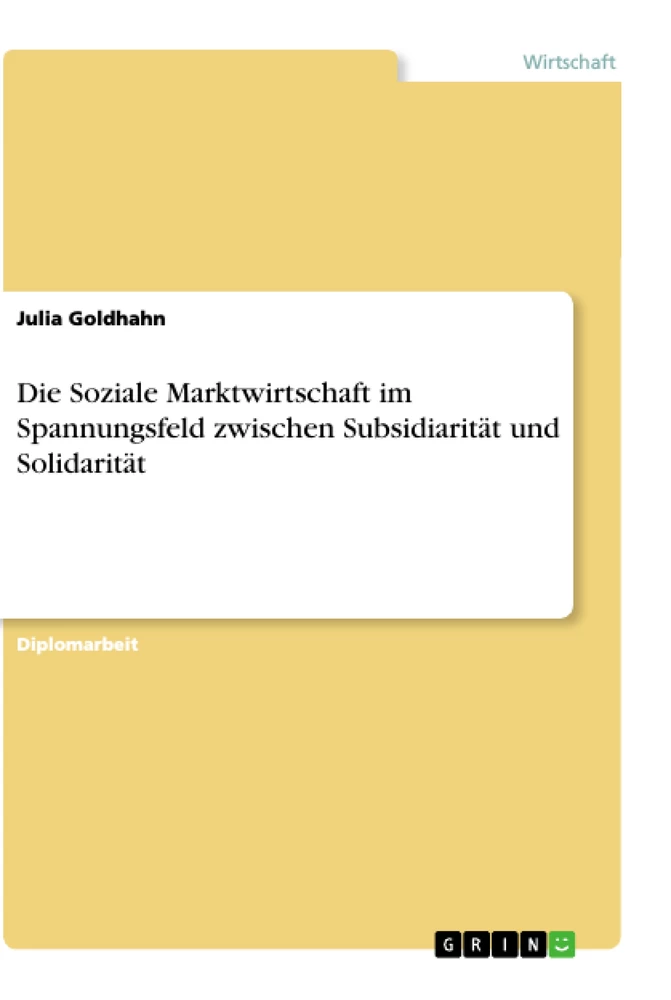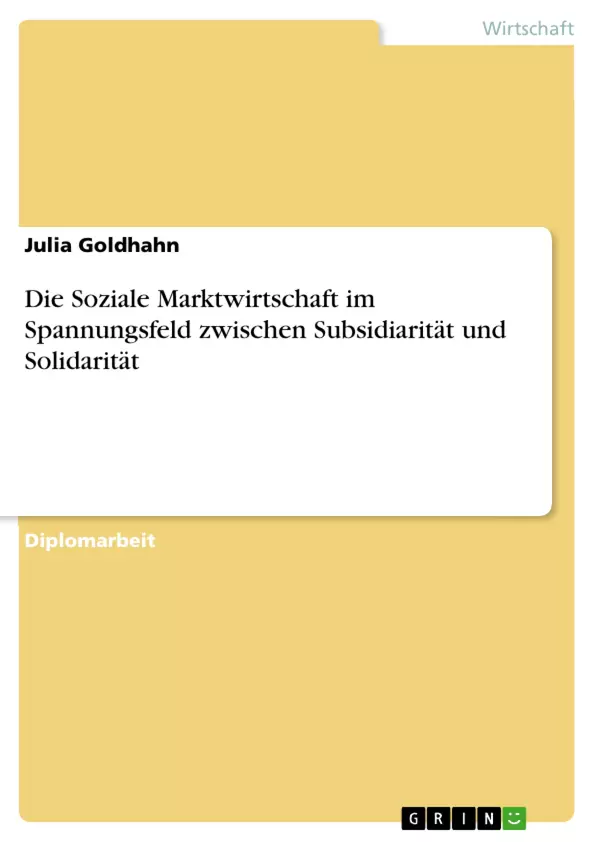Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob die beiden Prinzipien Subsidiarität und Solidarität tatsächlich eine Gefahr für die Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft darstellen und damit als Gefährdungsmomente der Sozialen Marktwirtschaft betrachtet werden müssen. Im Ergebnis wird festgestellt, dass das zwischen den beiden Prinzipien existierende Spannungsverhältnis keinen Zielkonflikt beinhaltet, da vielmehr die Konzeption gerade einen erfolgreichen Ausgleich dieses Konfliktes fordert. Es liegt damit kein Versagen des Konzeptes vor. Dazu werden Indikatoren aufgezeigt, welche nachweisen, dass die Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft auch ihre Erfolgsfaktoren darstellen.
Bereits innerhalb der theoretischen Grundlagen existieren unterschiedliche Auffassungen über die Ausprägung und Gewichtung ihrer beiden Hauptprinzipien der Subsidiarität und Solidarität. Das liegt daran, dass sich eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Theoretikern, welche von verschiedenen geistigen Strömungen beeinflusst worden sind, mit der Thematik beschäftigt hat. Es kann daher keine einheitliche, abgrenzbare Konzeption gefunden werden. In diesem Kontext ist es auch schwierig, die Frage zu beantworten, inwiefern die Politik das Konzept, was letztlich aus verschiedenen Ansätzen entstanden ist, in die Praxis umgesetzt hat. Vielmehr spielen in der Praxis historische Bedingungen, als auch politische Beweggründe eine Rolle, wie das Konzept gesehen, interpretiert und was schließlich davon realisiert wird.
Einige Autoren behaupten, dass die Soziale Marktwirtschaft zwar umgesetzt wurde, sich jedoch nicht bewährt habe. Manche sprechen sogar von einem Konzeptionsversagen aufgrund des Spannungsfeldes zwischen Subsidiarität und Solidarität. Andere sehen die Ursache in einem Versagen der Politik, welches zu einer Verschiebung der Balance der beiden Grundprinzipien geführt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft
- Der ökonomische Liberalismus als Wurzel der Sozialen Marktwirtschaft
- Neoliberalismus und Ordoliberalismus - ideengeschichtliche Erneuerung
- Die Freiburger Schule unter W. Eucken
- Der soziologische Neoliberalismus um W. Röpke und A. Rüstow
- Christliche Sozialethik
- Das Prinzip der Subsidiarität
- Das Prinzip der Solidarität
- A. Müller-Armacks Konzept der Sozialen Marktwirtschaft
- Der Begriff
- Theoretische Einflüsse auf Müller-Armack
- Entstehung der Stileinheit Soziale Marktwirtschaft und Soziale Irenik
- Marktwirtschaft als notwendiges und tragendes Gerüst
- Der soziale Charakter der Marktwirtschaft
- Aufgaben der Politik des Staates
- Soziale Marktwirtschaft als offener Stilgedanke
- Einführung der Sozialen Marktwirtschaft
- Die wirtschaftliche und politische Situation nach dem Krieg
- Erste Konzepte für eine Nachkriegsordnung
- Vorstellungen der politischen Kräfte - die Sozialisierungsdebatte
- Die Besatzungspolitik der Alliierten und ihr Einfluss auf die deutsche Nachkriegsordnung
- Die deutsche Diskussion um eine Nachkriegsordnung - das Ende der Sozialisierungsdebatte und ihr Ergebnis
- Die Bedeutung der Wirtschafts- und Währungsreform für die Umsetzung der Sozialen Marktwirtschaft
- Entwicklung von Wirtschaft und Politik in Deutschland seit 1948
- Der Wiederaufbau - das westdeutsche „Wirtschaftswunder“ (1948 - 1966)
- Erste Turbulenzen - Keynesianische Globalsteuerung (1966 - 1982)
- Angebotsorientierte Politik der Regierung Kohl (1982 - 1989)
- Wirtschaftliche und politische Entwicklung nach der Wiedervereinigung (1990 - 1993)
- Letztere Tendenzen im vereinten Deutschland (seit 1994)
- Subsidiarität und Solidarität als Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft
- Die Grundprinzipien als Gefährdungsmomente der Sozialen Marktwirtschaft
- Zielkonflikte zwischen den beiden Grundprinzipien
- Überbetonung des Prinzips der Solidarität und ihre Auswirkungen
- Die Grundprinzipien als Erfolgsfaktoren der Sozialen Marktwirtschaft
- Erfolgsfaktor Subsidiarität - Die Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft
- Erfolgsfaktor Solidarität - Sozialer Friede und Stabilität in Deutschland
- Die Kombination beider Prinzipien als Erfolgsfaktor - „Wohlstand für alle“
- Ergebnis der Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Soziale Marktwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Subsidiarität und Solidarität. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen dieses komplexen Konzepts zu beleuchten und die Rolle beider Prinzipien sowohl als potenzielle Gefährdungs- als auch als Erfolgsfaktoren zu analysieren. Die Arbeit vermeidet einseitige Wertungen und strebt nach einer umfassenden Darstellung.
- Theoretische Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft und die unterschiedlichen Strömungen (Ordoliberalismus, Soziologischer Neoliberalismus).
- Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft nach Alfred Müller-Armack.
- Einführung und Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands.
- Subsidiarität und Solidarität als Grundprinzipien: ihre Bedeutung und mögliche Konflikte.
- Bewertung der Prinzipien als Erfolgs- und Gefährdungsfaktoren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Komplexität des Themas Soziale Marktwirtschaft und die verschiedenen, oft gegensätzlichen, Interpretationen. Sie betont das Ziel der Arbeit, eine umfassende und vielseitige Betrachtungsweise zu liefern, anstatt sich auf einseitige Standpunkte zu beschränken. Die Arbeit geht von der Annahme aus, dass das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft weitgehend verwirklicht ist, jedoch werden auch kritische Stimmen berücksichtigt, die von einem Konzeptions- oder Politikversagen sprechen.
Theoretische Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die intellektuellen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft, indem es den ökonomischen Liberalismus, den Neoliberalismus (inklusive der Freiburger Schule und des soziologischen Neoliberalismus um Röpke und Rüstow) und die christliche Sozialethik mit ihren Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität untersucht. Die verschiedenen Denkschulen und ihre Beiträge zum Gesamtkonzept werden differenziert dargestellt, um die Komplexität der theoretischen Grundlagen zu verdeutlichen.
A. Müller-Armacks Konzept der Sozialen Marktwirtschaft: Dieses Kapitel widmet sich detailliert dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, wie es von Alfred Müller-Armack entwickelt wurde. Es analysiert die theoretischen Einflüsse auf seine Arbeit, die Entstehung des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“, die Rolle der Marktwirtschaft als tragendes Gerüst, den sozialen Charakter der Marktwirtschaft und die Aufgaben des Staates. Der offene Stilgedanke der Sozialen Marktwirtschaft wird hier ebenfalls erläutert.
Einführung der Sozialen Marktwirtschaft: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es untersucht die wirtschaftliche und politische Situation nach dem Krieg, die ersten Konzepte für eine Nachkriegsordnung, die Sozialisierungsdebatte, den Einfluss der Alliierten und die Bedeutung der Wirtschafts- und Währungsreform für die Umsetzung des Konzepts.
Entwicklung von Wirtschaft und Politik in Deutschland seit 1948: Dieses Kapitel zeichnet die wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands seit 1948 nach, von den Jahren des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders bis zur Wiedervereinigung und den darauffolgenden Entwicklungen. Es analysiert verschiedene politische Steuerungskonzepte wie keynesianische Globalsteuerung und angebotsorientierte Politik, um den Kontext für die Entwicklung und Anwendung der Sozialen Marktwirtschaft zu beleuchten.
Subsidiarität und Solidarität als Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft: Dieses Kapitel untersucht die beiden zentralen Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, Subsidiarität und Solidarität, als sowohl potenzielle Gefährdungs- als auch als Erfolgsfaktoren. Es analysiert mögliche Zielkonflikte zwischen den Prinzipien, die Überbetonung der Solidarität und die positiven Auswirkungen der Kombination beider Prinzipien auf die deutsche Volkswirtschaft und den sozialen Frieden.
Schlüsselwörter
Soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Solidarität, Ordoliberalismus, Soziologischer Neoliberalismus, Alfred Müller-Armack, Wirtschaftswunder, Nachkriegsordnung, Deutschland, Wirtschaftspolitik, Konflikt, Erfolgsfaktor, Gefährdungsfaktor.
Soziale Marktwirtschaft: Subsidiarität und Solidarität im Spannungsfeld - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Soziale Marktwirtschaft Deutschlands, insbesondere das Spannungsverhältnis zwischen den Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität. Sie untersucht diese Prinzipien als sowohl potenzielle Erfolgs- als auch Gefährdungsfaktoren des Systems.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum ab: Die theoretischen Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft (ökonomischer Liberalismus, Ordoliberalismus, soziologischer Neoliberalismus, christliche Sozialethik), Alfred Müller-Armacks Konzept, die Einführung und Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands seit 1948, und schließlich eine detaillierte Untersuchung der Prinzipien Subsidiarität und Solidarität und deren Auswirkungen.
Welche theoretischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die intellektuellen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft, indem sie den ökonomischen Liberalismus, den Neoliberalismus (mit Fokus auf die Freiburger Schule und den soziologischen Neoliberalismus um Röpke und Rüstow) und die christliche Sozialethik mit ihren Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität untersucht. Die verschiedenen Denkschulen und ihre Beiträge zum Gesamtkonzept werden differenziert dargestellt.
Welche Rolle spielt Alfred Müller-Armack?
Die Arbeit widmet sich detailliert dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, wie es von Alfred Müller-Armack entwickelt wurde. Es wird seine theoretischen Einflüsse, die Entstehung des Begriffs „Soziale Marktwirtschaft“, die Rolle der Marktwirtschaft als tragendes Gerüst, der soziale Charakter der Marktwirtschaft und die Aufgaben des Staates analysiert. Der offene Stilgedanke der Sozialen Marktwirtschaft wird ebenfalls erläutert.
Wie wird die historische Entwicklung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt den historischen Kontext der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, die wirtschaftliche und politische Situation nach dem Krieg, die ersten Konzepte für eine Nachkriegsordnung, die Sozialisierungsdebatte, den Einfluss der Alliierten und die Bedeutung der Wirtschafts- und Währungsreform. Die wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands seit 1948 wird ebenfalls nachgezeichnet, inklusive der Analyse verschiedener politischer Steuerungskonzepte.
Wie werden Subsidiarität und Solidarität behandelt?
Subsidiarität und Solidarität werden als zentrale Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft untersucht, sowohl in ihrer Bedeutung als Erfolgsfaktoren als auch als potenzielle Gefährdungsfaktoren. Mögliche Zielkonflikte zwischen den Prinzipien, die Überbetonung der Solidarität und die positiven Auswirkungen der Kombination beider Prinzipien auf die deutsche Volkswirtschaft und den sozialen Frieden werden analysiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt auf eine umfassende Darstellung der Sozialen Marktwirtschaft ab, die verschiedene Perspektiven und Interpretationen berücksichtigt. Sie vermeidet einseitige Wertungen und strebt nach einer ausgewogenen Analyse der Rolle von Subsidiarität und Solidarität für den Erfolg und die Herausforderungen des Systems. Die Arbeit geht von der Annahme aus, dass das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft weitgehend verwirklicht ist, berücksichtigt aber auch kritische Stimmen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Solidarität, Ordoliberalismus, Soziologischer Neoliberalismus, Alfred Müller-Armack, Wirtschaftswunder, Nachkriegsordnung, Deutschland, Wirtschaftspolitik, Konflikt, Erfolgsfaktor, Gefährdungsfaktor.
- Citar trabajo
- Julia Goldhahn (Autor), 2007, Die Soziale Marktwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Subsidiarität und Solidarität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902221